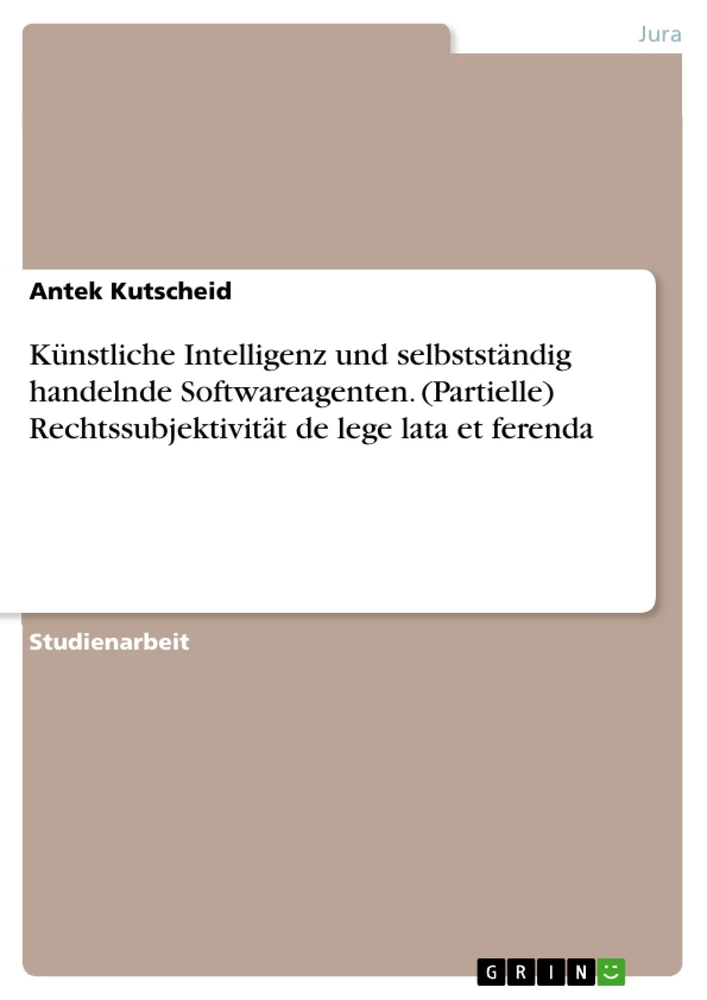Interaktionen von autonomer, starker KI und Außenstehenden gibt es in ihrer Höchstform noch nicht, jedoch nimmt der Fortschritt technischer Erfindungen immer mehr an Fahrt auf, sodass es vermutlich nicht mehr allzu lange dauern wird, bis erste marktreife Softwareagenten in einer hochgradig autonomen Form starker KI mit Außenstehenden interagieren werden. Nun gilt es, die oben behandelten Verhaltensmuster und Fähigkeiten von Softwareagenten rechtlich - vor allem mit Blick auf die Zukunft - zu würdigen. Es wird um die Frage gehen, ob Softwareagenten ,,handeln" können, und ob sie Verträge für jemanden schließen können. Und wenn dies der Fall ist, was soll passieren, wenn dem Vertragspartner oder einem Dritten ein Schaden entsteht? Wer haftet?
Heutzutage findet man noch keine Softwareagenten vor, die auf einer vollständig starken KI basieren, man ist jedoch nicht mehr weit von den Fähigkeiten einer starken KI entfernt. Autonome Softwareagenten werden z. B. im High-Frequency-Trading eingesetzt. Hierbei werden minimale Kursunterschiede automatisch vom Softwareagenten analysiert, dieser entscheidet dann - ohne menschliches Zutun - ob, wo und wann Wertpapiere u. ä. ge- oder verkauft werden. Zu vergleichen sind diese Softwareagenten mit einem Börsenmakler, der in rasantem Tempo seine Geschäfte tätigt und mit den Jahren an Erfahrung sammelt, um daraus neues Wissen für künftige Entscheidungen zu generieren.
Für den Durchschnittsverbraucher, der nichts mit HFT zu tun hat, könnte Google Duplex als Softwareagent für den häuslichen Gebrauch bald nicht mehr wegzudenken sein. Duplex ist ein autonomer Sprachassistent (nicht Google Assistant!), der mit einer natürlichen Menschenstimme spricht, und hauptsächlich Termine für seinen Verwender buchen kann. Hierbei verhält sich Duplex am Telefon wie ein menschlicher Gesprächspartner, benutzt sogar Füllwörter (Hmm, Ehm, .) und kann flexibel auf jegliches Verhalten des Gesprächspartners reagieren. Diese Technik stützt sich unter anderem auf eine große Datenbasis und vor allem auf Neuronale Netze, sodass hier schon beinahe von starker KI gesprochen werden kann, es jedoch i. E. noch nicht ist.
Inhaltsverzeichnis
- A. Künstliche Intelligenz – Was ist das?
- I. Schwache KI.
- II. Starke KI
- III. Lernprozesse des Softwareagenten
- 1. Machine-Learning
- 2. Deep-Learning
- IV. Softwareagenten im heutigen Gebrauch
- B. Lösung de lege lata.
- I. Digitale Willenserklärung
- 1. Willenserklärung des Softwareagenten?
- 2. Botenschaft.
- 3. Blanketterklärung
- II. Vertragliche Haftung
- III. Deliktische Haftung des Verwenders
- C. Vorschläge/Ansätze für Lösungen de lege ferenda
- I. Rechtssubjektivität und Stellvertretung
- 1. Haftung nach § 179 BGB analog
- 2. Haftungsmasse des Softwareagenten
- II. Regelwerk zur Interaktion mit Softwareagenten
- III. Gefährdungshaftungstatbestand
- IV. Ausblick auf die E-Personhood
- D. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Künstliche Intelligenz (KI) als Rechtssubjekt anerkannt werden sollte. Sie analysiert die aktuelle Rechtslage (de lege lata) und entwickelt Vorschläge für eine zukünftige Rechtsordnung (de lege ferenda) im Umgang mit KI-Systemen.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Arten von KI
- Analyse der Rechtsfähigkeit von Softwareagenten im aktuellen Rechtssystem
- Entwicklung von Konzepten für die rechtliche Behandlung von KI-Systemen
- Diskussion der Herausforderungen und Chancen der Anerkennung von KI als Rechtssubjekt
- Betrachtung des Einflusses von KI auf das Vertrags- und Deliktsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Klärung des Begriffs „Künstliche Intelligenz“ und unterscheidet dabei zwischen schwacher und starker KI.
Im zweiten Teil analysiert die Arbeit die rechtliche Situation von KI-Systemen im aktuellen Rechtsrahmen. Dazu werden unter anderem die Themen Willenserklärung, Vertragliche Haftung und Deliktische Haftung behandelt.
Der dritte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit Vorschlägen für die zukünftige rechtliche Einordnung von KI. Hier werden Themen wie Rechtssubjektivität, Stellvertretung, Gefährdungshaftung und E-Personhood diskutiert.
Schlüsselwörter
Künstliche Intelligenz, Rechtssubjektivität, Softwareagenten, De lege lata, De lege ferenda, Vertrag, Haftung, Deliktsrecht, E-Personhood, Machine-Learning, Deep-Learning.
Häufig gestellte Fragen
Können Softwareagenten mit KI rechtlich „handeln“?
Die Arbeit untersucht, ob die Aktionen autonomer Softwareagenten als Willenserklärungen gewertet werden können und wie sie Verträge für ihre Verwender schließen.
Wer haftet, wenn eine KI einen Schaden verursacht?
Es wird zwischen vertraglicher Haftung und deliktischer Haftung des Verwenders unterschieden, sowie neue Konzepte wie ein Gefährdungshaftungstatbestand diskutiert.
Was ist der Unterschied zwischen schwacher und starker KI?
Schwache KI löst konkrete Anwendungsprobleme, während starke KI menschenähnliche intellektuelle Fähigkeiten besitzt. Heutige Systeme wie Google Duplex nähern sich der starken KI an.
Was bedeutet „E-Personhood“?
Es ist ein Vorschlag für die Zukunft (de lege ferenda), Softwareagenten eine eigene Rechtspersönlichkeit zu verleihen, um Haftungsfragen direkt über das System zu lösen.
Wie wird KI heute bereits im Handel eingesetzt?
Ein Beispiel ist das High-Frequency-Trading (HFT), bei dem Softwareagenten autonom und in rasantem Tempo Wertpapiere kaufen oder verkaufen.
- Citar trabajo
- Antek Kutscheid (Autor), 2019, Künstliche Intelligenz und selbstständig handelnde Softwareagenten. (Partielle) Rechtssubjektivität de lege lata et ferenda, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539304