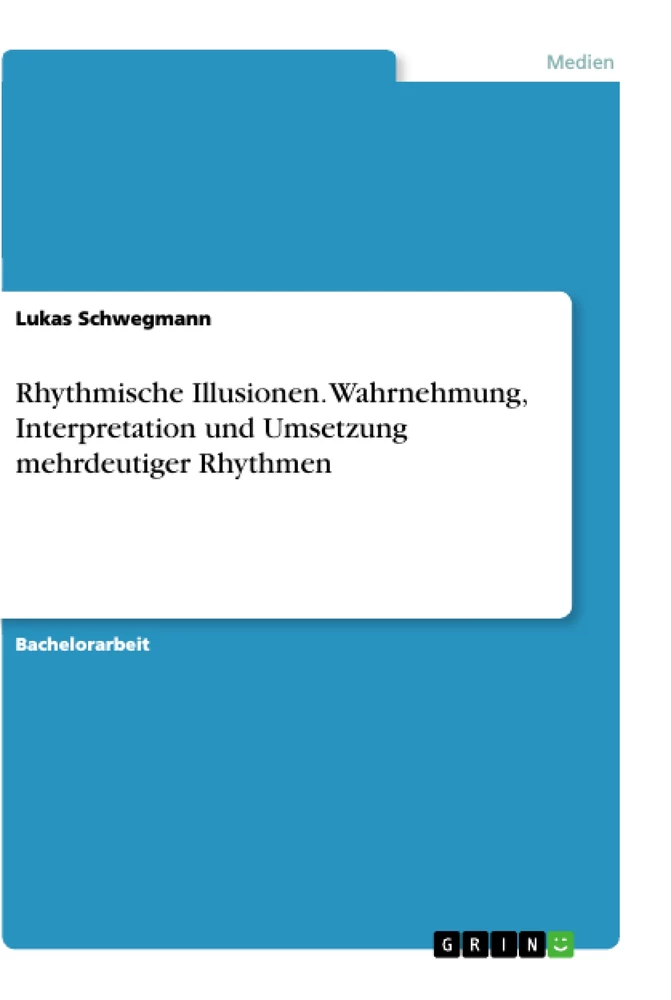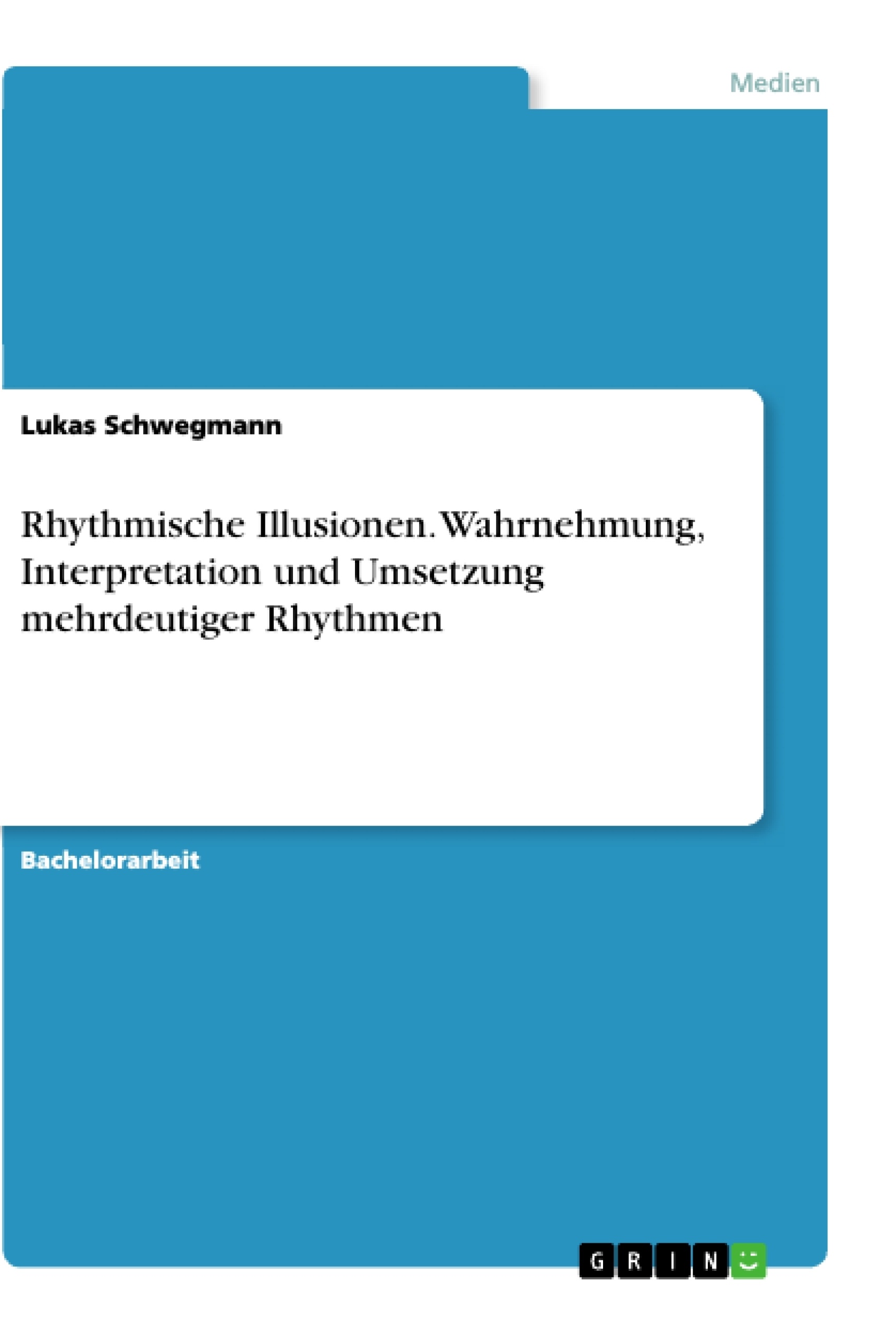Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie dem Hörer ein "falsches" Metrum vorgetäuscht werden kann und wie solche sogenannten rhythmischen Illusionen musikalisch umgesetzt werden können.
Hierzu werden die Begriffe Puls, Metrum und Rhythmus definiert sowie die mit diesen zusammenhängenden wahrnehmungspsychologischen Prinzipien beschrieben. Außerdem werden wesentliche Formen der rhythmischen Komplexität und metrischer Mehrdeutigkeit vorgestellt. Anhand von verschiedenen Musikbeispielen wird untersucht, wie rhythmische Illusionen kompositorisch umgesetzt werden können und welche der zuvor beschriebenen Formen rhythmischer Komplexität und metrischer Mehrdeutigkeit dazu verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlegende Begriffe und Prinzipien
- 2.1 Beat, Puls und tactus
- 2.2 Metrum
- 2.2.1 Metrum als kognitiver Prozess
- 2.3 Rhythmus
- 2.3.1 Gruppenbildung
- 2.3.2 Die Extraktion eines Grundpulses
- 3. Interaktion von Rhythmus und Metrum
- 3.1 Metrische Formbarkeit
- 3.2 Metrische Dissonanz und Mehrdeutigkeit
- 3.2.1 Metrische Dissonanz
- 3.2.2 Lokale metrische Diskrepanzen
- 3.3 Polyrhythmus
- 4. Betrachtung und Analyse von Beispielen
- 4.1 Rhythmische Illusionen durch Phasenverschiebungen
- 4.1.1 „Drive my Car“ (The Beatles)
- 4.1.2 „Hang Up Your Hang Ups“ (Herbie Hancock)
- 4.1.3 „Bring On The Night“ (The Police)
- 4.1.4 Sinfonie No. 92 G-Dur 3. Satz (Joseph Haydn)
- 4.2 Rhythmische Illusionen durch Polyrhythmen
- 4.2.1 „Sightseeing“ - The Yellowjackets
- 4.2.2 „Escher Sketch (A Tale Of Two Rhythms)“ - Michael Brecker
- 4.2.3 „Echoes“ (Steve Lehman)
- 4.2.4 „Double-Faced“ (Tigran Hamasyan)
- 4.1 Rhythmische Illusionen durch Phasenverschiebungen
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Hörer*innen ein „falsches“ Metrum vorgetäuscht werden kann und wie solche sogenannten rhythmischen Illusionen musikalisch umgesetzt werden können. Hierfür werden die Begriffe Puls, Metrum und Rhythmus definiert sowie die mit diesen verbundenen wahrnehmungs-psychologischen Prinzipien beschrieben. Weiterhin werden wesentliche Formen der rhythmischen Komplexität und metrischen Mehrdeutigkeit vorgestellt.
- Definition und Beschreibung der Begriffe Puls, Metrum und Rhythmus
- Vorstellung der wahrnehmungs-psychologischen Prinzipien, die mit Puls, Metrum und Rhythmus verbunden sind
- Analyse unterschiedlicher Formen der rhythmischen Komplexität
- Fokus auf metrische Mehrdeutigkeit
- Untersuchung der kompositorischen Umsetzung rhythmischer Illusionen anhand verschiedener Musikbeispiele
Zusammenfassung der Kapitel
In der Einleitung wird der Bezug zwischen Rhythmus und dem menschlichen Empfinden hergestellt. Es wird erläutert, wie Rhythmus in verschiedenen Bereichen des Lebens eine wichtige Rolle spielt und wie die Synchronisation zu einem Puls ein entscheidendes Element für das Erleben von Musik ist. Das Konzept der rhythmischen Illusion als Umschlag der Wahrnehmung, bei dem Hörer*innen ein „falsches“ Metrum vorgetäuscht wird, wird eingeführt.
Kapitel 2 definiert die Grundbegriffe Puls, Metrum und Rhythmus und beschreibt die damit verbundenen wahrnehmungs-psychologischen Prinzipien. Es werden die verschiedenen Formen zeitlicher Organisation in der Musik betrachtet und die Bedeutung der Unterscheidung zwischen diesen für die rhythmische Analyse von Musikstücken hervorgehoben.
Kapitel 3 untersucht die Interaktion von Rhythmus und Metrum, insbesondere im Hinblick auf metrische Formbarkeit, Dissonanz und Mehrdeutigkeit. Es werden verschiedene Formen der rhythmischen Komplexität vorgestellt, wobei ein Schwerpunkt auf metrischer Mehrdeutigkeit liegt.
Kapitel 4 analysiert verschiedene Musikbeispiele, in denen rhythmische Illusionen vorkommen. Es wird untersucht, wie diese Illusionen hervorgerufen werden, welche Formen der rhythmischen Komplexität dabei verwendet werden und wie diese rhythmischen Illusionen kompositorisch umgesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Rhythmus, Metrum, Puls, rhythmische Illusion, metrische Mehrdeutigkeit, rhythmische Komplexität, Phasenverschiebung, Polyrhythmus, Groove, wahrnehmungs-psychologische Prinzipien, Musikbeispiele, kompositorische Umsetzung
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer rhythmischen Illusion?
Eine rhythmische Illusion ist ein wahrnehmungspsychologischer Effekt, bei dem dem Hörer durch musikalische Gestaltung ein „falsches“ Metrum vorgetäuscht wird.
Wie unterscheiden sich Puls und Metrum?
Der Puls (Beat) ist die regelmäßige zeitliche Grundeinheit, während das Metrum die hierarchische Gliederung dieser Pulse in betonte und unbetonte Schläge beschreibt.
Was ist metrische Mehrdeutigkeit?
Metrische Mehrdeutigkeit liegt vor, wenn ein Rhythmus so gestaltet ist, dass er verschiedene Interpretationen des zugrunde liegenden Metrums zulässt.
Welche Techniken werden zur Erzeugung rhythmischer Illusionen genutzt?
Häufige Techniken sind Phasenverschiebungen (z. B. bei den Beatles oder Police) sowie Polyrhythmen, die verschiedene Puls-Ebenen gleichzeitig nutzen.
Gibt es Beispiele für rhythmische Illusionen in der klassischen Musik?
Ja, die Arbeit analysiert unter anderem den 3. Satz der Sinfonie No. 92 von Joseph Haydn als Beispiel für die kompositorische Umsetzung solcher Effekte.
- Quote paper
- Lukas Schwegmann (Author), 2019, Rhythmische Illusionen. Wahrnehmung, Interpretation und Umsetzung mehrdeutiger Rhythmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539416