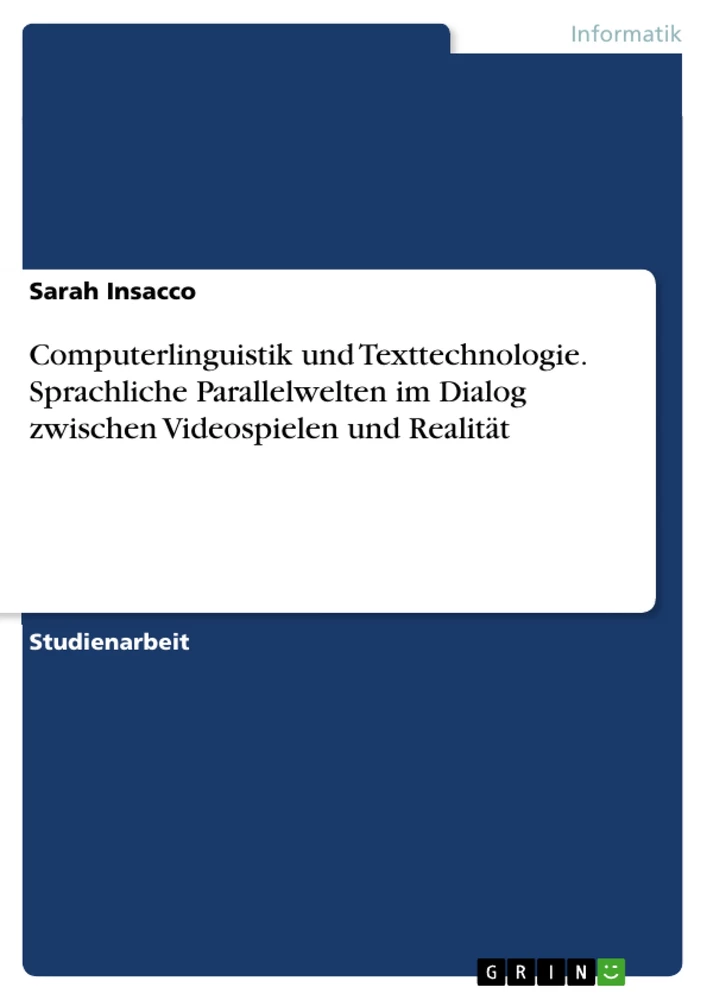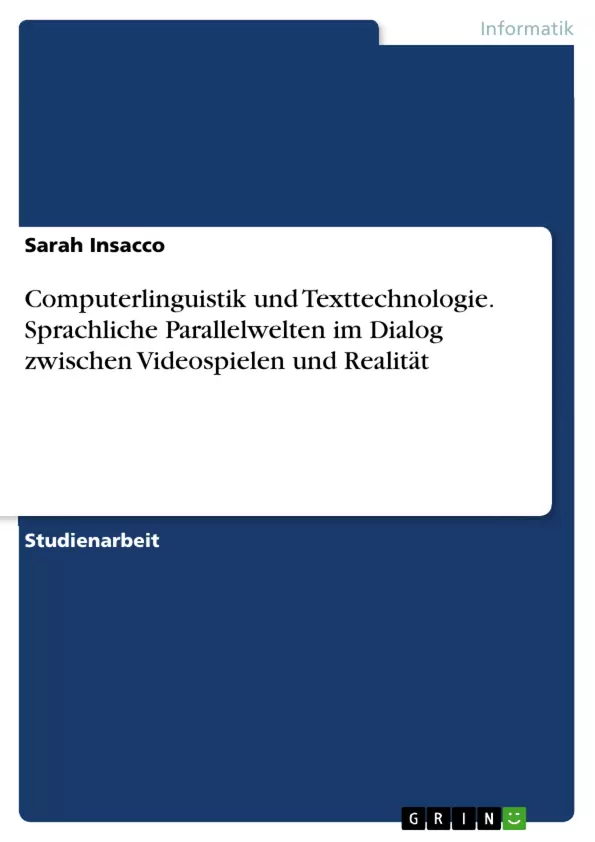In dieser Arbeit stehen unterschiedliche Themengebiete in einem engen Zusammenspiel miteinander, von denen lediglich eines das der computervermittelten Kommunikation ist. Ein weiteres wesentliches Themengebiet lässt sich in manuellen Verfahren der Transkription mithilfe von entsprechender computerlinguistischer Software verorten; das dritte und letzte übergeordnete Themengebiet gründet sich auf der Dialogorganisation und -analyse und deren Parameter nach Gerd Fritz.
Vereint werden diese drei Themengebiete in dem eigentlichen Schwerpunkt dieses Projekts: Die gesprochensprachliche Kommunikation von Spielern in Co-Op-Videospielen beziehungsweise Co-Op-Modi über Voice-Over-IP-Software steht hier als grundsätzliches Datenmaterial im Vordergrund; beantwortet werden soll in erster Linie die Frage danach, wie die Spieler auf einer sprachlichen Ebene ihre Kommunikation miteinander organisieren hinsichtlich der unterschiedlichen Ebenen, auf die sie inner- und außerhalb des Spielgeschehens Bezug nehmen.
Diese Frage basiert auf der Annahme, dass es im Wesentlichen zwei Bezugsebenen gibt, zwischen denen die Spieler im Dialog wechseln und die es entsprechend verbal zu organisieren gilt; diese beiden Ebenen umfassen einmal die Realität, in der sie sich befinden, und die virtuelle Spielwelt, in der das Videospiel situiert ist. Diese sprachlichen Parallelwelten und deren Organisation im Dialog der Spieler aufzudecken stellt das wesentliche Untersuchungsanliegen dieses Projekts dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Dialog beim Spielen über Voice-Over-IP
- 2.2. Aufschlüsselung der Dialogorganisation nach Gerd Fritz
- 3. Methodische Grundlagen
- 3.1. Transkriptionspraxis mit dem EXMARALDA-Partitur-Editor
- 3.2. Über das ausgewählte Datenmaterial
- 4. Analyse des Datenmaterials
- 4.1. Dialogorganisatorische Untersuchung eines Transkriptionsausschnitts
- 4.2. Die Parallelwelten - dialogorganisatorisch abgrenzbar?
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Kommunikation von Spielern in Co-Op-Videospielen über Voice-Over-IP-Software. Das Hauptziel besteht darin, zu untersuchen, wie die Spieler ihre Kommunikation organisieren, während sie sich auf unterschiedliche Ebenen des Spielgeschehens beziehen - die virtuelle Spielwelt und die reale Welt.
- Sprachliche Organisation im Dialog von Spielern in Co-Op-Videospielen
- Unterscheidung zwischen der realen Welt und der virtuellen Spielwelt in der Kommunikation
- Analyse der Dialogorganisation nach Gerd Fritz
- Transkriptionspraxis mithilfe von EXMARALDA
- Computervermittelte Kommunikation in Videospielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema des Projekts vor: Die sprachliche Kommunikation von Spielern in Co-Op-Videospielen über Voice-Over-IP-Software und die Untersuchung der Dialogorganisation im Kontext der virtuellen Spielwelt und der realen Welt.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Projekts, insbesondere das Forschungsfeld der computervermittelten Kommunikation und die Dialogorganisation nach Gerd Fritz.
- Methodische Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert die methodischen Grundlagen des Projekts, wie die Transkriptionspraxis mit dem EXMARALDA-Partitur-Editor und die Auswahl des Datenmaterials.
- Analyse des Datenmaterials: Dieses Kapitel präsentiert die Analyse des Datenmaterials, einschließlich der dialogorganisatorischen Untersuchung eines Transkriptionsausschnitts und der Frage, ob die „Parallelwelten“ dialogorganisatorisch abgrenzbar sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Schlüsselwörter Co-Op-Videospiele, Voice-Over-IP, Dialogorganisation, computervermittelte Kommunikation, Transkriptionspraxis, EXMARALDA, Sprachliche Parallelwelten, virtuelle Spielwelt, reale Welt, und Gerd Fritz.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Projekt "Sprachliche Parallelwelten"?
Die Arbeit untersucht die Kommunikation von Spielern in Co-Op-Videospielen über Voice-Over-IP (z.B. Discord/Teamspeak) und wie sie zwischen der realen Welt und der virtuellen Spielwelt wechseln.
Welche theoretische Grundlage wird für die Dialoganalyse genutzt?
Die Analyse basiert auf den Parametern der Dialogorganisation und -analyse nach Gerd Fritz.
Was ist EXMARALDA?
EXMARALDA ist eine computerlinguistische Software (Partitur-Editor), die zur manuellen Transkription und Analyse gesprochener Sprache verwendet wird.
Sind die Parallelwelten im Dialog klar abgrenzbar?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und analysiert, mit welchen sprachlichen Mitteln Spieler den Bezugsrahmen zwischen Spielgeschehen und physischer Realität organisieren.
Was ist computervermittelte Kommunikation (CvK)?
Es handelt sich um jede Form des menschlichen Austauschs, die über elektronische Geräte und Netzwerke stattfindet, in diesem Fall synchron über Sprache im Gaming-Kontext.
- Arbeit zitieren
- Sarah Insacco (Autor:in), 2018, Computerlinguistik und Texttechnologie. Sprachliche Parallelwelten im Dialog zwischen Videospielen und Realität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539422