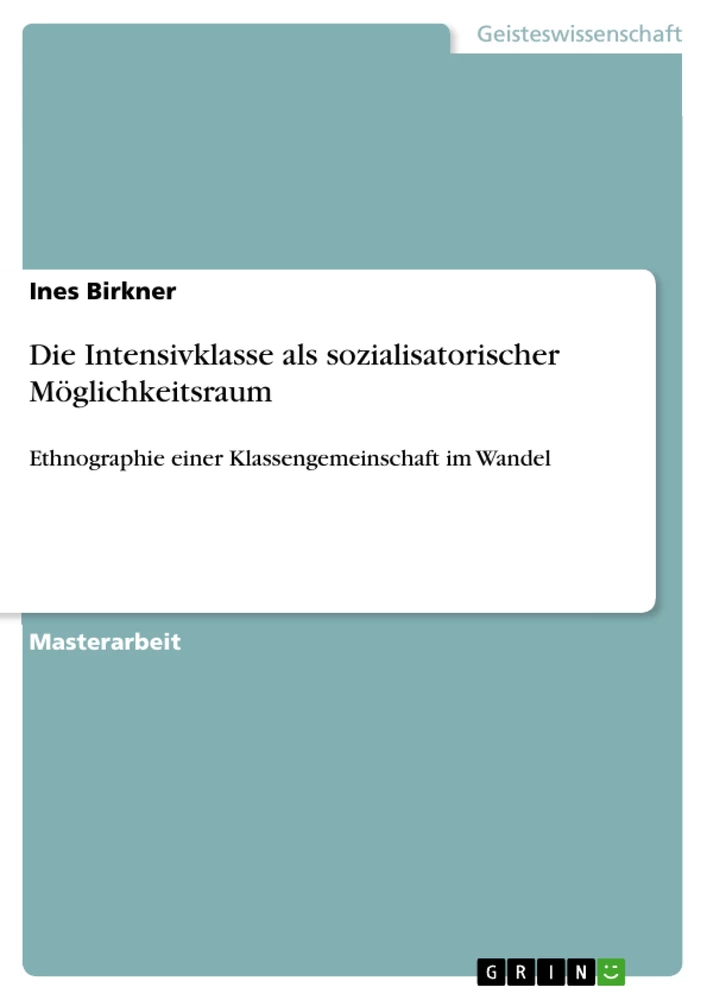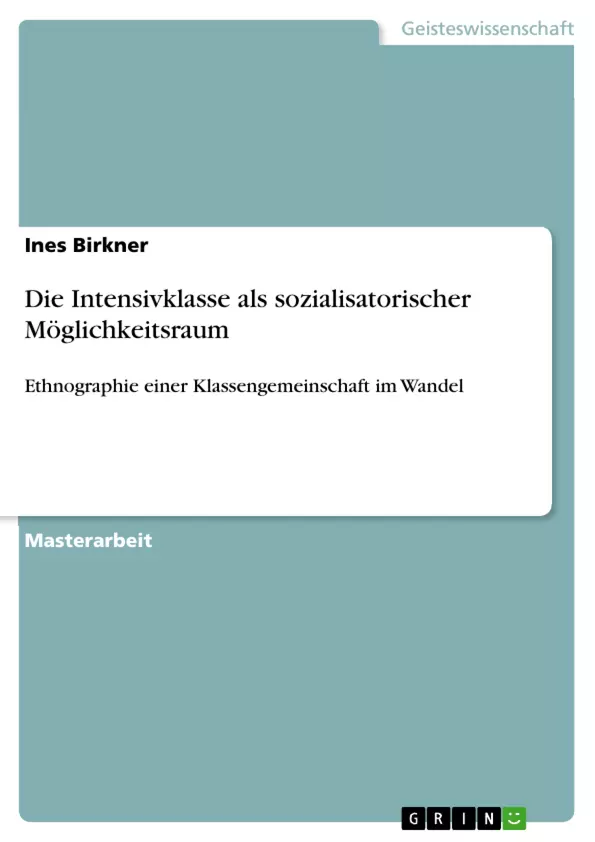Die Arbeit möchte die bisher einseitig verlaufenen Diskurse zur Beschulung sogenannter Seiteneinsteiger aufzeigen. Sie versteht sich als ein interaktionistisch-konstruktivistischer Beitrag zur ethnographischen Sozialisations- und Schulforschung. Sie liefert zahlreiche empirische Einblicke in den Alltag einer Intensivklasse Deutsch sowie rekonstruktive Analysen des sozialisatorischen Potentials einer solch heterogenen Klassengemeinschaft, die nicht zuletzt auch für eine differenzsensible Lehrerbildung erkenntnisreich sind.
Es ist kein neues Phänomen, wie Frank-Olaf Radtke bereits in den 90er Jahren konstatiert: "Seiteneinsteiger hat es als Folge des Migrationsprozesses immer gegeben, weil sich Migrationsentscheidungen der Eltern nicht nach dem Schuljahresrhythmus richten." Entlang vielfältiger Dimensionen begegnet uns eine entsprechend heterogene Schülerschaft in den speziell eingerichteten Klassen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche. Neben dem Alter und Lernstand sowie der Herkunft und Sprache, sind es vor allem auch die sozialisatorischen und (bildungs-)biographischen Vorerfahrungen der ankommenden Kinder, die diese Heterogenität ausmachen.
Fernab von schulkonzeptionellen Reaktionen auf das Phänomen des Seiteneinstieges kann die Frage nach der sozialisatorischen Bedeutung interkultureller Heterogenität im Schulalltag für Kinder und Jugendliche selbst, sowohl den Einzelnen als auch die Klassengemeinschaft betreffend, als Forschungsdesiderat bezeichnet werden. Während sich die Sozialisationsforschung seit den 70er Jahren verstärkt den Dynamiken und Potentialen der Gleichaltrigenbeziehungen in Schule und Unterricht widmet, Migrationshintergrund zwar eine vernachlässigte, aber dennoch berücksichtigte Kategorie ist, fehlen Einblicke in den schulischen Alltag sogenannter Seiteneinsteiger bislang weitestgehend.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- 1. Einleitung
- 2. Der Forschungsstand als Hinführung zum Erkenntnisinteresse
- 2.1 Schulhistorischer Einstieg
- 2.2 Sozialisationsforschung in der Schule
- 2.3 Kinder und Jugendliche als Akteure ihres interkulturellen Schulalltages
- 2.4 Wissenschaftliches und praktisches Erkenntnisinteresse
- 3. Methodologische Überlegungen und methodisches Vorgehen
- 3.1 Phänomenspezifische Herausforderungen und Erkenntnispotentiale ethnographischen Forschens
- 3.1.1 Das Forschen mit Kindern
- 3.1.2 Der fluktuationsbedingte Wandel räumlicher und sozialer Arrangements
- 3.1.3 Die soziale Bedeutsamkeit sprachlicher und kultureller Heterogenität
- 3.1.4 Die Nähe zwischen Gegenstand und Forschungsstrategie
- 3.1.5 Zusammenfassende Betrachtung
- 3.2 Das Forschungsfeld und sein Zugang
- 3.2.1 Die Intensivklasse von Frau Ring
- 3.2.2 Die Vorbekanntheit
- 3.2.3 Meine ersten Besuche
- 3.3 Datenerhebung und Datenanalyse
- 3.3.1 Die Beobachtende Teilnahme als Strategie der Datenerhebung
- 3.3.2 Die hermeneutische Analyse von Beobachtungsprotokollen
- 4. Ergebnisorientierte Falldarstellung
- 4.1 Die Vorstellungsrunde - Zur sozialisatorischen Bedeutung rotierender Teilnehmerschaften
- 4.2 Bewegungen im Klassenzimmer - Fluktuationsbedingter Wandel sozialer und räumlicher Arrangements
- 4.3 Übersetzungsgeschehen als sozialisatorische Praxis
- 4.4 Wenn aus Konflikten ,,Beschwerden\" werden - Grenzen der Selbstsozialisation?
- 4.5 Zusammenführung der Ergebnisse
- 5. Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Intensivklasse als sozialisatorischen Möglichkeitsraum. Sie widmet sich dem Wandel der Klassengemeinschaft in einer Intensivklasse für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche, die durch die hohe Fluktuation der Schüler geprägt ist.
- Die Bedeutung von rotierenden Teilnehmerschaften und deren Auswirkungen auf die soziale Interaktion in der Klasse.
- Der Einfluss der Fluktuation auf die räumliche Organisation und den Wandel sozialer Arrangements im Klassenzimmer.
- Übersetzungsgeschehen als sozialisatorische Praxis in der Klasse, die über den Sprachbereich hinaus Bedeutung erlangt.
- Die Grenzen der Selbstsozialisation im Kontext von Konflikten und deren Bearbeitung im Klassenzimmer.
- Die Rolle der Lehrkraft in der Gestaltung und Moderation des sozialisatorischen Prozesses in der Intensivklasse.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema der Masterarbeit ein und skizziert die Forschungsfrage. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der hohen Fluktuation in Intensivklassen für die Sozialisation der Schüler ergeben.
- Kapitel 2 beleuchtet den Forschungsstand und referiert zentrale Erkenntnisse aus der Schulgeschichte, der Sozialisationsforschung in der Schule und der Beschäftigung mit interkulturellem Schulalltag. Es werden die Grenzen des bisherigen Forschungsstandes aufgezeigt und die Notwendigkeit eines tieferen Blicks in die sozialisatorischen Prozesse in Intensivklassen betont.
- Kapitel 3 widmet sich den methodischen Überlegungen und dem methodischen Vorgehen. Es werden die spezifischen Herausforderungen der ethnographischen Forschung im Kontext von Intensivklassen, wie das Forschen mit Kindern, die Fluktuation und die sprachliche Heterogenität, beleuchtet und die gewählte Forschungsstrategie erläutert.
- Kapitel 4 präsentiert eine Ergebnisorientierte Falldarstellung. Es werden anhand verschiedener Beispiele die verschiedenen Facetten der Sozialisation in der Intensivklasse im Detail analysiert.
Schlüsselwörter
Intensivklasse, Sozialisation, Interkulturelle Heterogenität, Fluktuation, Klassengemeinschaft, Ethnographie, Beobachtende Teilnahme, Sprachmittlung, Konfliktlösung, Selbstsozialisation.
- Quote paper
- Ines Birkner (Author), 2019, Die Intensivklasse als sozialisatorischer Möglichkeitsraum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539566