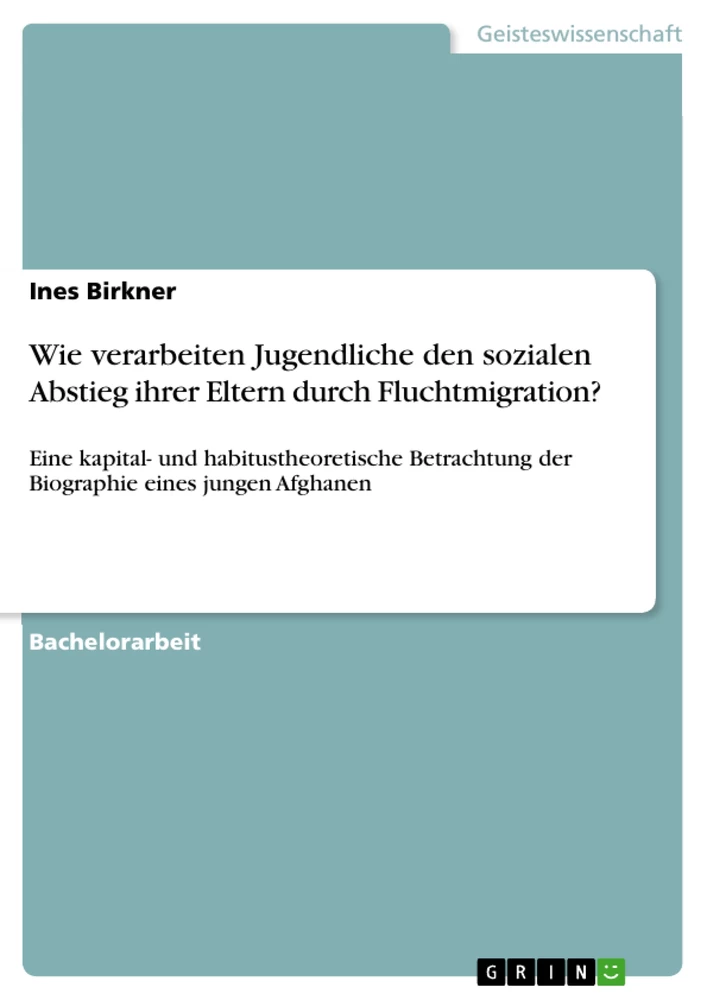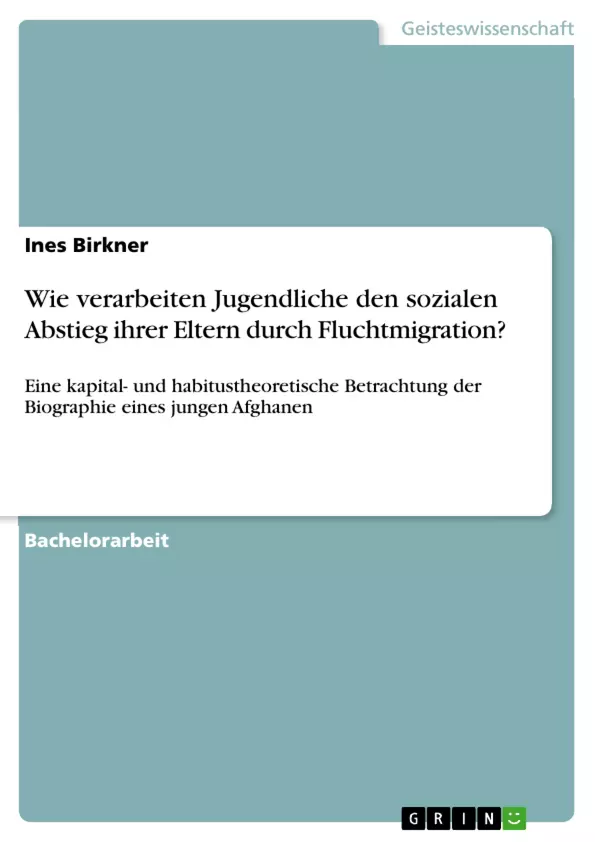Statistisch gesehen sind afghanische Flüchtlinge eine zahlenmäßig große Einwanderungsgruppe, mit der sich besonders auf politischer Ebene auseinandergesetzt wird. Parallel dazu lassen sich in der sozialwissenschaftlichen Forschungslandschaft nur wenige Studien verzeichnen, die sich mit der Lebenssituation der in Deutschland lebenden Afghanen im Allgemeinen und der zweiten Generation afghanischstämmiger MigrantInnen im Besonderen beschäftigen. Letztere steht im Fokus der vorliegenden Arbeit.
Ausgehend von den quantitativ gegeben Erkenntnissen zur Bedeutung der sozialen Position und dem Bildungsniveau der Eltern auf die schulische Entwicklung von Kindern bzw. Jugendlichen mit Migrationshintergrund, möchte ich hier eine qualitative Rekonstruktion der subjektiven Perspektive auf herkunftsspezifische Ressourcen - im Bourdieuschen Sinne als ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital bezeichnet - anbieten. Methodisch orientiere ich mich dabei am Konzept der biografischen Fallrekonstruktion.
In einem ersten Schritt widmet sich die Autorin dem hohen sozioökonomischen Status der Eltern im Herkunftsland und deren Bedeutung für die frühkindliche Sozialisation. Anschließend soll die Abstiegserfahrung der Elterngeneration als Ursache ihrer soziostrukturellen Entwurzelung thematisiert werden. In einem dritten Schritt wird dann der Versuch unternommen, die diesbezüglichen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsschemata der zweiten Generation theoretisch zu erfassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Vorüberlegungen mit Pierre Bourdieu
- 2.1 Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital
- 2.1.1 Kulturelles Kapital und sozialer Abstieg unter Migrationsbedingungen
- 2.1.2 Familie und intergenerationale Transmission von kulturellem Kapital
- 2.2 Biographie und Habitus
- 2.2.1 Sozialisation als Kapitalerwerb und Habitualisierung
- 2.2.2 Biographische Wendepunkte und Habitustransformation
- 2.3 Chancen und Grenzen des Bourdieuschen Konzeptes
- 3. Biographie als methodischer Zugang
- 3.1 Die biographische Perspektive in der qualitativen Migrationsforschung
- 3.2 Datenerhebung: Das biographisch-narrative Interview
- 3.3 Datenauswertung: Die biographische Fallrekonstruktion
- 4. Der Fall Araam Navid
- 4.1 Biographisches Portrait und Kontextualisierung
- 4.2 Ergebnisorientierte Fallanalyse
- 4.2.1 „das Leben in Afghanistan, uns ging es immer gut“
- 4.2.2 Die Flucht als biographischer Wendepunkt
- 4.2.3 Angekommen in Deutschland - „ein ziemlicher Absturz“
- 4.3 Zusammenfassung
- 5. Theoretische Diskussion der Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie Jugendliche mit Migrationshintergrund den sozialen Abstieg ihrer Eltern durch Fluchtmigration verarbeiten und wie sich diese Verarbeitung in der individuellen Biographie widerspiegelt. Die Arbeit analysiert die Lebensgeschichte eines jungen Afghanen im Kontext der kapital- und habitustheoretischen Ansätze von Pierre Bourdieu.
- Kulturelles Kapital und sozialer Abstieg im Migrationskontext
- Intergenerationale Transmission von kulturellem Kapital in der Familie
- Biographische Wendepunkte und Habitustransformation
- Die Bedeutung von Fluchtmigration für die Lebenswelt und Identität junger Migranten
- Die Rolle von Ressourcen und (human)kapital in der Migrationsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage, die Relevanz des Themas und die methodischen Grundlagen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die statistische Bedeutung afghanischer Flüchtlinge in Deutschland sowie die Forschungslücke bezüglich der Lebenssituation der zweiten Generation afghanischstämmiger Migranten. Darüber hinaus wird die Bedeutung des familiären Herkunftsmilieus im Kontext von Flucht und Migration im Hinblick auf die schulische Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund hervorgehoben.
- Kapitel 2: Theoretische Vorüberlegungen mit Pierre Bourdieu: Dieses Kapitel führt die zentralen Konzepte des ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals von Pierre Bourdieu ein. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle des kulturellen Kapitals im Kontext des sozialen Abstiegs unter Migrationsbedingungen sowie der intergenerationalen Transmission von kulturellem Kapital innerhalb der Familie gewidmet. Darüber hinaus werden die Begriffe Biographie und Habitus und ihre Verbindung im Zusammenhang mit der Sozialisation als Kapitalerwerb und Habitualisierung erläutert. Der Einfluss biographischer Wendepunkte auf den Habitus und seine Transformation wird ebenfalls thematisiert.
- Kapitel 3: Biographie als methodischer Zugang: Dieses Kapitel erläutert den biographischen Ansatz in der qualitativen Migrationsforschung und beschreibt die angewandte Methode des narrativen Interviews nach Schütz sowie die biographische Fallrekonstruktion nach Rosenthal. Der Fokus liegt auf der Nutzung des biographischen Materials als Zugang zu der individuellen Perspektive auf die Lebensgeschichte des Interviewten.
- Kapitel 4: Der Fall Araam Navid: Das Kapitel präsentiert die Biografie des Interviewten Araam Navid und seine Erfahrungen mit Fluchtmigration. Die Fallanalyse untersucht die biographischen Phasen des Lebens in Afghanistan, der Flucht und der Ankunft in Deutschland. Es wird analysiert, wie diese Wendepunkte Araams Leben beeinflusst haben und welchen Einfluss sie auf seine soziale Position und seine Entwicklung hatten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Fluchtmigration, soziale Mobilität, intergenerationale Transmission, kulturelles Kapital, Habitus, Biographie, biographische Fallrekonstruktion, qualitative Migrationsforschung und der Lebenssituation afghanischstämmiger Migranten in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie verarbeiten junge Migranten den sozialen Abstieg ihrer Eltern?
Die Arbeit zeigt durch biografische Fallrekonstruktionen, dass Jugendliche den „Absturz“ ihrer Eltern oft als Wendepunkt erleben, der ihre eigene Identität und Zukunftsplanung stark beeinflusst.
Was versteht Pierre Bourdieu unter „kulturellem Kapital“?
Kulturelles Kapital umfasst Bildung, Wissen und kulturelle Ressourcen, die innerhalb der Familie weitergegeben werden und den Erfolg in der Schule maßgeblich bestimmen.
Was bedeutet „intergenerationale Transmission“?
Es bezeichnet die Übertragung von Werten, Status und Ressourcen (Kapital) von einer Generation (Eltern) auf die nächste (Kinder).
Was ist eine „biografische Fallrekonstruktion“?
Es ist eine qualitative Forschungsmethode, bei der Lebensgeschichten (z. B. durch narrative Interviews) analysiert werden, um subjektive Erfahrungen und Verarbeitungsmuster zu verstehen.
Wie wirkt sich Fluchtmigration auf den „Habitus“ aus?
Flucht und sozialer Abstieg können zu einer „Habitustransformation“ führen, bei der die im Herkunftsland erlernten Verhaltensweisen und Erwartungen an die neue, oft prekäre Realität angepasst werden müssen.
- Quote paper
- Ines Birkner (Author), 2014, Wie verarbeiten Jugendliche den sozialen Abstieg ihrer Eltern durch Fluchtmigration?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539567