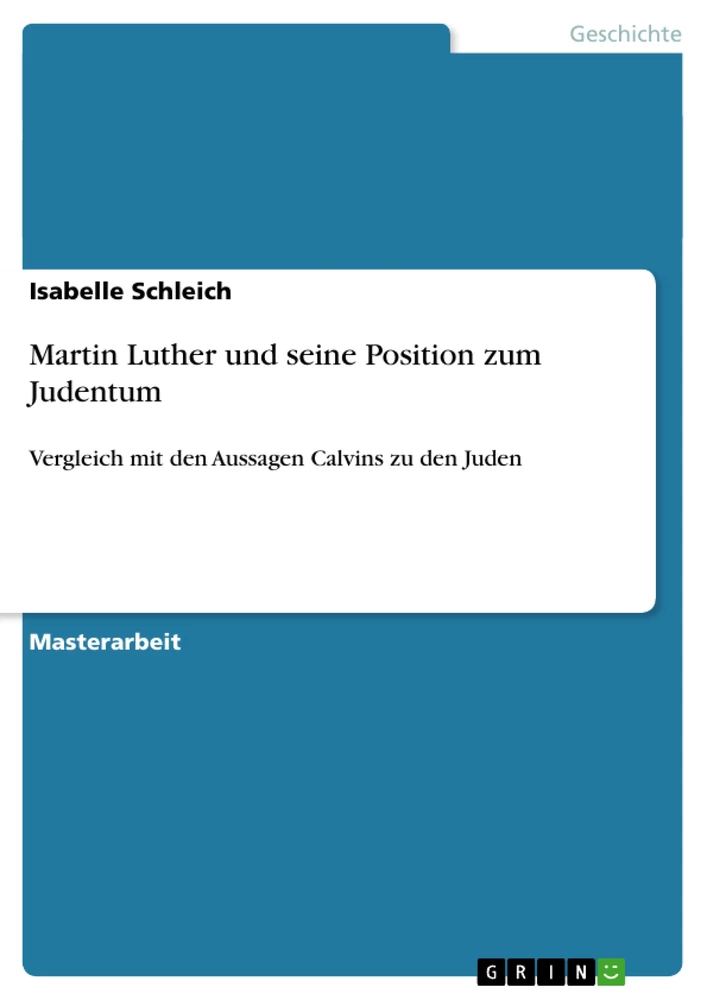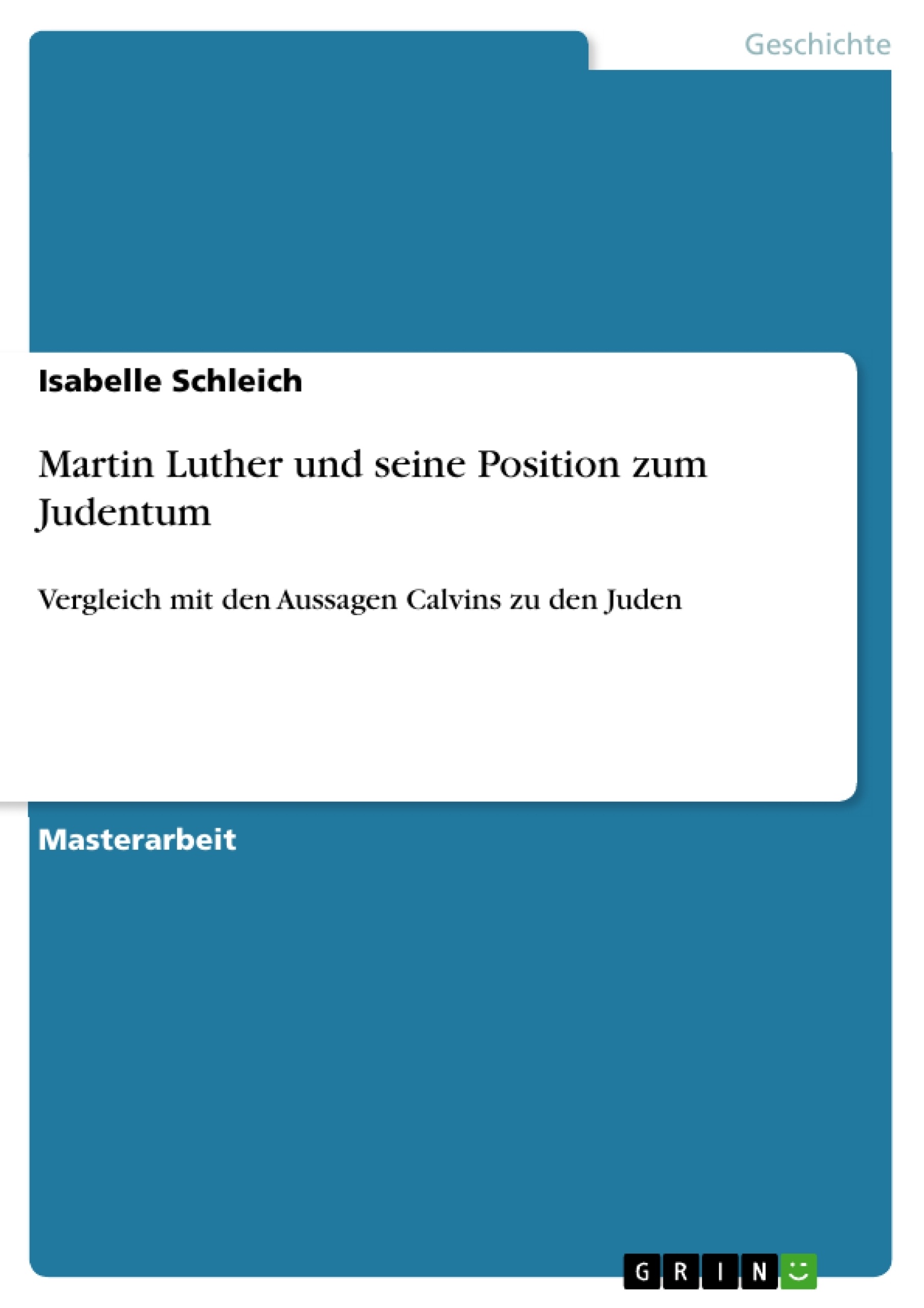Durch alle Zeiten hinweg haben Christen die Juden aufgrund unbegründeter, aus Unwissenheit und Ignoranz entstandenen Vorurteilen unterdrückt und ausgebeutet. Die Relation zwischen Christen und Juden war immer schon durch Feindseligkeit und Misstrauen geprägt. Die Schoah bildete, getrieben von einem erbarmungslosen Antisemitismus, den grausamen Höhepunkt dieser schmerzlichen Geschichte.
Dieser Antisemitismus erscheint jedoch nicht einfach aus der Luft gegriffen. Es stellt sich die Frage, inwieweit dieser Antisemitismus durch den viele Jahrhunderte andauernden christlichen Antijudaismus genährt wurde.
Bei der Analyse von Luthers Antijudaismus fällt auf, dass er in seinen frühen Judenschriften einen freundlicheren Ton gegenüber den Juden vertritt, als in den Schriften gegen Ende seines Lebens. Wieso kam es zu diesem Bruch in seiner Auffassung zu den Juden? Oder unterlag Luthers Vorstellung von den Juden am Ende gar keinem Wandel, sondern war geprägt durch eine kontinuierlich antijüdische Haltung?
Desweiteren versucht diese Arbeit eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Vorwürfe Luther den Juden macht, welche Vorurteile er gegen sie hegt, worauf sie basieren, wie er sie begründet und gegen die Juden argumentiert. Zu diesem Zweck werden, nach einer historischen Einführung in den mittelalterlichen Antijudaismus, in welchem die Vorurteile Luthers größtenteils fußen, zwei der bedeutendsten Judenschriften Luthers, nämlich Dass Jesus Christus ein geborner Jude sei (1523) und Von den Juden und ihren Lügen (1543), genauer analysiert.
Eine weitere wichtige Fragestellung dieser Arbeit liegt im Vergleich zwischen Calvin und Luther. Welche Ursachen haben Luther dazu veranlasst so viele Judenschriften zu verfassen und aus welchen Gründen hat Calvin nur so wenig zu diesem Thema geschrieben? Wo liegen die Differenzen zwischen diesen beiden Reformatoren? Wäre es möglich, dass der Genfer Reformator sich nur deshalb so wenig zum Judentum geäußert hat, weil er aufgrund seiner Lebensumstände keinen Anlass dazu sah sich mit dieser Thematik zu beschäftigen?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Allgemeine Einführung
- 2. Fragestellung und Aufbau
- 3. Forschungsüberblick
- II. Antijudaismus im Mittelalter
- 1. Die Situation der Juden im Mittelalter
- 2. Die Sicut-Judeis-Bullen
- 3. Das vierte Laterankonzil
- 4. Antijudaismus - Antisemitismus
- III. Luther und die Juden
- 1. Grundzüge und Entwicklung von Luthers Antijudaismus (1513-1546)
- 2. Die Römerbriefvorlesung (1515-1516)
- 3. Dass Jesus Christus ein geborner Jude sei (1523)
- 4. Von den Juden und ihren Lügen (1543)
- 5. Bruch oder Kontinuität?
- 6. Rezeption von Luthers Judenschriften
- IV. Calvin und die Juden
- 1. Antijudaismus bei Calvin in der bisherigen Forschung
- 2. Begegnungen Calvins mit Juden
- 3. Die Juden in Calvins Kommentar zum Brief des Apostels Paulus an die Römer
- a. Der Römerbrief
- b. Die Prädestinationslehre
- c. Die Juden in Calvins Prädestinationslehre
- 4. Calvins Abhandlung: Ad quaestiones et obiecta Iudaei cuiusdam
- a. Vorlagen und Datierung
- b. Aufbau und Fragestellung
- V. Vergleich zwischen Luther und Calvin
- 1. Der Kontakt mit Juden
- 2. Die Judenschriften
- a. Die Anzahl der Judenschriften
- b. Rezeption
- c. Anrede und Argumentation
- d. Vorwürfe gegen die Juden
- 3. Der Römerbrief
- 4. Die Prädestinationslehre
- VI. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht und vergleicht die Positionen Martin Luthers und Johannes Calvins zum Judentum. Die Arbeit zielt darauf ab, die jeweiligen antijüdischen Haltungen der beiden Reformatoren zu analysieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und dem Ausdruck des Antijudaismus in ihren Schriften und deren Rezeption.
- Entwicklung des Antijudaismus bei Luther und Calvin
- Vergleich der antijüdischen Argumentationsmuster
- Rezeption der Judenschriften Luthers und Calvins
- Der Einfluss der jeweiligen theologischen Systeme (z.B. Prädestinationslehre bei Calvin)
- Der Kontext des mittelalterlichen Antijudaismus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die Fragestellung der Arbeit (Vergleich der Positionen Luthers und Calvins zum Judentum) und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie verortet die Arbeit im Kontext der Auseinandersetzung mit dem christlichen Antijudaismus und dessen Folgen, verweist auf die Bedeutung von Nostra Aetate und hebt die Kontroverse um Luthers Ansichten hervor. Der Vergleich mit Calvins Position wird als zentraler Punkt der Untersuchung präsentiert.
II. Antijudaismus im Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext, in dem die Schriften Luthers und Calvins entstanden sind. Es beschreibt die Situation der Juden im Mittelalter, die Rolle von päpstlichen Bullen wie den Sicut-Judeis-Bullen und die Bedeutung des vierten Laterankonzils. Der Unterschied zwischen Antijudaismus und Antisemitismus wird definiert und analysiert, um die Grundlage für die folgenden Kapitel zu schaffen. Das Kapitel untersucht die historischen und gesellschaftlichen Faktoren, welche die Einstellungen zum Judentum im Mittelalter prägten und somit das Fundament für die späteren Ansichten der Reformatoren bildeten.
III. Luther und die Juden: Dieses Kapitel analysiert Luthers Schriften zum Judentum, beginnend mit den frühen Ansätzen bis hin zu seinen späten, deutlich antijüdischeren Werken wie "Von den Juden und ihren Lügen". Es untersucht die Entwicklung seiner Position und die zentralen Argumente seiner Kritik. Die Rezeption seiner Schriften wird ebenfalls betrachtet, um den nachhaltigen Einfluss seiner Worte zu beleuchten. Das Kapitel differenziert zwischen den verschiedenen Phasen von Luthers Denken und setzt sie in den Kontext seiner theologischen Entwicklung und seiner politischen Umfeld.
IV. Calvin und die Juden: Im Gegensatz zu Luther, dessen antijüdische Schriften umfangreich sind, ist Calvins Position zum Judentum deutlich weniger explizit. Dieses Kapitel untersucht die spärlichen Quellen, darunter sein Kommentar zum Römerbrief und die Abhandlung "Ad quaestiones et obiecta Iudaei cuiusdam". Es beleuchtet Calvins Auseinandersetzung mit jüdischen Fragen im Kontext seiner Theologie, insbesondere seiner Prädestinationslehre, und untersucht den Grad seiner antijüdischen Haltung im Vergleich zur Forschung.
V. Vergleich zwischen Luther und Calvin: Dieses Kapitel vergleicht die Positionen Luthers und Calvins systematisch. Es analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf den Kontakt zu Juden, die Anzahl und Rezeption ihrer Schriften, deren Argumentationsmuster und die Vorwürfe gegen die Juden. Der Vergleich umfasst auch die Interpretation des Römerbriefs und den Einfluss der Prädestinationslehre auf Calvins Position. Das Kapitel stellt die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel gegenüber und identifiziert sowohl konvergierende als auch divergierende Aspekte der beiden reformatorischen Ansätze.
Schlüsselwörter
Martin Luther, Johannes Calvin, Antijudaismus, Antisemitismus, Judentum, Reformation, Römerbrief, Prädestinationslehre, Mittelalter, Theologie, Judenschriften, Rezeption, religiöse Toleranz, Vergleichende Religionswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleichende Analyse des Antijudaismus bei Luther und Calvin
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit analysiert und vergleicht die Positionen Martin Luthers und Johannes Calvins zum Judentum. Im Fokus steht die Untersuchung ihrer antijüdischen Haltungen, die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie die Rezeption ihrer Schriften.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Antijudaismus bei Luther und Calvin, vergleicht ihre antijüdischen Argumentationsmuster, analysiert die Rezeption ihrer Schriften, beleuchtet den Einfluss ihrer theologischen Systeme (insbesondere Calvins Prädestinationslehre) und betrachtet den Kontext des mittelalterlichen Antijudaismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Antijudaismus im Mittelalter, Luther und die Juden, Calvin und die Juden, Vergleich zwischen Luther und Calvin und Schlussfolgerung. Die Einleitung beschreibt die Fragestellung und den Aufbau. Kapitel II beleuchtet den historischen Kontext. Kapitel III und IV analysieren Luthers und Calvins Positionen. Kapitel V vergleicht beide. Kapitel VI fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Schriften Luthers und Calvins, insbesondere Luthers Judenschriften und Calvins Kommentar zum Römerbrief sowie seine Abhandlung "Ad quaestiones et obiecta Iudaei cuiusdam". Sie berücksichtigt auch die einschlägige Sekundärliteratur zur Erforschung des christlichen Antijudaismus.
Wie wird der Antijudaismus im Mittelalter dargestellt?
Kapitel II beschreibt die Situation der Juden im Mittelalter, die Rolle der Sicut-Judeis-Bullen, das vierte Laterankonzil und den Unterschied zwischen Antijudaismus und Antisemitismus. Es analysiert die historischen und gesellschaftlichen Faktoren, die die Einstellungen zum Judentum prägten.
Wie wird Luthers Position zum Judentum analysiert?
Kapitel III analysiert Luthers Schriften zum Judentum von seinen frühen Ansätzen bis zu "Von den Juden und ihren Lügen". Es untersucht die Entwicklung seiner Position, seine zentralen Argumente und die Rezeption seiner Schriften.
Wie wird Calvins Position zum Judentum analysiert?
Kapitel IV untersucht Calvins weniger explizite Position, basierend auf seinem Kommentar zum Römerbrief und der Abhandlung "Ad quaestiones et obiecta Iudaei cuiusdam". Es beleuchtet seine Auseinandersetzung mit jüdischen Fragen im Kontext seiner Theologie, insbesondere seiner Prädestinationslehre.
Wie werden Luther und Calvin verglichen?
Kapitel V vergleicht systematisch die Positionen Luthers und Calvins hinsichtlich ihres Kontakts zu Juden, der Anzahl und Rezeption ihrer Schriften, der Argumentationsmuster, der Vorwürfe gegen die Juden, der Interpretation des Römerbriefs und des Einflusses der Prädestinationslehre.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Martin Luther, Johannes Calvin, Antijudaismus, Antisemitismus, Judentum, Reformation, Römerbrief, Prädestinationslehre, Mittelalter, Theologie, Judenschriften, Rezeption, religiöse Toleranz, Vergleichende Religionswissenschaft.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die konkrete Schlussfolgerung ist nicht im gegebenen Text-Snippet enthalten und würde im vollständigen Dokument präsentiert werden.)
- Quote paper
- Isabelle Schleich (Author), 2010, Martin Luther und seine Position zum Judentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265947