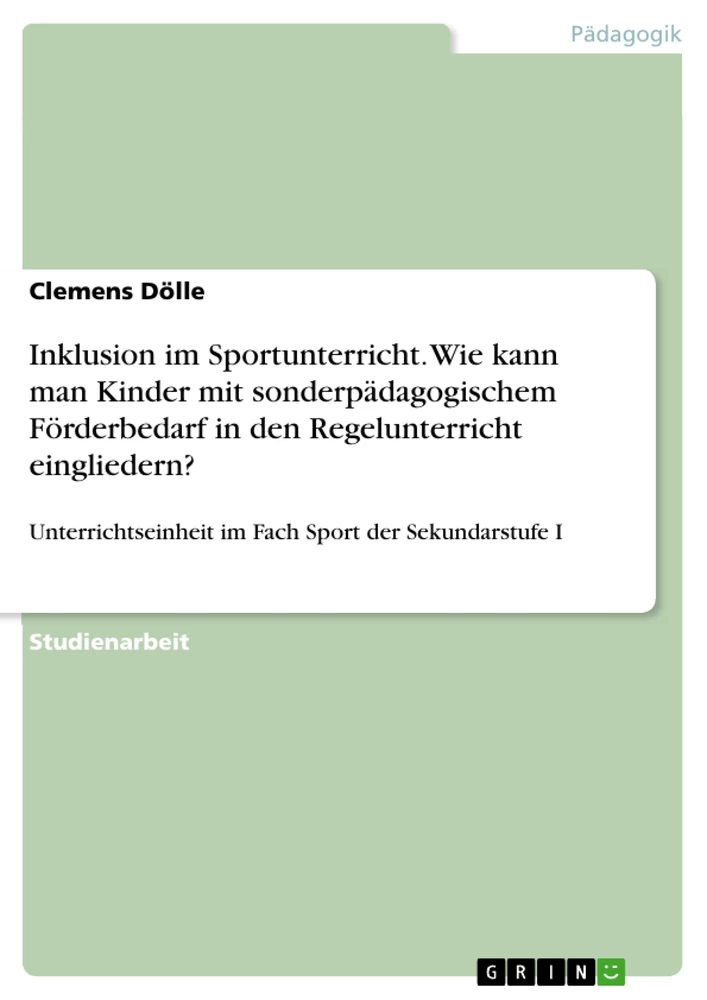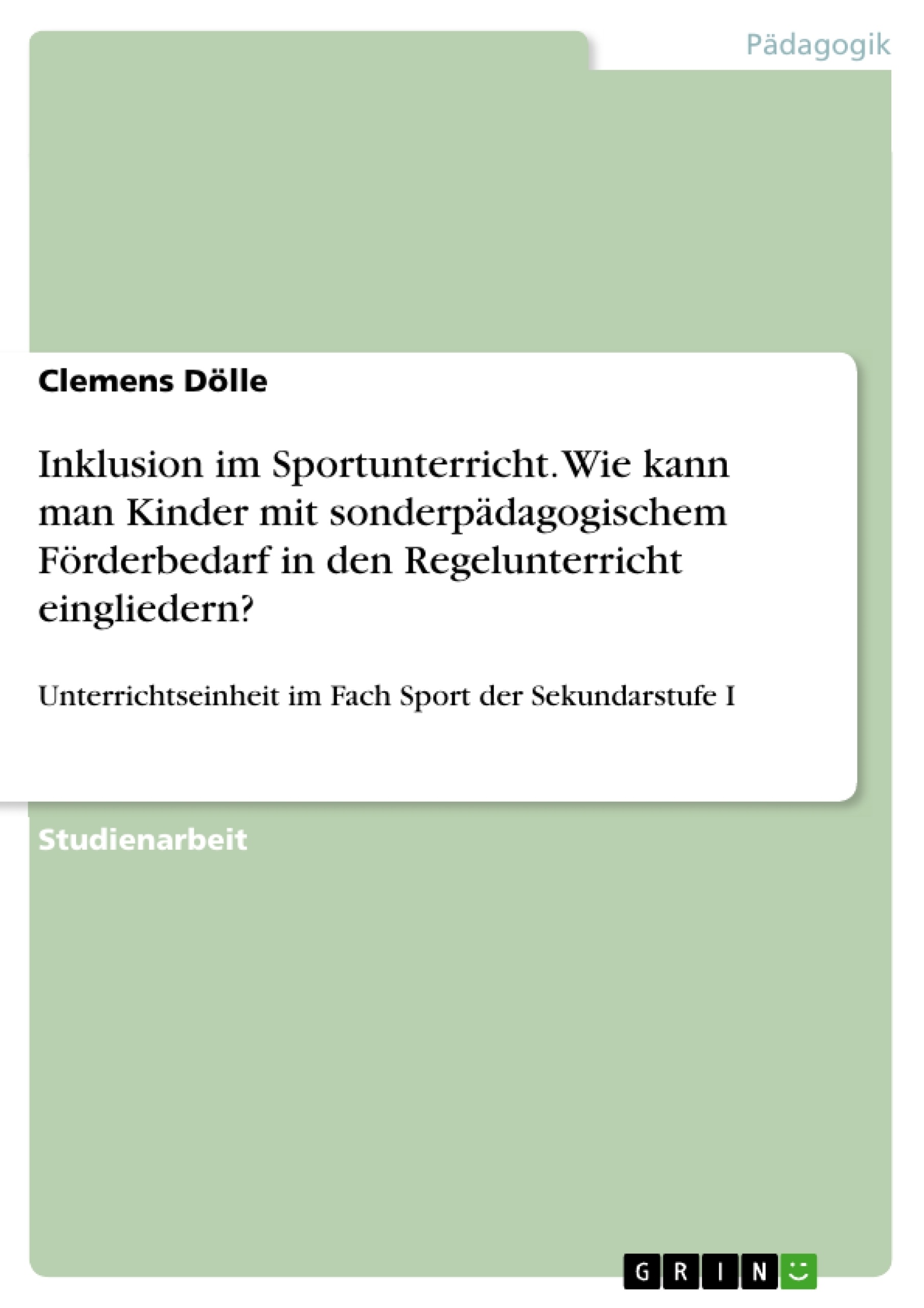Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Inklusion. Hierfür wird die Rechtslage in Deutschland thematisiert und erörtert, wie Inklusion im Sportunterricht der Sekundarstufe I umsetzbar ist.
Das Thema Inklusion wird immer aktueller. Unsere heutige Gesellschaft wird von Idealen und Vorbildern geprägt. Jede Person aus dieser Gesellschaft versucht sich nach bestimmten Normen und Werten zu richten, um dazuzugehören und nicht ausgegrenzt beziehungsweise ausgeschlossen zu werden. Betrachtet man jedoch jedes Mitglied dieser Gesellschaft einzeln, so stellt man schnell Unterschiede fest. Lange galten Menschen mit Behinderungen als krank, sie wurden in Sonderschulen gesteckt und durch die damit verbundene Institutionalisierung isoliert.
Jedoch genau diese verschiedenen Individuen und deren Eigenschaften machen eine Gesellschaft aus. Durch die Vorteile und Stärken jedes einzelnen entwickeln wir uns als Gesellschaft weiter und können jene Vorteile und Stärken nutzen. Als Barriere steht jedoch zunächst das Erkennen und Akzeptieren der Unterschiedlichkeit im Weg und muss durch eine bessere Auseinandersetzung mit dem Thema aufgebrochen werden. Daraus folgt, dass Toleranz und Akzeptanz, sowie Offenheit für etwas Neues oder gar etwas "anderes", die Grundvoraussetzung für eine sich weiterentwickelnde und interaktive Gesellschaft sind. Somit muss eine gleichberechtigte Teilhabe aller Mitglieder in einer Gesellschaft die grundlegende Bedingung sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen und Begrifflichkeiten
- Behinderung
- Soziales Modell von Behinderung
- Inklusion in Deutschland
- Inklusion im Sportunterricht
- Möglichkeiten der Umsetzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der Inklusion im Sportunterricht der Sekundarstufe I. Sie analysiert, wie Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Regelunterricht integriert werden können. Die Arbeit untersucht dabei die Definition von Inklusion und Behinderung, beleuchtet die rechtliche Situation in Deutschland und erörtert konkrete Umsetzungsansätze im Sportunterricht.
- Definitionen und Begrifflichkeiten von Inklusion und Behinderung
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Inklusion in Deutschland
- Herausforderungen und Möglichkeiten der Inklusion im Sportunterricht
- Praktische Beispiele für die Umsetzung von Inklusion im Sportunterricht
- Diskussion der Bedeutung von Inklusion für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Inklusion in unserer heutigen Gesellschaft dar und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration von Menschen mit Behinderung verbunden sind. Sie zeigt auf, wie Inklusion als ein zentrales Thema in der öffentlichen Debatte und in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, wie beispielsweise im Bildungssystem und im Sport, diskutiert wird. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor.
2. Definitionen und Begrifflichkeiten
Dieses Kapitel erläutert den Begriff „Behinderung“ und seine verschiedenen Definitionen. Es wird auf die medizinischen, sozialen und rechtlichen Aspekte von Behinderung eingegangen. Das Kapitel beleuchtet auch das „Soziale Modell von Behinderung“ und diskutiert die Kritik am traditionellen medizinischen Modell. Es zeigt auf, wie Behinderung nicht nur als ein medizinisches Problem, sondern auch als ein gesellschaftliches Konstrukt verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die wichtigsten Schlüsselbegriffe und Themen im Kontext von Inklusion im Sportunterricht. Hierzu zählen insbesondere Inklusion, Behinderung, Integration, Sportunterricht, Sekundarstufe I, sonderpädagogischer Förderbedarf, barrierefreie Gestaltung und Teilhabe. Die Arbeit analysiert die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Forschungsansätze im Bereich der Inklusion im Sportunterricht, um ein umfassendes Verständnis des Themas zu ermöglichen.
- Quote paper
- Clemens Dölle (Author), 2016, Inklusion im Sportunterricht. Wie kann man Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Regelunterricht eingliedern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539616