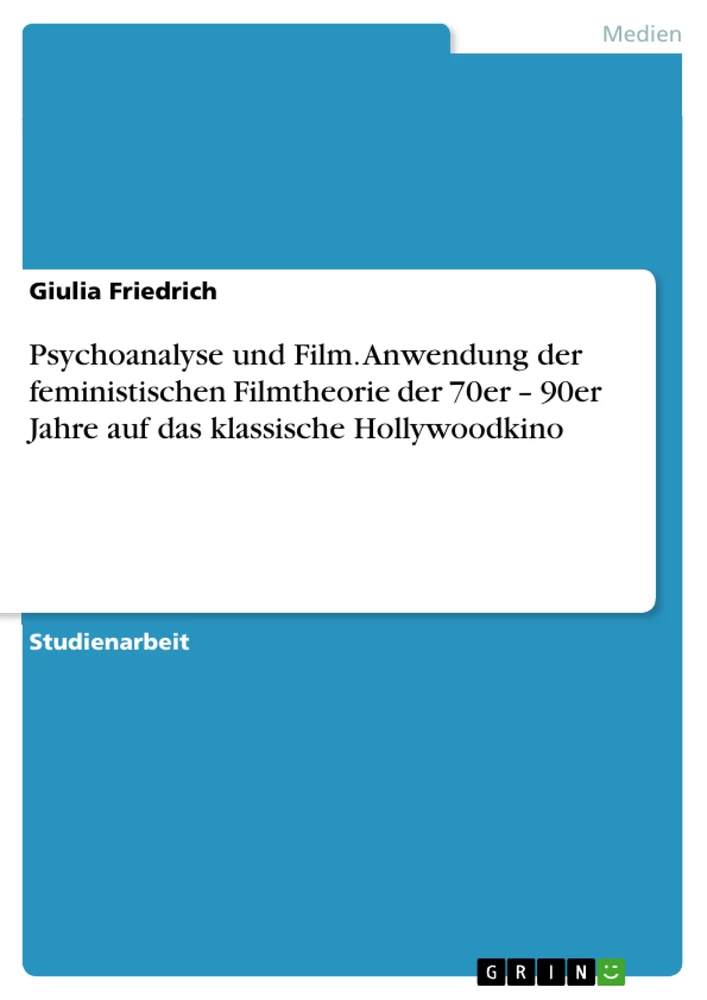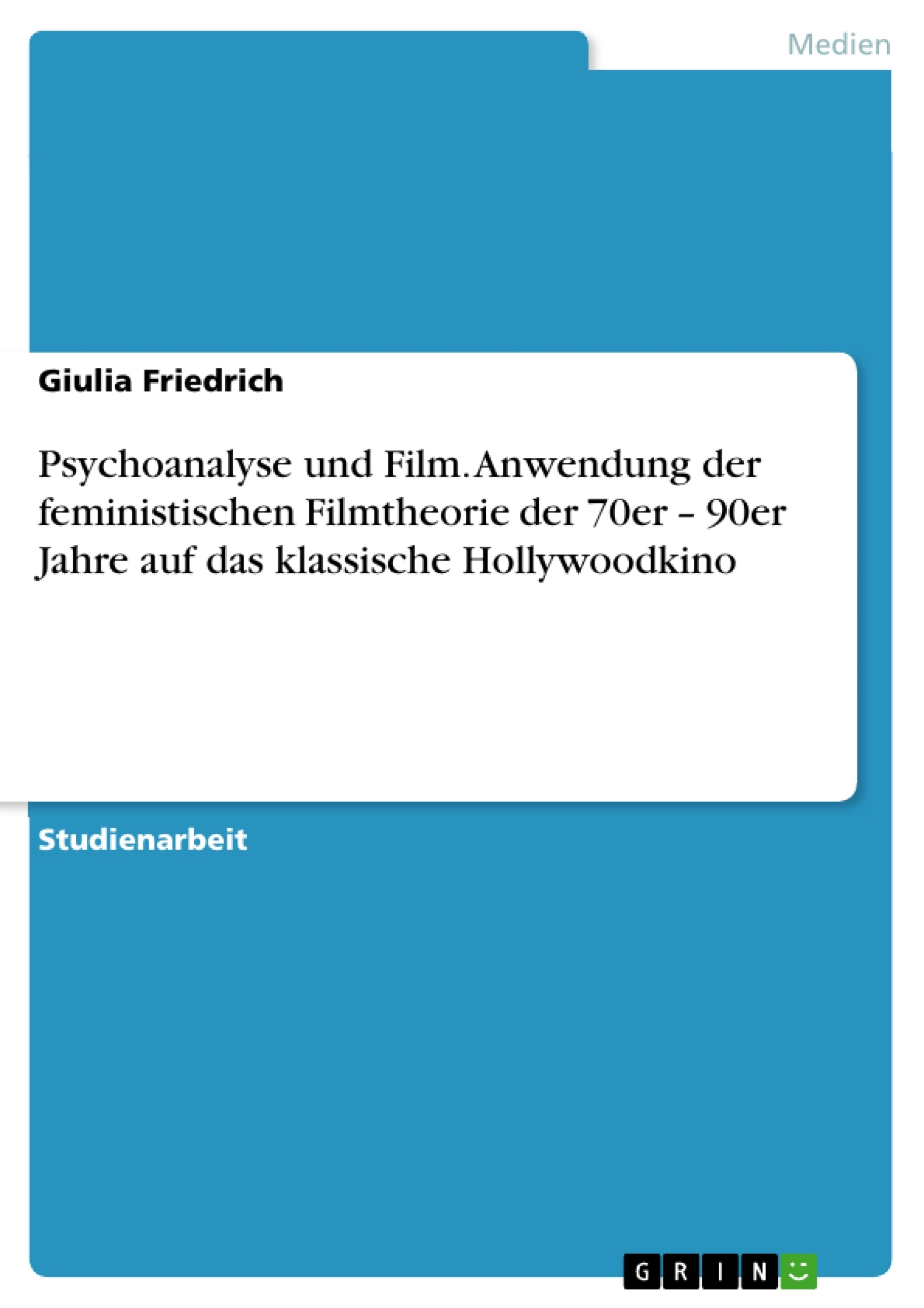Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Fragen: Inwiefern variieren die Figuren- und Zuschauermodelle der feministischen Filmtheorie im Zeitraum der 70er-90er Jahre je nach Geschlecht? Gibt es stereotypische Charakteristika, die den männlichen und weiblichen Figuren im Hollywoodfilm inhärent sind, existieren immer wiederkehrende Muster in der Narration und ist es überhaupt möglich pauschale, allgemeingültige Aussagen darüber zu treffen? Welche psychoanalytischen Methoden und Konzepte werden herangezogen, um die Dynamik zwischen ZuschauerIn und Film zu beschreiben?
In der feministischen Filmtheorie der 70er – 90er Jahre wird das Kino als gesellschaftliche Institution untersucht und besondere Aufmerksamkeit auf seine geschlechtsspezifischen Repräsentationsmethoden sowie Rezeptionsbedingungen gelegt. Hierbei nimmt der poststrukturalistisch-analytische Ansatz aus dem Gebiet der Psychoanalyse, mit starkem Bezug zu Lacan und Freud, eine fundamentale Position ein. Sehr deutlich wird die Anwendung psychoanalytischer Theorien als Instrument zur Beschreibung der Relation von Film und Gesellschaft und ihre gegenseitige Beeinflussung, aus feministischer Perspektive, am 1975 erschienenen Aufsatz "Visuelle Lust und narratives Kino" von Laura Mulvey, der einen Paradigmenwechsel in der Auseinandersetzung mit Gender und Kino herbeiführte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Narrative Ebene
- a. Weibliche Rollen im Film
- b. Männliche Rollen im Film
- III. Die Zuschauer
- a. Der weibliche Zuschauer
- i. Beziehung Zuschauerin und Filmkörper
- b. Der männliche Zuschauer
- a. Der weibliche Zuschauer
- IV. Problematische Ansätze in der feministischen Filmtheorie
- V. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der psychoanalytischen Herangehensweise der feministischen Filmtheorie der 70er-90er Jahre in der geschlechtsspezifischen Untersuchung von Figuren und ZuschauerInnen im klassischen Hollywoodfilm. Es wird untersucht, inwiefern die Figuren- und Zuschauermodelle der feministischen Filmtheorie in diesem Zeitraum je nach Geschlecht variieren, wobei der Fokus auf die weibliche Zuschauerin gelegt wird.
- Stereotypische Charakteristika von männlichen und weiblichen Figuren im Hollywoodfilm
- Wiederkehrende Muster in der Narration
- Psychoanalytische Methoden und Konzepte zur Beschreibung der Dynamik zwischen ZuschauerIn und Film
- Problematische Ansätze im feministisch-theoretischen Diskurs innerhalb der Filmtheorie
- Mögliche Strukturen und Konventionen im klassischen Hollywoodfilm
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Gegenstand der Arbeit vor: die psychoanalytisch geprägte Herangehensweise der feministischen Filmtheorie der 70er-90er Jahre bei der geschlechtsspezifischen Untersuchung der Figuren und der ZuschauerInnen im klassischen Hollywoodfilm. Die Fragestellung der Arbeit lautet, inwiefern die Figuren- und Zuschauermodelle der feministischen Filmtheorie in diesem Zeitraum je nach Geschlecht variieren.
Kapitel II befasst sich mit der narrativen Ebene des klassischen Hollywoodfilms, insbesondere mit weiblichen und männlichen Rollen. Es wird untersucht, ob stereotypische Charakteristika den Figuren inhärent sind und ob wiederkehrende Muster in der Narration existieren. In diesem Zusammenhang wird auch die Kastrationsbedrohung thematisiert, die weiblichen Figuren immanent ist, und das Phänomen der „Frau mit Brille“ analysiert.
Kapitel III behandelt die Rolle des Zuschauers, insbesondere die des weiblichen Zuschauers. Die Beziehung zwischen der Zuschauerin und dem Filmkörper wird beleuchtet.
Kapitel IV geht auf problematische Ansätze im feministisch-theoretischen Diskurs innerhalb der Filmtheorie ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Schlüsselbegriffen wie Psychoanalyse, feministische Filmtheorie, klassisches Hollywoodkino, Geschlechterrollen, Zuschauerposition, Voyeurismus, Kastrationsbedrohung, Phallussymbol, Narrative Ebene, Figurenmodelle und Filmsprache.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Schwerpunkt der feministischen Filmtheorie in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das klassische Hollywoodkino der 70er bis 90er Jahre unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Repräsentationsmethoden und psychoanalytischer Konzepte.
Welche Rolle spielt die Psychoanalyse in der Filmtheorie?
Konzepte von Freud und Lacan werden genutzt, um die Dynamik zwischen Film und ZuschauerIn zu beschreiben, insbesondere in Bezug auf Lust und Identifikation.
Wer ist Laura Mulvey und warum ist sie wichtig?
Mulveys Aufsatz "Visuelle Lust und narratives Kino" (1975) wird als Paradigmenwechsel behandelt, der die Diskussion über "Gender und Kino" maßgeblich prägte.
Gibt es stereotype Muster für männliche und weibliche Figuren?
Ja, die Arbeit analysiert wiederkehrende Muster in der Narration und fragt nach inhärenten Charakteristika, die den Rollen im Hollywoodfilm zugeschrieben werden.
Was wird über die Position der weiblichen Zuschauerin gesagt?
Es wird untersucht, wie die Beziehung zwischen der Zuschauerin und dem "Filmkörper" gestaltet ist und welche Rezeptionsbedingungen für Frauen im Kino herrschen.
Was sind problematische Ansätze im feministisch-theoretischen Diskurs?
Ein Kapitel der Arbeit widmet sich der kritischen Hinterfragung bestehender Theorien und analysiert deren Grenzen bei der Beschreibung der filmischen Realität.
- Arbeit zitieren
- Giulia Friedrich (Autor:in), 2016, Psychoanalyse und Film. Anwendung der feministischen Filmtheorie der 70er – 90er Jahre auf das klassische Hollywoodkino, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540348