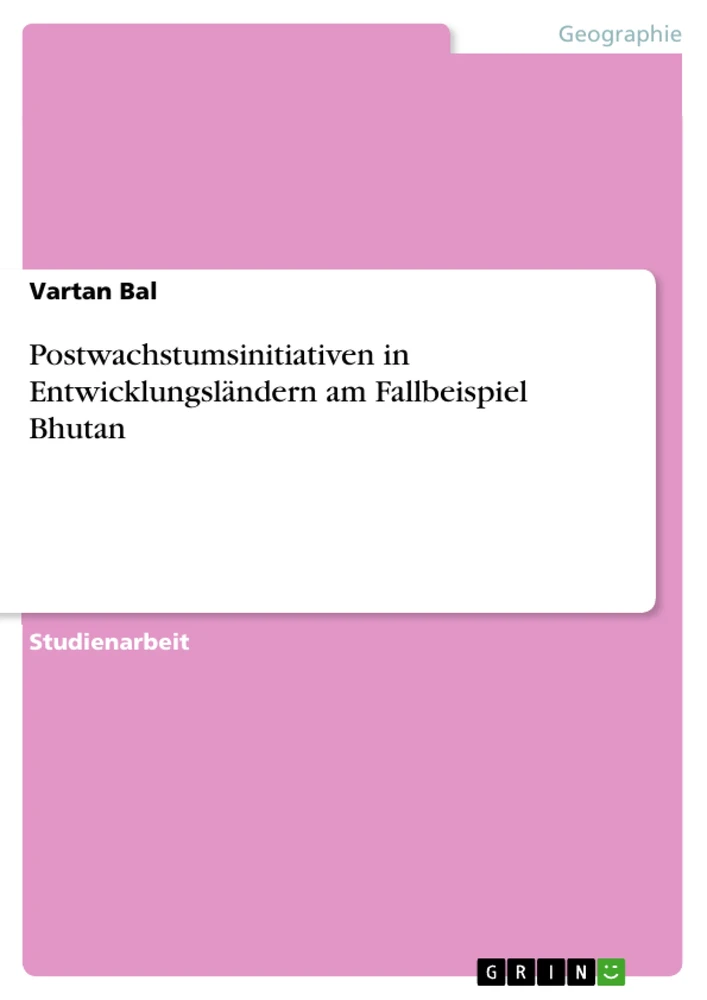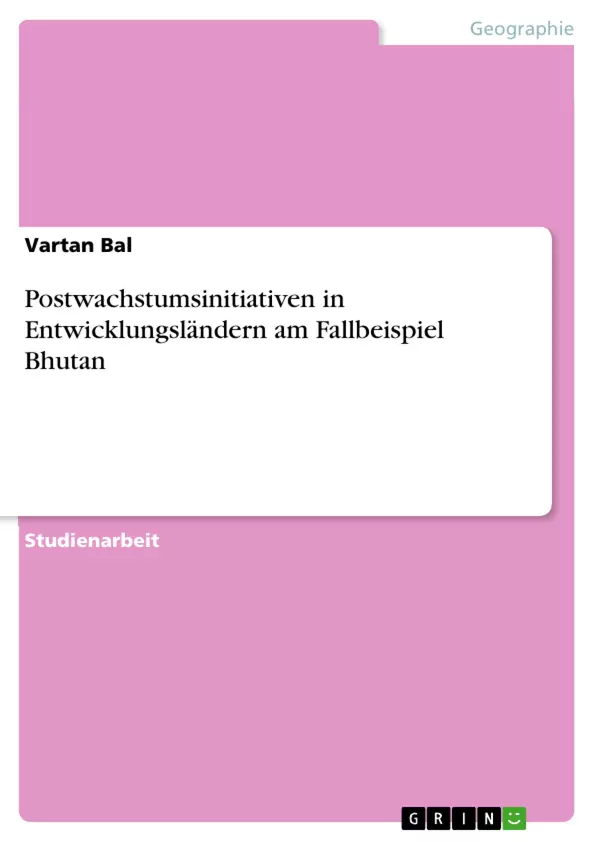Inwiefern schaffen Postwachstumsansätze eine nachhaltige Wirtschaft? Mithilfe der bestehenden Literatur wird ein tieferes Verständnis für die Relevanz und der Weite des Postwachstumsgedanken vermittelt. Auf Grundlage dieser Forschungsfrage ist es zunächst erforderlich, die Faktoren, die eine nachhaltige Wirtschaft beeinflussen, zu erläutern und daraufhin in Relation mit den aus dem Postwachstum resultierenden Einflüssen zu setzen. Dies bezüglich wird, als empirisches Fallbeispiel die bhutanische Ökonomie herangezogen, da es verdeutlicht, dass die Implementation von Postwachstumsansätzen, trotz komplexer historischer und ökonomischer Gegebenheiten, positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben kann.
Der Aufbau dieser Seminararbeit lässt sich in vier Abschnitte einteilen. Nach der Einleitung führt der Grundlagenteil in das Gebiet des Postwachstums ein und befasst sich mit den dazu wesentlichen Aspekten der Wachstumskritik. Dabei wird unter anderem auf die zu separierenden Bestandteile Postwachstum und de-growth eingegangen. In Anknüpfung an die zuvor dargestellten Konzepte thematisiert der Hauptteil die detaillierte Bearbeitung der Fragestellung in Anbetracht des empirischen Fallbeispiels. Der letzte Abschnitt besteht aus der Beantwortung der Forschungsfrage und einem darauf aufbauenden Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept des Postwachstums
- Kritik am Wachstumsparadigma
- Postwachstum
- agrowth, steady-state economy, de-growth and post-developments
- Green growth und die vorsorgeorientierte Postwachstumsgesellschaft
- Zukünftige Herausforderungen
- Postwachstumsinitiativen in Entwicklungsländern
- Fallbeispiel Bhutan
- Historischer Hintergrund und Fakten
- GNH-Indikator als Alternative zum BIP
- Postwachstumsansätze in Bhutan
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Konzept des Postwachstums und seiner Relevanz für eine nachhaltige Wirtschaft. Die Arbeit analysiert die Kritik am Wachstumsparadigma und stellt Postwachstumsansätze als Alternative für Entwicklungsländer vor. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung des Fallbeispiels Bhutan, welches zeigt, wie die Implementierung von Postwachstumsansätzen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben kann.
- Kritik am Wachstumsparadigma
- Postwachstumsansätze
- Nachhaltige Entwicklung
- Fallbeispiel Bhutan
- GNH-Indikator als Alternative zum BIP
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Postwachstum ein und präsentiert die Forschungsfrage: „Inwiefern schaffen Postwachstumsansätze eine nachhaltige Wirtschaft? Postwachstum als Alternative für Entwicklungsländer am Fallbeispiel Bhutan”.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Konzept des Postwachstums und seiner Kritik am Wachstumsparadigma. Es werden die unterschiedlichen Konzepte von Postwachstum, de-growth, steady-state economy und green growth erläutert und ihre Relevanz für eine nachhaltige Zukunft diskutiert.
Kapitel 3 analysiert das Fallbeispiel Bhutan und zeigt auf, wie die Integration von Postwachstumsansätzen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Es wird der GNH-Indikator als Alternative zum BIP vorgestellt und die historischen und ökonomischen Gegebenheiten Bhutans beleuchtet.
Schlüsselwörter
Postwachstum, Wachstumskritik, Nachhaltigkeit, Entwicklung, Bhutan, GNH-Indikator, BIP, steady-state economy, de-growth, green growth, Umwelt, soziale Ungleichheit, Lebensqualität, Wirtschaftswachstum.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Postwachstum"?
Postwachstum (oder Degrowth) ist ein Konzept, das die Abhängigkeit der Wirtschaft vom stetigen BIP-Wachstum kritisiert und stattdessen ökologische Nachhaltigkeit und Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt.
Was ist der GNH-Indikator in Bhutan?
GNH steht für "Gross National Happiness" (Bruttonationalglück). Es ist ein ganzheitlicher Indikator, der das Wohlbefinden der Bevölkerung anhand von Kultur, Umwelt, Gesundheit und guter Regierungsführung misst, statt nur den ökonomischen Output.
Warum ist Bhutan ein Vorbild für Postwachstum?
Bhutan hat sich explizit gegen die reine Maximierung des BIP entschieden und setzt stattdessen auf nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz und den Erhalt kultureller Werte trotz wirtschaftlicher Modernisierung.
Was ist der Unterschied zwischen "Green Growth" und Postwachstum?
Green Growth strebt weiterhin Wirtschaftswachstum an, das durch Technik ökologisch entkoppelt wird. Postwachstum hingegen zweifelt an der Möglichkeit dieser Entkoppelung und fordert eine Reduzierung von Produktion und Konsum.
Welche Rolle spielen Postwachstumsansätze für Entwicklungsländer?
Sie bieten eine Alternative zum westlichen Entwicklungsmodell und ermöglichen es, soziale Wohlfahrt und ökologische Stabilität zu sichern, ohne in die ökologischen Fallen des industriellen Wachstumspfads zu tappen.
- Quote paper
- Vartan Bal (Author), 2019, Postwachstumsinitiativen in Entwicklungsländern am Fallbeispiel Bhutan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540363