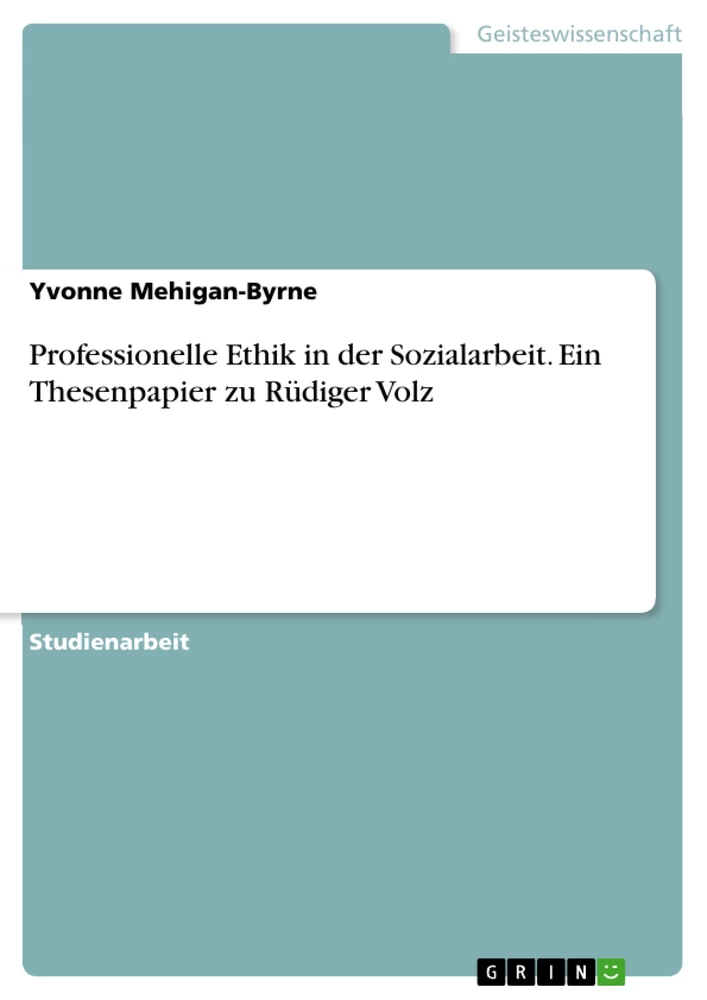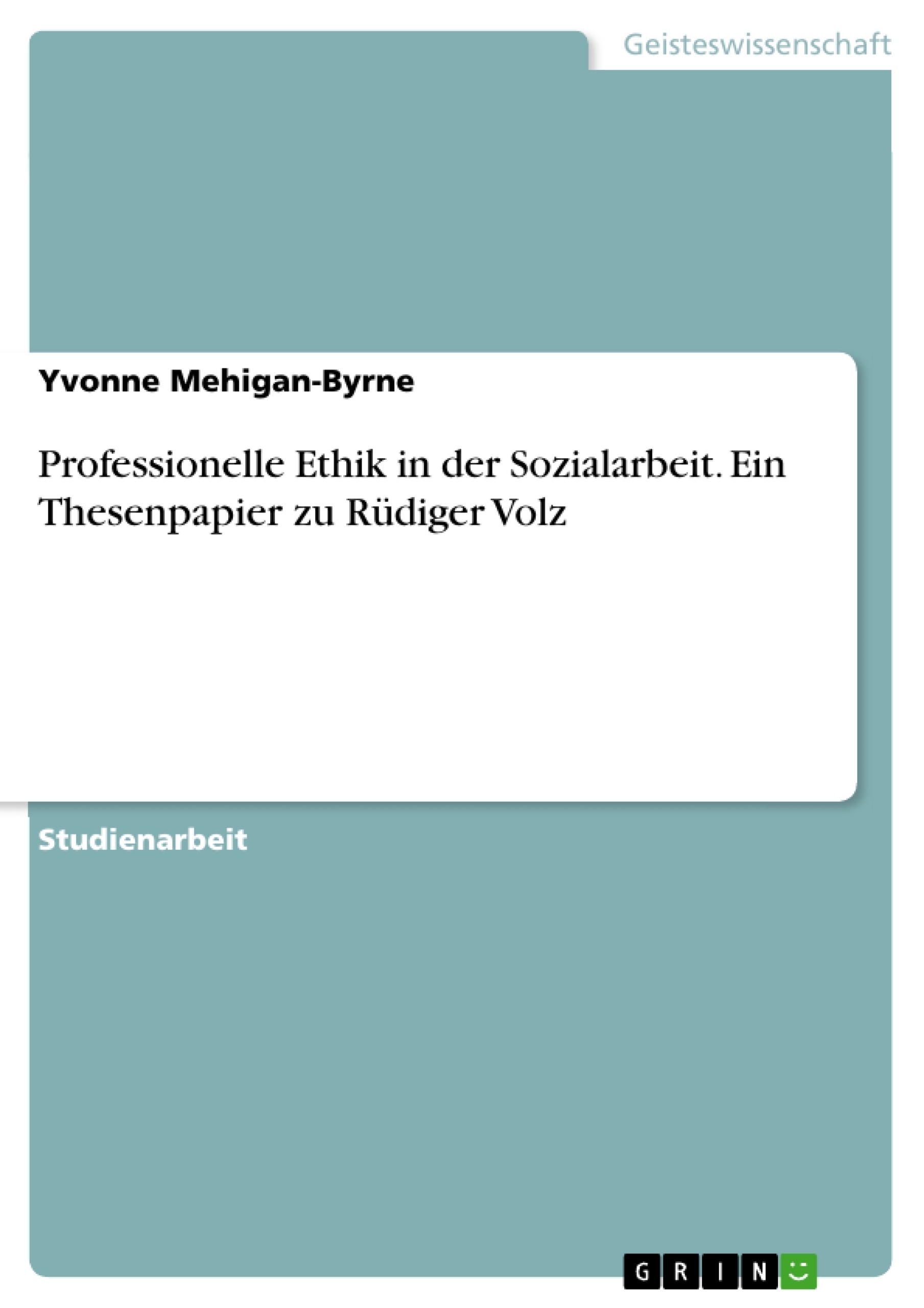Die Soziale Arbeit als Profession steht heute vor vielfältigen Herausforderungen und ethischen Fragestellungen. Dieses Thesenpapier widmet sich drei zentralen Thesen, die das Spannungsfeld zwischen ökonomischen Erwartungen, Professionalisierung und dem ethischen Anspruch in der Sozialen Arbeit beleuchten. Die Untersuchung zielt darauf ab, kritisch zu reflektieren, wie die Soziale Arbeit in der heutigen Gesellschaft agiert, welche ethischen Grundlagen sie vertritt und welche Auswirkungen dies auf die Praxis hat.
Die erste These konfrontiert die Soziale Arbeit mit der Frage, inwieweit sie den ökonomischen Erwartungen an Effektivität und zuverlässigen Problemlösungen, die in der heutigen Gesellschaft vorherrschen, etwas entgegenzusetzen hat. Dabei wird argumentiert, dass die Soziale Arbeit bereits ökonomische Ideale internalisiert hat und in Gefahr steht, ihre ethischen Grundlagen zu vernachlässigen. Die ethische Reflexion in Bezug auf die Praxis der Sozialen Arbeit wird als entscheidend erachtet, um die ethische Kompetenz der Fachkräfte zu fördern.
Die zweite These thematisiert die Auswirkungen der Bemühungen der Sozialen Arbeit um Professionalisierung. Hier wird argumentiert, dass die Orientierung an ökonomischen und technologischen Kriterien zu einer Vernachlässigung ethischer Fragestellungen geführt hat. Die Entwicklung einer eigenen Berufsethik wird als notwendig erachtet, um die Bedeutung der Ethik in der Sozialen Arbeit zu betonen und die Profession inhaltlich voranzutreiben.
Die dritte These beleuchtet die Bedeutung von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung als ethische Ziele in der Sozialen Arbeit. Dabei wird argumentiert, dass diese Werte nur in der Loslösung von der klassischen Subjekt-Objekt-Beziehung in der Praxis umgesetzt werden können. Die Reflexion über das Verständnis von "Helfen" und die Bedeutung der Subjekthaftigkeit des Klienten werden in den Fokus gerückt, um eine stärkere Orientierung an Selbstbestimmung und Autonomie zu fördern.
Die vorliegende Arbeit strebt an, einen Beitrag zur ethischen Diskussion in der Sozialen Arbeit zu leisten und die Bedeutung von ethischen Grundlagen für die Praxis zu betonen. Dabei wird herausgearbeitet, dass die Soziale Arbeit in der Lage ist, ethischen Herausforderungen zu begegnen und die Selbstbestimmung und Autonomie ihrer Klienten zu fördern, ohne die professionelle Verantwortung aus den Augen zu verlieren.
Inhaltsverzeichnis
- These 1: Soziale Arbeit hat den heutigen Erwartungen an sie, bezüglich Effektivität, zuverlässigen Problemlösungen gemäß eines feststehenden Planes nichts entgegenzusetzen, da sie die an der Ökonomie ausgerichteten Ideale bereits selbst internalisiert hat.
- These 2: Die Bemühungen der Sozialen Arbeit um Professionalisierung führten zu einer Vernachlässigung der Orientierungsfragen
- These 3: Selbstständigkeit und Selbstbestimmung als ethische Ziele zu verfolgen, kann in der Praxis der Sozialen Arbeit nur in der Loslösung von der Subjekt-Objekt-Beziehung von statten gehen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Thesenpapier analysiert die Herausforderungen der Sozialen Arbeit angesichts von Ökonomisierung und Moralisierung. Es hinterfragt die Auswirkungen der Professionalisierung auf die ethische Orientierung und untersucht die Rolle von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Kontext der Hilfeleistung.
- Die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die ethische Praxis der Sozialen Arbeit
- Der Einfluss der Professionalisierung auf die ethische Orientierung in der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung als ethische Ziele
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem Subjekt-Objekt-Verhältnis in der Sozialen Arbeit
- Die Notwendigkeit ethischer Kompetenz und Reflexion in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
These 1: Soziale Arbeit hat den heutigen Erwartungen an sie, bezüglich Effektivität, zuverlässigen Problemlösungen gemäß eines feststehenden Planes nichts entgegenzusetzen, da sie die an der Ökonomie ausgerichteten Ideale bereits selbst internalisiert hat.: Diese These argumentiert, dass die Soziale Arbeit, durch die Internalisierung ökonomischer Ideale, ihren ethischen Aufgaben nicht gerecht wird. Die Fokussierung auf effiziente, planbare Problemlösungen vernachlässigt die ethische Urteilsbildung und die Berücksichtigung multiperspektivischer Aspekte. Die These betont die Notwendigkeit einer ethischen Kompetenz, die über methodische Handlungsschemata hinausgeht und die moralische Angemessenheit von Entscheidungen in den Vordergrund stellt. Das "inhärente Gut" der Sozialen Arbeit, Bedingungen für gelingendes Leben zu schaffen, darf nicht durch ökonomische Erfordernisse gefährdet werden.
These 2: Die Bemühungen der Sozialen Arbeit um Professionalisierung führten zu einer Vernachlässigung der Orientierungsfragen: Diese These analysiert den Prozess der Professionalisierung der Sozialen Arbeit und deren Auswirkungen auf die ethische Orientierung. Das Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung führte zur Übernahme ökonomischer Rationalitätsstandards, was zu einer Vernachlässigung ethischer Fragestellungen führte. Die These verweist auf die Entwicklung der Berufsethischen Prinzipien des DBSH, die anfänglich verhaltensorientiert waren und erst später die Bedeutung der Ethik stärker betonten. Die "Berliner Erklärung" von 2014 wird als Beispiel für eine verbesserte ethische Orientierung angeführt, die die Notwendigkeit einer transparenten und nachvollziehbaren ethischen Handlungsorientierung in Dilemmata-Situationen hervorhebt.
These 3: Selbstständigkeit und Selbstbestimmung als ethische Ziele zu verfolgen, kann in der Praxis der Sozialen Arbeit nur in der Loslösung von der Subjekt-Objekt-Beziehung von statten gehen: Diese These untersucht die ethischen Herausforderungen im Hinblick auf Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Sie kritisiert das traditionelle Subjekt-Objekt-Verhältnis in der Sozialen Arbeit, in dem der Klient oft als Objekt der Intervention instrumentalisiert wird. Die These betont die Notwendigkeit, den Klienten als vollwertiges Subjekt seiner Lebenswelt wahrzunehmen und ihm bei der Entdeckung seiner Fähigkeiten und Ressourcen zu unterstützen. Der Begriff "Vermögensbildung" wird eingeführt, um die Aufgabe der Sozialen Arbeit zu beschreiben, die Selbstbestimmung und Selbstständigkeit des Klienten zu fördern, anstatt seine Abhängigkeit zu verstärken.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Ethik, Ökonomisierung, Moralisierung, Professionalisierung, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Subjekt-Objekt-Beziehung, ethische Kompetenz, Berufsethik, Hilfeplanung, Case Management.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu dem Thesenpapier: Ökonomisierung, Moralisierung und ethische Orientierung in der Sozialen Arbeit
Was ist das zentrale Thema des Thesenpapiers?
Das Thesenpapier analysiert die Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Spannungsfeld von Ökonomisierung und Moralisierung. Es untersucht kritisch die Auswirkungen der Professionalisierung auf die ethische Orientierung und die Rolle von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung in der Hilfeleistung.
Welche Thesen werden im Papier aufgestellt?
Das Papier formuliert drei zentrale Thesen: 1. Die Soziale Arbeit hat aufgrund der Internalisierung ökonomischer Ideale Schwierigkeiten, heutigen Erwartungen an Effektivität und planbare Problemlösung zu entsprechen. 2. Professionalisierungsbemühungen führten zu einer Vernachlässigung ethischer Orientierungsfragen. 3. Selbstständigkeit und Selbstbestimmung als ethische Ziele sind nur durch eine Loslösung vom traditionellen Subjekt-Objekt-Verhältnis erreichbar.
Wie wird die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit kritisiert?
Die Ökonomisierung wird als Gefahr für die ethische Praxis der Sozialen Arbeit dargestellt. Die Fokussierung auf effiziente und planbare Problemlösungen führt zur Vernachlässigung ethischer Urteilsbildung und multiperspektivischer Betrachtungsweisen. Das "inhärente Gut" der Sozialen Arbeit – Bedingungen für ein gelingendes Leben zu schaffen – wird durch ökonomische Erfordernisse gefährdet.
Welche Rolle spielt die Professionalisierung in der Kritik?
Das Streben nach Professionalisierung und gesellschaftlicher Anerkennung führte zur Übernahme ökonomischer Rationalitätsstandards und einer Vernachlässigung ethischer Fragestellungen. Das Papier verweist auf die Entwicklung der Berufsethischen Prinzipien des DBSH und die "Berliner Erklärung" von 2014 als Beispiele für eine verbesserte, aber noch unzureichende ethische Orientierung.
Wie wird das Subjekt-Objekt-Verhältnis in der Sozialen Arbeit behandelt?
Das Papier kritisiert das traditionelle Subjekt-Objekt-Verhältnis, in dem Klienten oft als Objekte der Intervention instrumentalisiert werden. Es betont die Notwendigkeit, Klienten als vollwertige Subjekte ihrer Lebenswelt wahrzunehmen und sie bei der Entdeckung ihrer Fähigkeiten und Ressourcen zu unterstützen. "Vermögensbildung" wird als zentrales Konzept zur Förderung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit eingeführt.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Thesenpapier zentral?
Schlüsselbegriffe sind: Soziale Arbeit, Ethik, Ökonomisierung, Moralisierung, Professionalisierung, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Subjekt-Objekt-Beziehung, ethische Kompetenz, Berufsethik, Hilfeplanung und Case Management.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet das Dokument?
Das Dokument bietet Kapitelzusammenfassungen zu jeder der drei zentralen Thesen, die die Argumentationslinien und Schlussfolgerungen jeweils detailliert erläutern.
Für wen ist dieses Thesenpapier relevant?
Dieses Thesenpapier ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und Praktiker der Sozialen Arbeit, die sich mit den ethischen Herausforderungen und der Professionalisierung im Feld auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Yvonne Mehigan-Byrne (Autor), 2016, Professionelle Ethik in der Sozialarbeit. Ein Thesenpapier zu Rüdiger Volz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540657