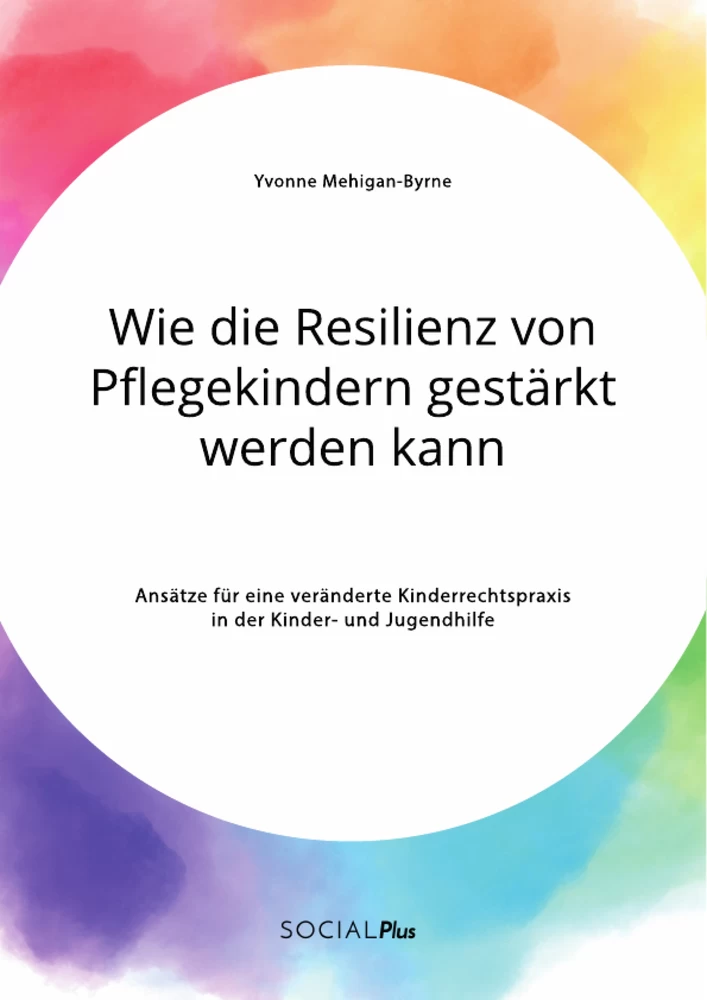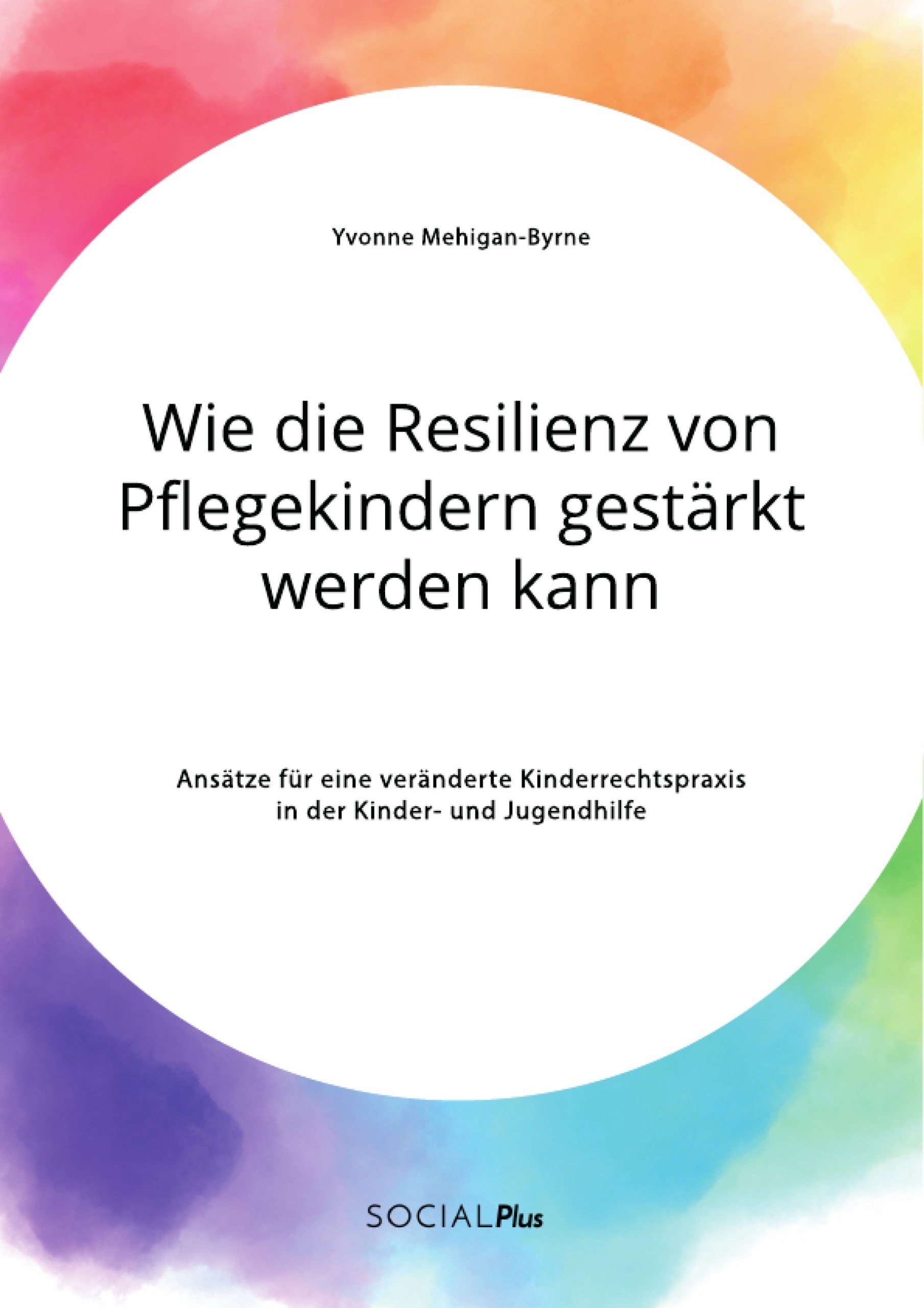Pflegekinder sehen sich in ihrem Leben mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Zu der Kindswohlgefährdung im Elternhaus, die zu der Unterbringung in einer Pflegefamilie geführt hat, kommt nicht selten eine mangelnde Beteiligung des betroffenen Kindes am Hilfeprozess.
Kann dieser Einbezug zur Ausbildung eines höheren Grades von Resilienz führen? Inwiefern trägt diese Resilienz zu einem positiven und produktiven Umgang des Kindes mit seinen Krisen bei?
Yvonne Mehigan-Byrne untersucht in ihrer Publikation verschiedene sozialpädagogische Strategien zur Resilienzförderung im Hinblick auf das nordamerikanische Pflegekinderwesen. Im Anschluss überträgt sie ihre Erkenntnisse auf die deutsche Praxis.
Aus dem Inhalt:
- Resilienzförderung;
- Sozialpädagogik;
- Partizipation;
- Vulnerabilität;
- Schutzauftrag;
- Kinderrechtspraxis
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung
- 2 Das Pflegekinderwesen
- 2.1 Stand der Forschung
- 2.2 Rechtliche Grundlagen
- 2.3 Kinderrechtspraxis
- 2.4 Das Zusammenspiel der Akteure
- 2.5 Der Schutzauftrag
- 3 Das Pflegekind und seine Besonderheiten
- 3.1 Die Bindungen des Pflegekindes
- 3.2 Die Entwicklungsaufgaben des Pflegekindes
- 3.3 Die Vulnerabilität des Pflegekindes
- 3.4 Resilienz von Pflegekindern
- 4 Umsetzung des Kinderrechts auf Beteiligung
- 5 Ansätze für die deutsche Praxis
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie die Resilienz von Pflegekindern im Hilfeverlauf der Kinder- und Jugendhilfe gestärkt werden kann. Sie geht davon aus, dass Pflegekinder aufgrund ihrer besonderen Lebensumstände spezielle Bewältigungsmechanismen benötigen. Dabei werden die Herausforderungen und Potenziale der Beteiligung von Pflegekindern in Hilfeprozessen im Zentrum der Betrachtung stehen.
- Bedeutung von Beteiligung und Partizipation für die Entwicklung von Resilienz bei Pflegekindern
- Analyse der rechtlichen Grundlagen und Praxis der Kinderrechtsumsetzung im Pflegekinderwesen
- Herausarbeitung der Besonderheiten von Pflegekindern in Bezug auf Bindungen, Entwicklungsaufgaben und Vulnerabilität
- Identifizierung von Ansätzen zur Stärkung der Resilienz von Pflegekindern in der Kinder- und Jugendhilfe
- Entwicklung praktischer Empfehlungen für die Arbeit mit Pflegekindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und beleuchtet die Bedeutung von Resilienz für das Gelingen des Lebens. Kapitel 2 widmet sich dem Pflegekinderwesen und untersucht den Stand der Forschung, die rechtlichen Grundlagen, die Kinderrechtspraxis sowie das Zusammenspiel der beteiligten Akteure. Kapitel 3 beleuchtet die Besonderheiten von Pflegekindern in Bezug auf ihre Bindungen, Entwicklungsaufgaben und Vulnerabilität. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Konzept der Resilienz. Kapitel 4 befasst sich mit der Umsetzung des Kinderrechts auf Beteiligung im Hilfeprozess. Abschließend werden in Kapitel 5 verschiedene Ansätze für die deutsche Praxis vorgestellt, die die Resilienz von Pflegekindern stärken können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Beteiligung, Partizipation, Resilienz, Pflegekinder, Kinder- und Jugendhilfe. Sie untersucht, wie die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Pflegekinderwesen umgesetzt werden können und welche Rolle die Förderung von Resilienz in diesem Kontext spielt. Der Fokus liegt dabei auf den spezifischen Herausforderungen und Bedürfnissen von Pflegekindern.
- Quote paper
- Yvonne Mehigan-Byrne (Author), 2021, Wie die Resilienz von Pflegekindern gestärkt werden kann. Ansätze für eine veränderte Kinderrechtspraxis in der Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540677