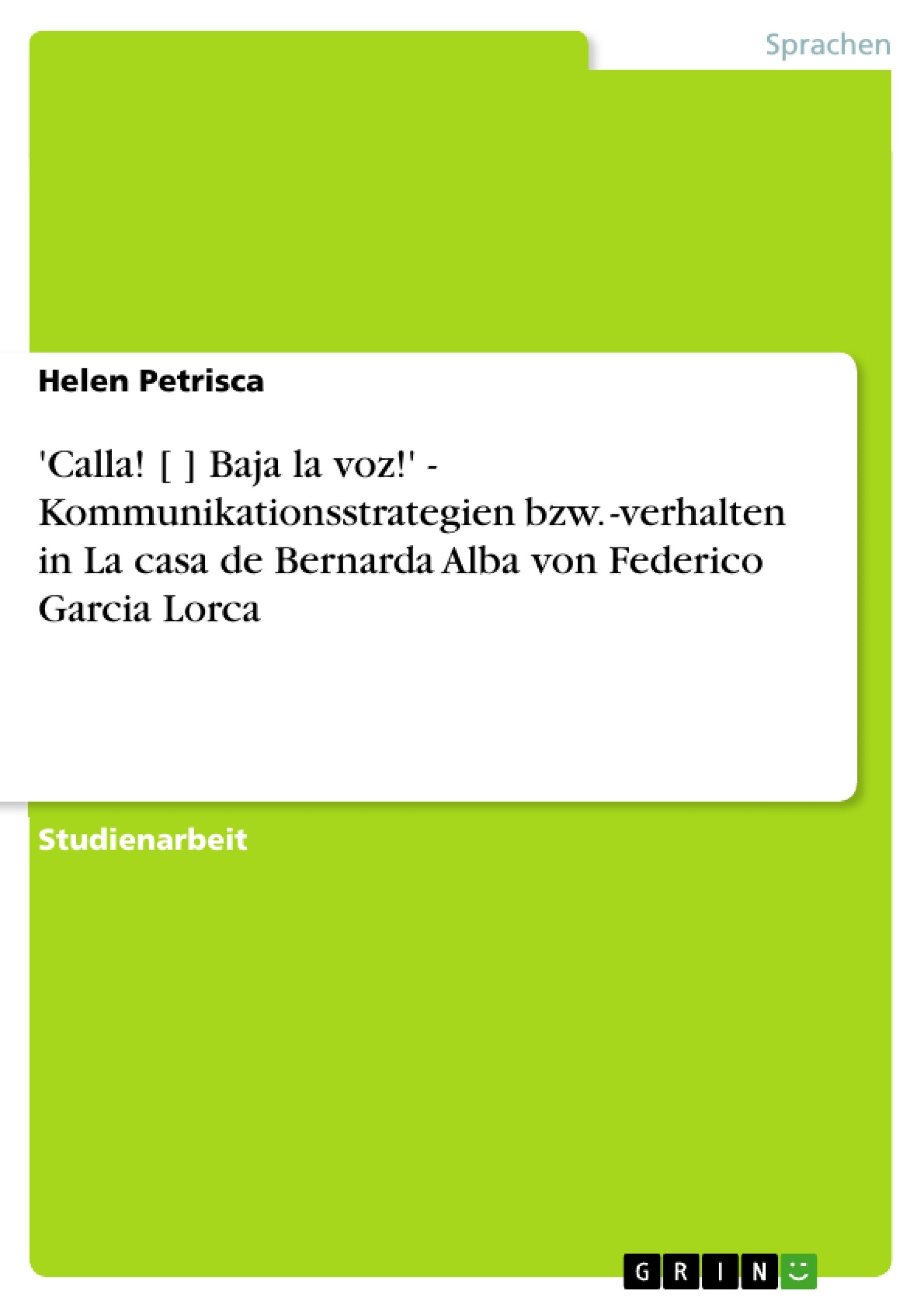„Habitación blanqusima del interior de la casa de Bernarda. Muros gruesos.” (García Lorca 1965: 1439) So wird ein Haus beschrieben, in dem einige Frauen zusammen wohnen und ihren Alltag bestreiten. Würden Sie sich darin wohl fühlen? Für mich wäre das keine gute Umgebung, um mich mit meiner Familie und Mägden auf das Leben vorzubereiten. So ergeht es auch den „Mädchen“ aus unserem Stück. Ihnen wird die Möglichkeit genommen, sich zu entfalten und aufzublühen, nur weil die Mutter beschlossen hat, über ihre Entwicklung zu bestimmen. Die fehlende Kommunikation radikalisiert diesen Zustand bis hin zum Selbst-mord aus Verzweiflung, der als einzige Lösung dieses Problems gesehen wird. In der folgenden Arbeit wollen wir mit Hilfe von Paul Watzlawick herausfinden, welche Ursachen dafür verantwortlich sind, und diese dann anhand von allgemeinen und textbezogenen Beispielen beschreiben und benennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paul Watzlawick
- Zur Person
- Kommunikationsaxiome
- Störungen
- Ideologische Wirklichkeitskonstruktion und ihre Folgen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Kommunikationsverhalten in Federico García Lorcas Drama „La casa de Bernarda Alba“ anhand der Theorie von Paul Watzlawick. Ziel ist es, die Ursachen für die mangelnde Kommunikation im Stück aufzudecken und diese mithilfe von Watzlawicks Kommunikationsaxiomen zu erklären.
- Kommunikationsstörungen als Ausdruck von Macht und Unterdrückung
- Die Rolle von Schweigen und Verweigerung in der Kommunikation
- Die Auswirkungen von familiären Strukturen auf die Kommunikation
- Die Auswirkungen von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen auf die Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz von Kommunikation und deren Störungen im Kontext von García Lorcas „La casa de Bernarda Alba“ dar. Die Arbeit soll die Ursachen für die fehlende Kommunikation im Stück mithilfe der Theorie von Paul Watzlawick untersuchen.
- Paul Watzlawick: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Person und das Werk von Paul Watzlawick, einem österreichischen Kommunikationswissenschaftler. Es werden seine zentralen Thesen und Erkenntnisse zum Thema Kommunikation und dessen Störungen beleuchtet. Die fünf Kommunikationsaxiome von Watzlawick bilden dabei den Schwerpunkt dieses Kapitels.
- Ideologische Wirklichkeitskonstruktion und ihre Folgen: Dieses Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern die ideologische Wirklichkeitskonstruktion in „La casa de Bernarda Alba“ die Kommunikation der Figuren beeinflusst. Die spezifischen Auswirkungen dieser Konstruktion auf die Kommunikationsdynamik im Stück werden hier analysiert.
Schlüsselwörter
Kommunikation, Kommunikationsstörungen, Paul Watzlawick, Kommunikationsaxiome, „La casa de Bernarda Alba“, Federico García Lorca, Schweigen, Verweigerung, Macht, Unterdrückung, Familie, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Kommunikation in Lorcas "La casa de Bernarda Alba"?
Mangelnde Kommunikation und Schweigen sind zentrale Themen, die zur Radikalisierung der familiären Situation und letztlich zum Selbstmord aus Verzweiflung führen.
Wie wendet die Arbeit Paul Watzlawicks Theorie an?
Die Arbeit nutzt Watzlawicks Kommunikationsaxiome, um die Störungen und Machtstrukturen innerhalb der Familie von Bernarda Alba zu analysieren.
Was bewirkt das Schweigen im Stück?
Schweigen wird als Instrument der Macht und Unterdrückung durch die Mutter Bernarda eingesetzt, was die emotionale Entfaltung der Töchter verhindert.
Welche Auswirkungen haben gesellschaftliche Normen auf die Figuren?
Strenge ideologische Wirklichkeitskonstruktionen und Erwartungen an Ehre und Anstand blockieren den ehrlichen Austausch und führen zur Isolation.
Was sind "Kommunikationsstörungen" laut Watzlawick?
Störungen treten auf, wenn Axiome (wie "Man kann nicht nicht kommunizieren") verletzt werden oder die Beziehungsebene die Inhaltsebene negativ dominiert.
- Citation du texte
- Helen Petrisca (Auteur), 2006, 'Calla! [ ] Baja la voz!' - Kommunikationsstrategien bzw. -verhalten in La casa de Bernarda Alba von Federico Garcia Lorca, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54070

![Titre: 'Calla! [
] Baja la voz!' - Kommunikationsstrategien bzw. -verhalten in La casa de Bernarda Alba von Federico Garcia Lorca](https://cdn.openpublishing.com/thumbnail/products/54070/large.webp)