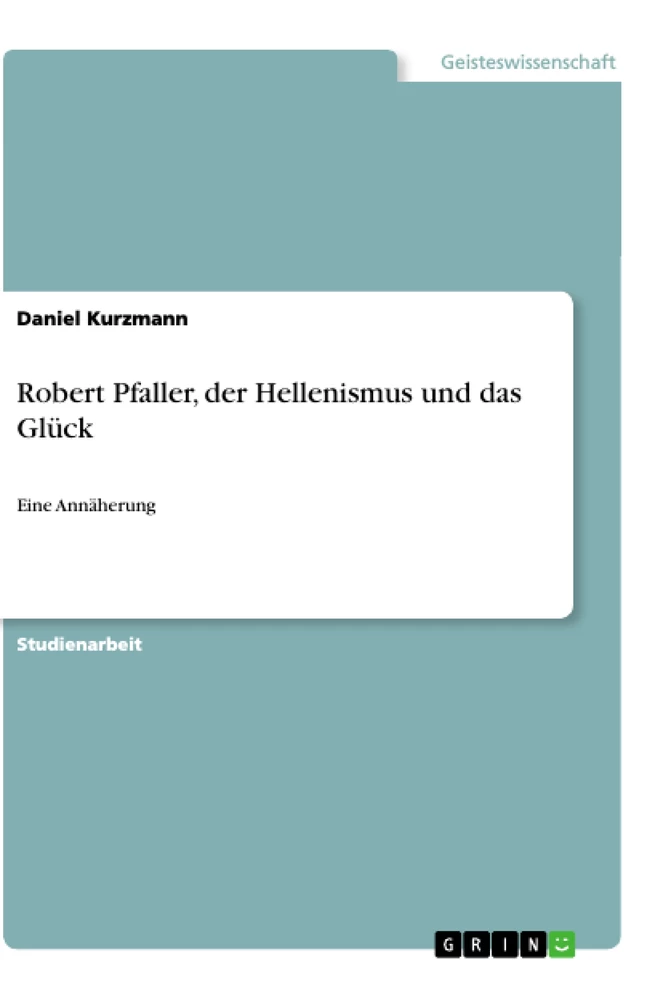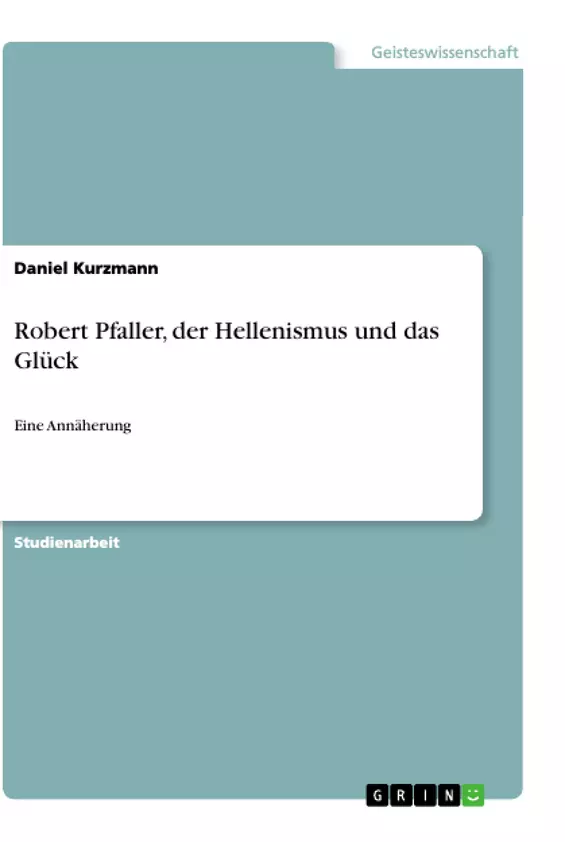Worin besteht Glück? Ist es „eine Art Hochgefühl, das uns gelegentlich erfüllt“ (Hossenfelder, 1998), „das Gefühl, lebendig zu sein“, kann man es mit „Lust“ oder „Tugend“ gleichstellen und übersetzen oder hängt es gar von objektiv feststellbaren, äußeren Bedingungen ab, gibt es dafür Rezepte oder eine App – und kann man Glück erlernen? PhilosophInnen seit der Antike, empirische WissenschafterInnen, Literatur-, Kunst- und Filmschaffende haben sich seit jeher mit dem Thema Glück auseinandergesetzt und versucht, dieses Phänomen fassbar zu machen. Eine Fülle an Ratgeberliteratur, diversen Seminaren sowie beispielsweise Bestrebungen, Glück als Unterrichtsfach in Pflichtschulen zu integrieren, sind Indizien für eine unstillbare Sehnsucht nach dem Glück und zeigen gleichzeitig dessen Aktualität und Faszination auf.
Die vorliegende Seminararbeit mit dem Titel „Robert Pfaller, der Hellenismus und das Glück. Eine Annäherung“ beschäftigt sich mit einer bestimmten – konkret: hedonistischen – Interpretation der oben anklingenden Fragen zum Glücksbegriff. So werden im I. Kapitel die drei Hauptthesen des 2011 erschienen Buches „Wofür es sich zu leben lohnt. Elemente materialistischer Philosophie“ von Robert Pfaller rekonstruiert. Im II. Kapitel wird dann der Versuch unternommen, die zuvor erläuterten Thesen Pfallers mit ausgewählten Texten Hellenistischer Denker, nämlich jener von Epikur, Seneca und Epiktet, zu konfrontieren und zu begründen. Abschließend werden eine Zusammenfassung sowie einige Schlussbemerkungen angeboten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Rekonstruktion der drei Hauptthesen von Robert Pfaller
- 1.1. Die Menschen sind durch die gegenwärtige Kultur der Fähigkeit zum Genuss beraubt worden, da das entscheidende „feiernde Kollektiv“ bzw. die öffentliche Rolle zugunsten der privaten Person zerstört wurde.
- II. Robert Pfaller trifft auf Epikur, Seneca und Epiktet
- III. Zusammenfassung und Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit „Robert Pfaller, der Hellenismus und das Glück. Eine Annäherung“ befasst sich mit einer hedonistischen Interpretation des Glücksbegriffs und untersucht, wie dieser von Robert Pfaller in seinen Schriften dargestellt wird. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die drei Hauptthesen des Buches „Wofür es sich zu leben lohnt. Elemente materialistischer Philosophie“ von Robert Pfaller zu rekonstruieren und diese mit den Thesen Hellenistischer Denker wie Epikur, Seneca und Epiktet zu vergleichen.
- Die gegenwärtige Kultur und der Verlust der Fähigkeit zum Genuss
- Die Rolle des „feiernden Kollektivs“ in der Sublimierung von Genuss
- Die Verbindung zwischen dem Unguten und dem Lustvollen
- Die Bedeutung des Hellenismus für das Verständnis von Glück
- Die Beziehung zwischen Pfallers Thesen und den Ansichten von Epikur, Seneca und Epiktet
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Rekonstruktion der drei Hauptthesen von Robert Pfaller. Es wird argumentiert, dass die heutige Kultur dazu führt, dass Menschen der Fähigkeit zum Genuss beraubt werden, da das „feiernde Kollektiv“ bzw. die öffentliche Rolle zugunsten der privaten Person zerstört wurde. Im zweiten Kapitel werden Pfallers Thesen mit den Texten von Epikur, Seneca und Epiktet konfrontiert. Es wird untersucht, ob und inwiefern sich Pfallers Ansichten mit denen der Hellenistischen Denker decken.
Schlüsselwörter
Glück, Genuss, Hedonismus, Robert Pfaller, Hellenismus, Epikur, Seneca, Epiktet, Sublimierung, Kollektiv, Kultur, Postmoderne, Materialistische Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptthese von Robert Pfaller zum Thema Glück?
Pfaller argumentiert, dass die moderne Kultur die Fähigkeit zum Genuss zerstört hat, da das "feiernde Kollektiv" zugunsten der privaten Person in den Hintergrund gedrängt wurde.
Wie hängen Hellenismus und modernes Glück zusammen?
Pfaller bezieht sich auf Denker wie Epikur, um zu zeigen, dass wahres Glück oft in der Fähigkeit zum Genuss und in der materialistischen Philosophie des "guten Lebens" liegt.
Was versteht Pfaller unter dem "feiernden Kollektiv"?
Damit ist die öffentliche, soziale Rolle des Menschen gemeint, die es ermöglicht, Lust und Genuss ohne schlechtes Gewissen im gemeinsamen Erleben zu sublimieren.
Welche hellenistischen Denker werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit setzt Pfallers Thesen in Beziehung zu den Schriften von Epikur, Seneca und Epiktet.
Was ist "materialistische Philosophie" im Sinne Pfallers?
Es ist eine Philosophie, die danach fragt, wofür es sich zu leben lohnt, und die körperliche und soziale Freuden als zentrale Elemente des menschlichen Daseins ernst nimmt.
- Citar trabajo
- Daniel Kurzmann (Autor), 2014, Robert Pfaller, der Hellenismus und das Glück, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540721