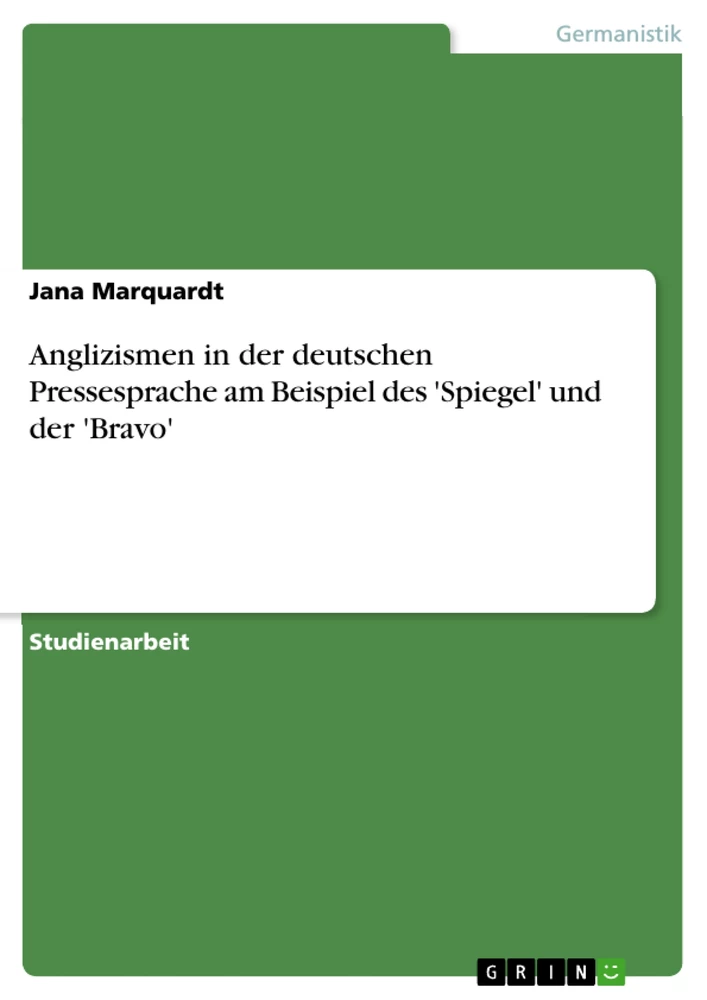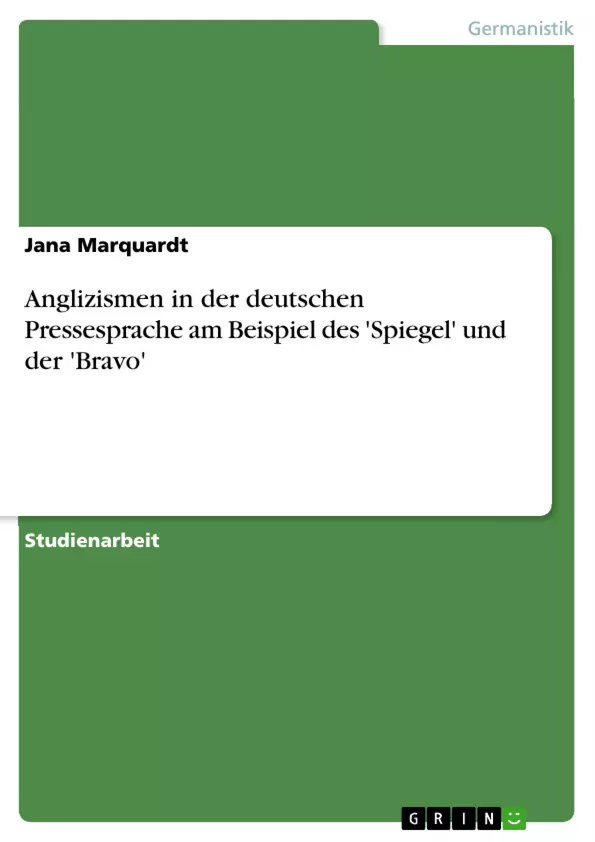1. Einleitung
Es ist eine ganz normale Erscheinung, dass eine Sprache im Laufe ihrer Entwicklung von anderen Sprachen beeinflusst wird und im Gegenzug auch selbst andere Sprachen beeinflusst. So hat das Deutsche über Jahrhunderte hinweg Wörter aus dem Lateinischen, Griechischen und Französischen übernommen und sie dem einheimischen Wortschatz in Schreibung, Aussprache und Grammatik angepasst. Während der meist in bestimmten Wellen stattfindenden Entlehnungsprozesse hat es jedoch auch immer warnende Stimmen gegeben, die einen Verfall der deutschen Sprache und Kultur befürchteten. Dies gilt vor allem auch für den gegenwärtigen Einfluss des Englischen, was sich beispielsweise an dem eigens zu diesem Sachverhalt gegründeten „Verein Deutsche Sprache“ zeigt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den stetigen Zuwachs an Anglizismen in der deutschen Sprache zu bekämpfen.
Der vermehrte Zuwachs an Anglizismen im deutschen Wortschatz ist seit Kriegsende festzustellen und hat sich seit den neunziger Jahren aufgrund der explosionsartigen Verbreitung des Internets sogar noch verstärkt. Hierbei ist zu beachten, dass dies nicht nur die Sprache bestimmter Bevölkerungsschichten betrifft, wie es bei Entlehnungen der früheren Jahrhunderte der Fall war, sondern die Sprache der gesamten Bevölkerung. Besonders einschlägige Fach- und Sachgebiete in Bezug auf die Verwendung von Anglizismen sind heute neben den Gebieten Computer, Internet und Wirtschaft solche die man der Freizeitgesellschaft zurechnen könnte wie Sport, Mode und Musik. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich gerade in der Jugendsprache, wie im Laufe der Ausführungen noch aufzuzeigen sein wird, eine ständig wachsende Anzahl von Anglizismen bzw. Scheinanglizismen finden lassen, da es gerade die Jugend ist, die sich mit diesen Themen verstärkt auseinandersetzt und von diesen Bereichen sprachlich auch angesprochen wird.
Die folgende Ausarbeitung beschäftigt sich deshalb neben der Analyse des Nachrichtenmagazins 'Der Spiegel' auch mit einer Untersuchung der Jugendzeitschrift 'Bravo', um anhand dessen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Gebrauch von Anglizismen aufzeigen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einteilung der Anglizismen
- Die Verwendung von Anglizismen in der Pressesprache am Beispiel des 'Spiegel'
- Vorbemerkungen
- Der Spiegel
- Zusammenfassung
- Die Verwendung von Anglizismen in der Jugendpresse am Beispiel der 'Bravo'
- Vorbemerkungen
- Die 'Bravo'
- Exkurs: Anglizismen in der Werbung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Anglizismen auf die deutsche Pressesprache, insbesondere am Beispiel des Nachrichtenmagazins 'Der Spiegel' und der Jugendzeitschrift 'Bravo'. Die Analyse beleuchtet die unterschiedlichen Verwendungsmuster in beiden Medien und betrachtet die Rolle von Anglizismen in der Werbung.
- Entwicklung von Anglizismen im deutschen Wortschatz
- Kategorien von Anglizismen: Lehnwörter und Fremdwörter
- Verwendung von Anglizismen in verschiedenen Medien
- Der Einfluss von Anglizismen auf die deutsche Sprache
- Die Bedeutung von Anglizismen in der Jugendsprache und in der Werbeindustrie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung von Anglizismen im Deutschen und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der Sprachentwicklung dar. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Einteilung von Anglizismen in Kategorien wie Lehnwörter und Fremdwörter und erläutert die Unterschiede zwischen beiden. Die Kapitel 3 und 4 analysieren die Verwendung von Anglizismen in den jeweiligen Publikationen 'Der Spiegel' und 'Bravo' und beleuchten die sprachlichen Besonderheiten der einzelnen Medien. Der Exkurs widmet sich der Rolle von Anglizismen in der Werbung und untersucht deren Bedeutung für die Verbreitung englischsprachiger Begriffe.
Schlüsselwörter
Anglizismen, Pressesprache, Jugendpresse, Lehnwörter, Fremdwörter, 'Der Spiegel', 'Bravo', Werbung, Sprachentwicklung, Sprachwandel, Mediensprache.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben Anglizismen auf die deutsche Pressesprache?
Anglizismen prägen zunehmend Fachgebiete wie Wirtschaft, Computer und Freizeit und führen zu einer Internationalisierung des deutschen Wortschatzes.
Wie unterscheidet sich der Gebrauch von Anglizismen in „Spiegel“ und „Bravo“?
Während der „Spiegel“ Anglizismen oft in sachlichen Kontexten nutzt, verwendet die „Bravo“ sie verstärkt zur Identifikation mit der Jugendkultur und dem Lifestyle.
Was ist der Unterschied zwischen Lehnwörtern und Fremdwörtern?
Lehnwörter sind sprachlich angepasst (z. B. in der Schreibung), während Fremdwörter ihre ursprüngliche Form aus dem Englischen weitgehend beibehalten.
Warum sind Anglizismen in der Werbung so präsent?
Sie vermitteln Modernität, Internationalität und ein bestimmtes Lebensgefühl, das Zielgruppen emotional ansprechen soll.
Gibt es Widerstand gegen die Zunahme von Anglizismen?
Ja, Organisationen wie der „Verein Deutsche Sprache“ kämpfen gegen den vermeintlichen Verfall der deutschen Sprache durch englische Einflüsse.
- Citation du texte
- Jana Marquardt (Auteur), 2005, Anglizismen in der deutschen Pressesprache am Beispiel des 'Spiegel' und der 'Bravo', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54080