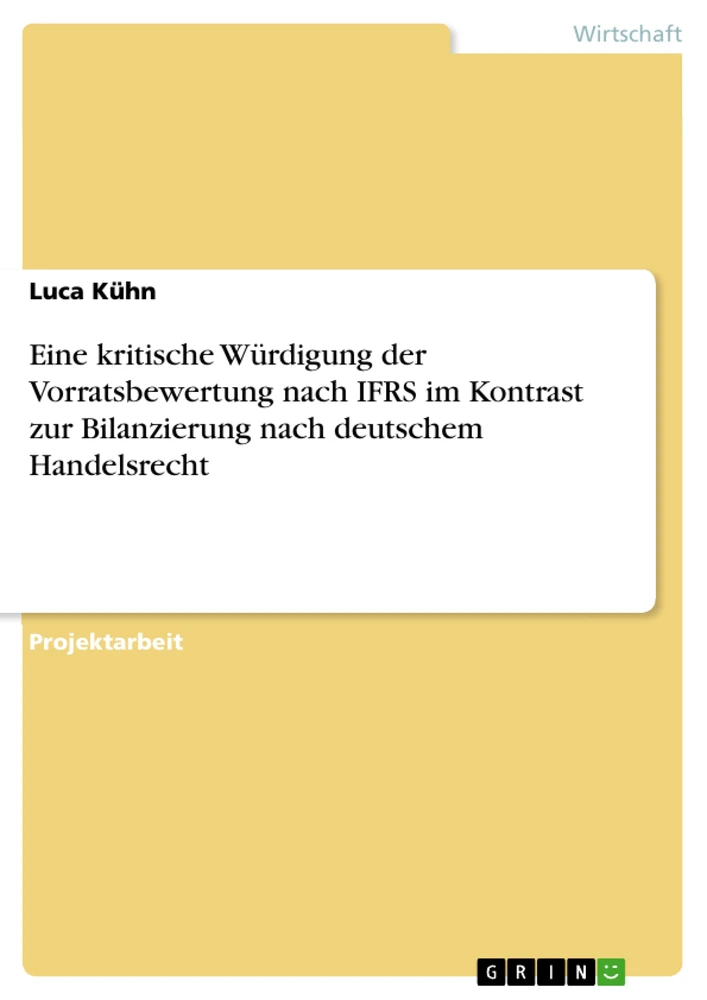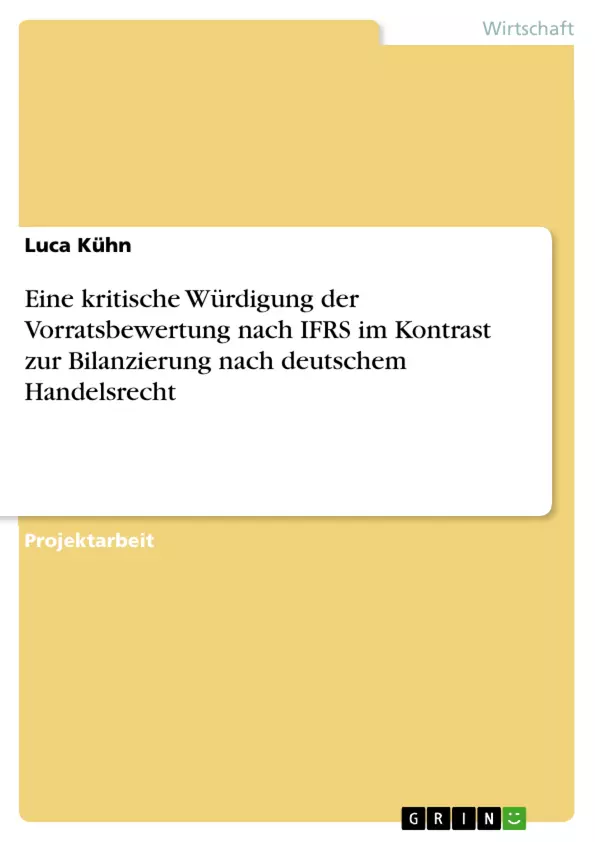Nach einem kurzen Grundlagenteil wird im Fortgang dieser Arbeit zuerst die Zugangs-, dann die Folgebewertung von Vorräten sowohl nach HGB, als auch den IFRS dargestellt. Anschließend werden die sich ergebenden Konvergenzen kritisch beleuchtet. Kernpunkt wird hierbei die in der Vergangenheit auch vom IDW Hauptfachausschuss behandelte Frage sein, ob es sinnvoll wäre, die handelsrechtliche Folgebewertung im Rahmen der GoB in Anlehnung an die IFRS-Vorgehensweise ausschließlich auf einen absatzmarktorientierten Preis zu beziehen. Am Ende der Arbeit wird ein Fazit gezogen, in welchem die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst werden.
Die Bewertung des Vorratsvermögens ist vor allem für produzierende Unternehmen und Handelsunternehmen von großer Bedeutung. So weist beispielsweise die Volkswagen AG in ihrer Handelsbilanz zum 31.12.2018 Vorräte im Wert von 5,14 Milliarden Euro aus. Vergleicht man diesen Wert mit dem in selbiger Bilanz ausgewiesenen Wert des Sachanlagevermögens von 6,731 Milliarden Euro oder des sich aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres ergebenden Jahresüberschusses von 4,62 Milliarden Euro wird deutlich, wie bedeutend der Posten des Vorratsvermögens für den Jahresabschluss ist und wie groß die Auswirkungen von beispielsweise hohen außerplanmäßigen Abschreibungen auf den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn sein können.
Für viele deutsche Unternehmensgruppen stellt sich die Frage der korrekten Vorratsbewertung nicht nur für den gemäß §242 HGB zu erstellenden Einzelabschluss nach deutschem Handelsrecht, sondern zusätzlich auch für den IFRS-Konzernabschluss, zu dessen Aufstellung kapitalmarktorientierte Muttergesellschaften von Konzernen, beziehungsweise solche Muttergesellschaften, die eine Zulassung zu einem Kapitalmarkt beantragt haben, gemäß Art. 4 der IAS-Verordnung in Verbindung mit §315e HGB verpflichtet sind.
Auch nicht-kapitalmarktorientierte Mutterunternehmen dürfen gemäß §315e Absatz 3 HGB den Konzernabschluss nach den IFRS aufzustellen, ein HGB-Konzernabschluss entfällt dann. Auch für den Einzelabschluss von Unternehmen gilt nach §325 Absatz 2a HGB ein Wahlrecht zur Rechnungslegung nach IFRS, allerdings nur für die Offenlegung. Ein handelsrechtlicher Einzelabschluss ist nichtsdestotrotz Pflicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Konzeptionelle Einordnung der handelsrechtlichen und der IFRS-Rechnungslegung vor dem Hintergrund der jeweiligen Zielsetzungen
- 2.2 Definition des Vorratsbegriffes im Handelsrecht und den IFRS
- 3. Vorratsbewertung nach HGB und IFRS
- 3.1 Zugangsbewertung nach HGB und IFRS
- 3.1.1 Zugangsbewertung nach HGB
- 3.1.1.1 Umfang des handelsrechtlichen Anschaffungskostenbegriffes in sachlicher und zeitlicher Hinsicht
- 3.1.1.2 Umfang des handelsrechtlichen Herstellungskostenbegriffes in sachlicher und zeitlicher Hinsicht
- 3.1.2 Zugangsbewertung nach IFRS
- 3.1.2.1 Umfang des Anschaffungskostenbegriffes nach IFRS in sachlicher und zeitlicher Hinsicht
- 3.1.2.2 Umfang des Herstellungskostenbegriffes nach IFRS in sachlicher und zeitlicher Hinsicht
- 3.1.1 Zugangsbewertung nach HGB
- 3.2 Folgebewertung nach HGB und IFRS
- 3.2.1 Folgebewertung nach HGB
- 3.2.2 Folgebewertung nach IFRS
- 3.3 Zulässigkeit von Bewertungsvereinfachungsverfahren im Handelsrecht und den IFRS
- 3.1 Zugangsbewertung nach HGB und IFRS
- 4. Kritische Würdigung der Unterschiede in der Vorratsbewertung nach HGB und IFRS
- 4.1 Würdigung der Unterschiede bei der Zugangsbewertung
- 4.2 Würdigung der Unterschiede bei der Folgebewertung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der kritischen Würdigung der Vorratsbewertung nach IFRS im Vergleich zur Bilanzierung nach deutschem Handelsrecht. Ziel ist es, die Unterschiede in den Bewertungsmethoden aufzuzeigen und deren Auswirkungen auf den Jahresabschluss zu analysieren. Die Arbeit untersucht, ob die Ziele der jeweiligen Rechnungslegungssysteme durch die bestehenden Verfahren optimal erfüllt werden.
- Vergleich der Vorratsbewertung nach HGB und IFRS
- Analyse der Unterschiede in der Zugangsbewertung
- Untersuchung der Unterschiede in der Folgebewertung
- Kritische Bewertung der Bewertungsvereinfachungsverfahren
- Bewertung der Zielerfüllung der jeweiligen Rechnungslegungsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit hebt die Bedeutung der Vorratsbewertung für Unternehmen, insbesondere produzierende und Handelsunternehmen, hervor. Am Beispiel der Volkswagen AG wird der hohe Wert der Vorräte im Vergleich zum Sachanlagevermögen und dem Jahresüberschuss verdeutlicht. Die Arbeit adressiert die Notwendigkeit der korrekten Vorratsbewertung sowohl nach deutschem Handelsrecht (§ 242 HGB) als auch nach IFRS für Konzernabschlüsse, wobei die Wahlpflicht für Einzelabschlüsse nach IFRS (nur zur Offenlegung) erwähnt wird. Die zentralen Fragestellungen der Arbeit betreffen die Unterschiede in der Vorratsbewertung nach HGB und IFRS, die Zielerfüllung der Systeme und Verbesserungspotenzial.
2. Grundlagen: Dieser Abschnitt legt die konzeptionellen Grundlagen der Arbeit dar. Er betont den Unterschied in den Zielsetzungen des deutschen Handelsrechts (Gläubigerschutz, Zahlungsbemessungsfunktion) und der IFRS (entscheidungsnützliche Informationen für Investoren). Der Abschnitt behandelt die Definition von Vorräten, die im deutschen Handelsrecht nicht explizit definiert sind, sondern im Kontext der Bilanzgliederungsvorschrift (§ 266 Absatz 2 HGB) zu finden ist.
3. Vorratsbewertung nach HGB und IFRS: Dieses Kapitel stellt die Zugangs- und Folgebewertung von Vorräten nach HGB und IFRS detailliert dar. Es umfasst den Umfang der Anschaffungs- und Herstellungskosten nach beiden Rechnungslegungsstandards, einschließlich sachlicher und zeitlicher Aspekte. Die Zulässigkeit von Bewertungsvereinfachungsverfahren in beiden Systemen wird ebenfalls behandelt. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der methodischen Ansätze und ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
4. Kritische Würdigung der Unterschiede in der Vorratsbewertung nach HGB und IFRS: Dieser Abschnitt analysiert kritisch die Unterschiede in der Zugangs- und Folgebewertung von Vorräten nach HGB und IFRS. Er bewertet die Konsequenzen dieser Unterschiede und diskutiert die Frage, ob eine Anpassung der handelsrechtlichen Folgebewertung an die IFRS-Vorgehensweise sinnvoll wäre, wobei der Bezug zum absatzmarktorientierten Preis im Vordergrund steht. Die Diskussion knüpft an die Arbeiten des IDW Hauptfachausschusses an.
Schlüsselwörter
Vorratsbewertung, IFRS, HGB, Zugangsbewertung, Folgebewertung, Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Jahresabschluss, Konzernabschluss, Gläubigerschutz, entscheidungsnützliche Informationen, Bewertungsvereinfachung, GoB, IDW.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Vorratsbewertung nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit einem umfassenden Vergleich der Vorratsbewertung nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie analysiert die Unterschiede in den Bewertungsmethoden, deren Auswirkungen auf den Jahresabschluss und die Frage, ob die jeweiligen Rechnungslegungsziele optimal erfüllt werden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die konzeptionellen Grundlagen der Vorratsbewertung nach HGB und IFRS, einschließlich der unterschiedlichen Zielsetzungen beider Systeme (Gläubigerschutz vs. entscheidungsnützliche Informationen). Im Detail werden die Zugangs- und Folgebewertung von Vorräten, inklusive der Anschaffungs- und Herstellungskosten, sowie die Zulässigkeit von Bewertungsvereinfachungen untersucht. Ein kritischer Vergleich der Unterschiede und deren Konsequenzen bildet einen weiteren Schwerpunkt. Die Arbeit bezieht sich auf relevante Arbeiten des IDW Hauptfachausschusses.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede in der Vorratsbewertung nach HGB und IFRS aufzuzeigen und kritisch zu würdigen. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Unterschiede auf den Jahresabschluss und untersucht, ob die jeweiligen Rechnungslegungsziele durch die bestehenden Verfahren optimal erfüllt werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob eine Anpassung der handelsrechtlichen Folgebewertung an die IFRS-Vorgehensweise sinnvoll wäre.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Problemstellung, 2. Grundlagen (konzeptionelle Einordnung, Definition des Vorratsbegriffes), 3. Vorratsbewertung nach HGB und IFRS (Zugangs- und Folgebewertung, Bewertungsvereinfachungen), 4. Kritische Würdigung der Unterschiede, und 5. Fazit. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Vorratsbewertung, IFRS, HGB, Zugangsbewertung, Folgebewertung, Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Jahresabschluss, Konzernabschluss, Gläubigerschutz, entscheidungsnützliche Informationen, Bewertungsvereinfachung, GoB, IDW.
Welche konkreten Fragestellungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede in der Vorratsbewertung nach HGB und IFRS, insbesondere bei der Zugangs- und Folgebewertung. Sie analysiert die Konsequenzen dieser Unterschiede und bewertet die Zielerfüllung der jeweiligen Rechnungslegungsmodelle. Die Zulässigkeit und der Nutzen von Bewertungsvereinfachungsverfahren werden ebenfalls kritisch hinterfragt.
Welche Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die Volkswagen AG als Beispiel, um den hohen Wert der Vorräte im Vergleich zum Sachanlagevermögen und dem Jahresüberschuss zu verdeutlichen und die Bedeutung einer korrekten Vorratsbewertung zu unterstreichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich der Rechnungslegung, insbesondere für diejenigen, die sich mit der Vorratsbewertung nach HGB und IFRS auseinandersetzen. Sie bietet einen umfassenden Überblick und eine kritische Analyse der relevanten Themen.
- Citar trabajo
- Luca Kühn (Autor), 2019, Eine kritische Würdigung der Vorratsbewertung nach IFRS im Kontrast zur Bilanzierung nach deutschem Handelsrecht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540941