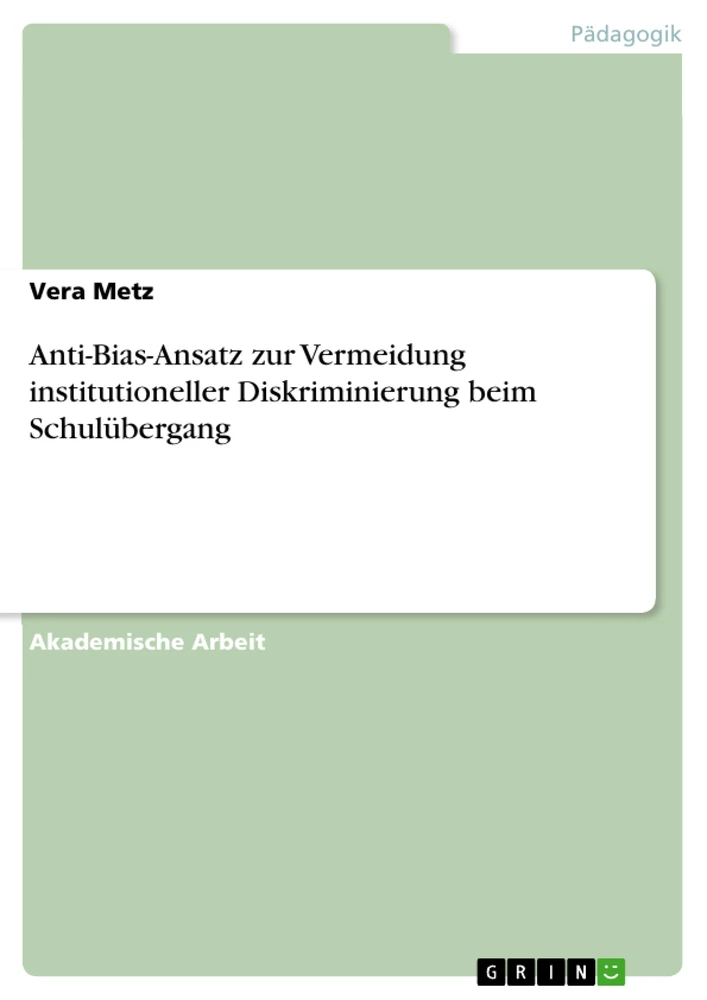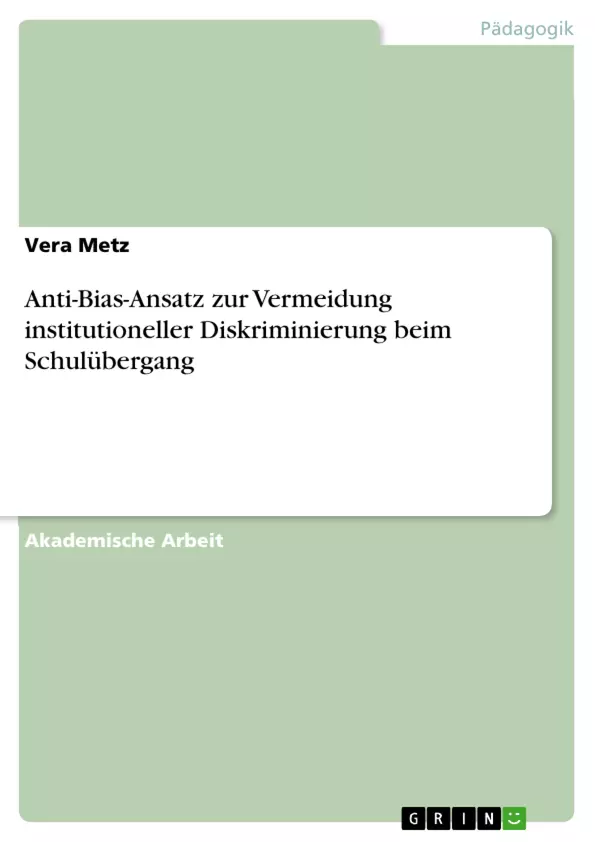Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwieweit der Anti-Bias-Ansatz institutioneller Diskriminierung ausländischer Schüler und Schülerinnen beim Schulübergang, von Grundschule auf die weiterführende Schule, entgegenwirken kann.
Integration und Einwanderung gehören heutzutage zu den zentralen Politikfeldern in Deutschland. Statistiken zufolge waren im Jahr 2011, 42 Prozent der Bevölkerung, Personen mit Migrationshintergrund. Im Jahr 2017 ist diese Zahl auf 51 Prozent gestiegen. Dabei handelt es sich um einen Zufluss von 4,4 Prozent zum Vorjahr 2016, 2017 sind es 19,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Dies ist der höchste Wert, seit der Einrichtung des Ausländerzentralregisters im Jahre 1976. Die Gründe für Migration sind vielfältig.
Allerdings werden beide Seiten, die Einwanderer und der deutsche Staat, durch die vermehrte Migration nach Deutschland vor Probleme gestellt, welche gelöst werden müssen, um Integration in die deutsche Gesellschaft zu ermöglichen. Eine Anpassung von verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren, ist für eine gelungene Integration daher unabdingbar. Dabei ist ein wichtiger Faktor, besonders für die nachhaltige Entwicklung des Menschen, der Bildungssektor. Eine gute Bildung und Ausbildung ist über die Jahre immer wichtiger geworden. In der heutigen Zeit ist, unter Berücksichtigung des Arbeitsmarktes und der wirtschaftlichen Entwicklung, eine gute Bildung von enormer Bedeutung.
Die Ergebnisse mehrerer Studien zeigen jedoch deutlich, dass Bildungschancen sehr abhängig von der Herkunft der Menschen sind. Wissenschaftlich nennt man dieses Phänomen "institutionelle Diskriminierung", welche, anders als die individuelle Diskriminierung, nicht aufgrund persönlicher Vorurteile einzelner Individuen entsteht, sondern ihren Ursprung in den normalen Organisationsstrukturen, Routinen und Programmen im Basissystem des Gesellschaftlichen Lebens hat. Neben anderen betroffenen Institutionen, stehen besonders Schulen und ihre Lehrkräfte, durch die wachsende Heterogenität der Schulklassen und der nicht angepassten Lage des Bildungssystems, vor einer immer größer werdenden Herausforderung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Diskriminierung
- 3. Institutionelle Diskriminierung
- 3.1 Historischer Hintergrund
- 3.2 Definition
- 4. Forschungsergebnisse zur Bildungsbenachteiligung
- 4.1 Bildungsbenachteiligung durch das allgemeine deutsche Bildungssystem
- 4.2 Bildungsbenachteiligung durch Mechanismen innerhalb einer Schule
- 5. Der Anti-Bias-Ansatz
- 5.1 Historischer Kontext
- 5.2 Ziele und Leitbild
- 5.3 Implementierung
- 5.3.1 Inklusive Schulentwicklung in der Grundschule (ISEG)
- 6. Konzeptpassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Problem der institutionellen Diskriminierung ausländischer Schülerinnen und Schüler beim Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Sie analysiert die Ursachen der Benachteiligung im deutschen Bildungssystem und stellt den Anti-Bias-Ansatz als ein Instrument zur Bewältigung dieser Herausforderung vor. Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit des Ansatzes und die Möglichkeit, institutionelle Diskriminierung durch die Anwendung des Anti-Bias-Ansatzes zu verringern.
- Institutionelle Diskriminierung im Bildungssystem
- Bildungsbenachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- Der Anti-Bias-Ansatz als pädagogische Intervention
- Konzeptpassung des Anti-Bias-Ansatzes zur Bekämpfung von institutioneller Diskriminierung
- Potenzial des Anti-Bias-Ansatzes zur Verbesserung des Schulübergangs für ausländische Schülerinnen und Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer allgemeinen Definition des Begriffs Diskriminierung und führt anschließend den Begriff der institutionellen Diskriminierung ein, indem sie deren Entstehung und Definition erläutert. Es werden Forschungsergebnisse zur Bildungsbenachteiligung ausländischer Schülerinnen und Schüler vorgestellt, wobei zwischen Diskriminierung durch das Bildungssystem und Diskriminierung durch Schulstrukturen und Lehrerverhalten unterschieden wird. Der Anti-Bias-Ansatz wird als pädagogische Perspektive vorgestellt, inklusive der historischen Entwicklung und seiner zentralen Ziele.
Im weiteren Verlauf wird die Implementierung des Anti-Bias-Ansatzes in der Praxis anhand des Projekts „Inklusive Schulentwicklung in der Grundschule“ (ISEG) beleuchtet. Abschließend erfolgt eine Bewertung, inwieweit der Anti-Bias-Ansatz zur Bekämpfung von institutioneller Diskriminierung beitragen kann. Die Arbeit konzentriert sich auf die Diskussion der Problematik und des Ansatzes, ohne auf konkrete Ergebnisse oder Schlussfolgerungen einzugehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen institutionelle Diskriminierung, Bildungsbenachteiligung, Anti-Bias-Ansatz, Schulübergang, Integration und Migrationshintergrund. Die Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen von institutioneller Diskriminierung im Bildungssystem und präsentiert den Anti-Bias-Ansatz als eine mögliche Strategie zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "institutioneller Diskriminierung"?
Es bezeichnet Benachteiligungen, die nicht durch persönliche Vorurteile, sondern durch Organisationsstrukturen, Routinen und Programme in gesellschaftlichen Systemen (wie der Schule) entstehen.
Was ist der Anti-Bias-Ansatz?
Ein pädagogischer Ansatz zur Vorurteilsbewussten Bildung, der darauf abzielt, Schieflagen und Diskriminierung zu erkennen und aktiv dagegen vorzugehen.
Warum ist der Schulübergang für Migrantenkinder oft schwierig?
Studien zeigen, dass Bildungschancen in Deutschland stark von der Herkunft abhängen. Institutionelle Hürden und nicht angepasste Strukturen benachteiligen oft Kinder mit Migrationshintergrund.
Was ist das Projekt ISEG?
ISEG steht für "Inklusive Schulentwicklung in der Grundschule" und ist ein Beispiel für die praktische Implementierung des Anti-Bias-Ansatzes.
Wie kann der Anti-Bias-Ansatz Diskriminierung entgegenwirken?
Durch die Sensibilisierung von Lehrkräften und die Anpassung von Schulstrukturen sollen unbewusste Mechanismen der Benachteiligung aufgebrochen und Bildungsgerechtigkeit gefördert werden.
- Citation du texte
- Vera Metz (Auteur), 2018, Anti-Bias-Ansatz zur Vermeidung institutioneller Diskriminierung beim Schulübergang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540971