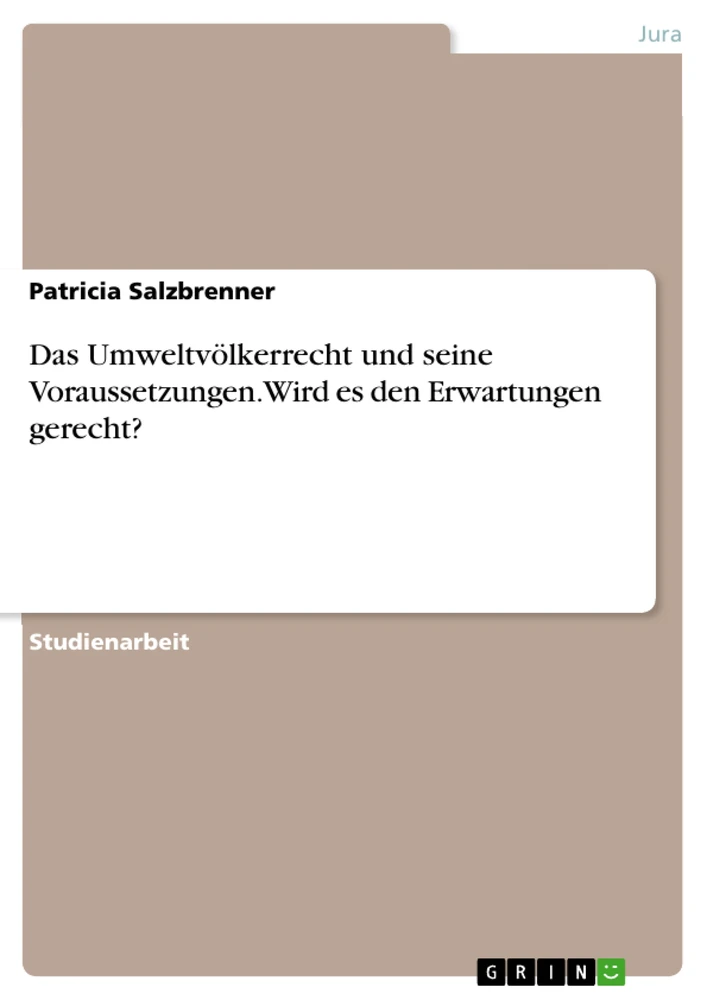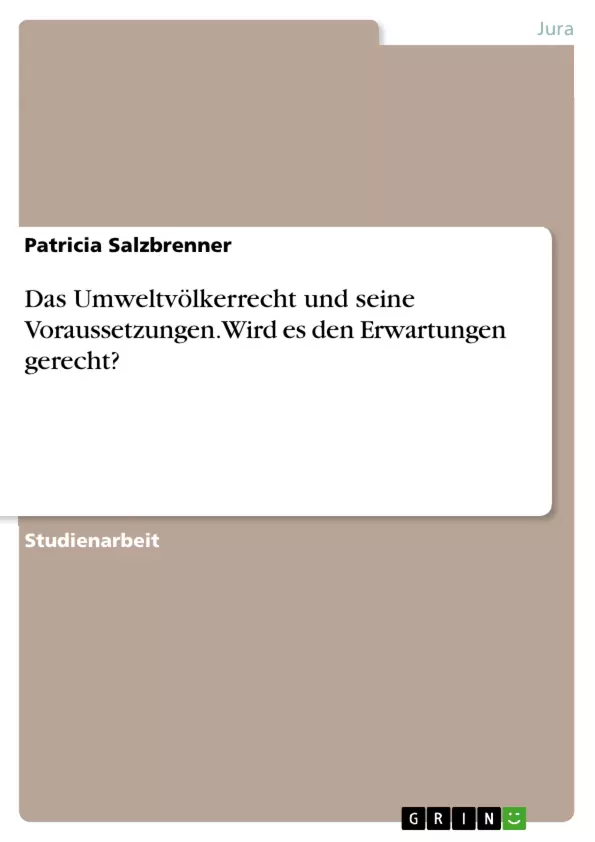Die nachfolgende Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Umweltvölkerrechts und geht der Frage nach, ob das Recht die in es gesetzten Erwartungen erfüllen kann.
Über den Zeitraum der letzten Jahrhunderte ist es dem Menschen gelungen, große Teile seiner natürlichen Lebensgrundlage unwiederbringlich zu zerstören. Durch die radikale Abholzung des Regenwaldes, der ständigen Erderwärmung durch den Klimawandel aber auch durch die zunehmende Desertifikation und Meeresverschmutzung wird das Ökosystem der Erde in hohem Maße geschädigt. Dies hat nicht nur fatale Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch für den Menschen.
Der Umweltschutz entwickelt sich somit zu einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigsten Aufgabe, der sich die Menschheit in diesem Jahrhundert gegenübersieht. Die Verantwortung der Menschheit für die unzähligen tierischen und menschlichen Todesopfer ist dabei nicht ausschließlich aus moralischer, sondern auch aus rechtlicher Sicht von erheblicher Bedeutung. Denn durch politischen Handlungsentschluss sind auf internationaler Ebene bereits zahlreiche Verträge geschlossen worden mit dem Ziel, die Umwelt zu schützen und umweltschädliches Verhalten nicht zu tolerieren. Das Völkerrecht ist damit in doppelter Hinsicht von den Politikern abhängig: Sowohl in dem Bereich der Rechtssetzung als auch in dem der Rechtsdurchsetzung.
Zwar hat sich der Gedanke des Umweltschutzes im kollektiven Bewusstsein zumindest des Westens schon seit Längerem festgesetzt und erfährt gerade im Rahmen der populär gewordenen Fridays-for-Future-Bewegung einen erneuten Aufschwung. Dennoch mangelt es in zahlreichen Gebieten noch an der konkreten Umsetzung der erarbeiteten Lösungen. Im Folgenden soll deshalb erarbeitet werden, wie weit das Schutzrecht für die Umwelt bereits ausgebaut ist und auch Anwendung findet. Um die Bedeutung des Umweltschutzes als globale Herausforderung zu unterstreichen, werden ferner insbesondere solche Umweltverschmutzungen als Beispiele dienen, die grenzüberschreitender Natur sind. Zudem sollen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um das Umweltvölkerrecht weiter auszubauen.
Inhaltsverzeichnis
- Umweltvölkerrecht und seine Voraussetzungen
- A. Umweltschutz als globale Herausforderung
- B. Grenzüberschreitende Beeinträchtigungen im Umweltvölkerrecht
- I. Definition des Begriffs „Umweltvölkerrecht“
- II. Rechtsquellen und Akteure des Völkerrechts
- III. Prinzipien im Völkerrecht
- IV. Das no harm Prinzip
- 1. Entstehung
- 2. Weiterentwicklung
- Das Verbot erheblicher grenzüberschreitender Beeinträchtigungen
- 1. Tatbestandliche Voraussetzungen
- 2. Rechtsfolgen
- 3. Bewertung für die Reichweite des Umweltschutzes
- Verfahrenspflichten aus dem no harm Prinzip anhand von Beispielen
- 1. Ständige Informationspflicht
- 2. Außerordentliche Informationspflicht
- 3. Konsultations- und Kooperationspflichten
- 4. Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung
- VII. Probleme im Umweltvölkerrecht
- 1. Eingeschränkte Rechte der NGOs
- 2. Abhängigkeit von der Autorität der Staaten
- 3. Mangelnde Rechtsdurchsetzung
- VIII. Zusammenfassung - wie weit reicht das Schutzrecht für die Umwelt?
- IX. Lösungsvorschläge
- 1. Ausbau der Rechte für die NGOs
- 2. Gründung einer Weltklimapolizei
- 3. Etablierung eines Wettbewerbs
- C. Potential des Umweltvölkerrechts
- D. Anhang
- Die globale Bedeutung des Umweltschutzes und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Menschheit.
- Die Entwicklung und die Prinzipien des Umweltvölkerrechts, insbesondere das no harm Prinzip und das Verbot erheblicher grenzüberschreitender Beeinträchtigungen.
- Die Rolle von Staaten und internationalen Organisationen im Umweltschutz.
- Die Probleme und Herausforderungen der Durchsetzung des Umweltvölkerrechts.
- Mögliche Lösungsansätze zur Stärkung des Umweltvölkerrechts.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Umweltschutz als globale Herausforderung und analysiert das Umweltvölkerrecht als ein zentrales Instrument zur Bewältigung dieser Aufgabe. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Umweltschutzes im Völkerrecht, untersucht die Prinzipien und Normen, die den grenzüberschreitenden Umweltschutz regeln, und diskutiert die Herausforderungen und Chancen des Umweltvölkerrechts.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A beleuchtet die globale Herausforderung des Umweltschutzes und zeigt die vielfältigen und verheerenden Folgen der Umweltverschmutzung für Mensch und Natur auf. Es wird deutlich, dass der Schutz der Umwelt zu einer der wichtigsten Aufgaben des 21. Jahrhunderts geworden ist. Kapitel B beschäftigt sich mit den Grundlagen des Umweltvölkerrechts, untersucht die Rechtsquellen, die Prinzipien und die Akteure des Völkerrechts im Bereich des Umweltschutzes. Es werden wichtige Prinzipien wie das no harm Prinzip und das Verbot erheblicher grenzüberschreitender Beeinträchtigungen analysiert und ihre Bedeutung für den Schutz der Umwelt erläutert. Kapitel C befasst sich mit der Bedeutung des Umweltvölkerrechts als Instrument des Umweltschutzes und skizziert die Potenziale, die das Umweltvölkerrecht bietet.
Schlüsselwörter
Umweltvölkerrecht, Umweltschutz, grenzüberschreitende Beeinträchtigungen, no harm Prinzip, Verbot erheblicher grenzüberschreitender Beeinträchtigungen, Rechtsquellen, Prinzipien, Staaten, internationale Organisationen, NGOs, Rechtsdurchsetzung, Herausforderungen, Chancen, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "no harm" Prinzip im Umweltvölkerrecht?
Es ist der völkerrechtliche Grundsatz, dass Staaten dafür verantwortlich sind, dass von ihrem Staatsgebiet aus keine erheblichen Umweltschäden in anderen Staaten verursacht werden.
Welche Probleme behindern die Durchsetzung des Umweltvölkerrechts?
Hauptprobleme sind die starke Abhängigkeit von der Autorität der Einzelstaaten, mangelnde globale Rechtsdurchsetzungsmechanismen und eingeschränkte Rechte für NGOs.
Welche Pflichten ergeben sich aus dem Verbot grenzüberschreitender Beeinträchtigungen?
Dazu gehören ständige und außerordentliche Informationspflichten, Konsultations- und Kooperationspflichten sowie die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
Welche Lösungsvorschläge werden zur Stärkung des Umweltschutzes genannt?
Die Arbeit schlägt unter anderem den Ausbau der Rechte für NGOs, die Gründung einer Weltklimapolizei und die Etablierung internationaler Wettbewerbe vor.
Warum wird der Umweltschutz als globale Herausforderung bezeichnet?
Weil Phänomene wie der Klimawandel, die Meeresverschmutzung und die Abholzung des Regenwaldes grenzüberschreitend wirken und die Lebensgrundlage der gesamten Menschheit bedrohen.
- Quote paper
- Patricia Salzbrenner (Author), 2019, Das Umweltvölkerrecht und seine Voraussetzungen. Wird es den Erwartungen gerecht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541157