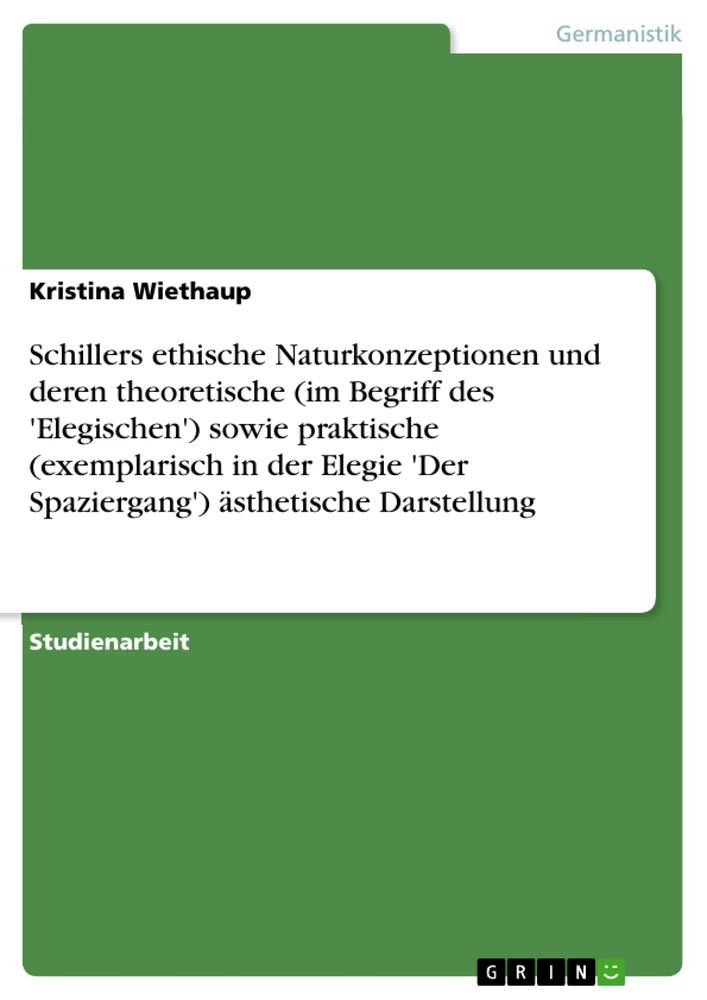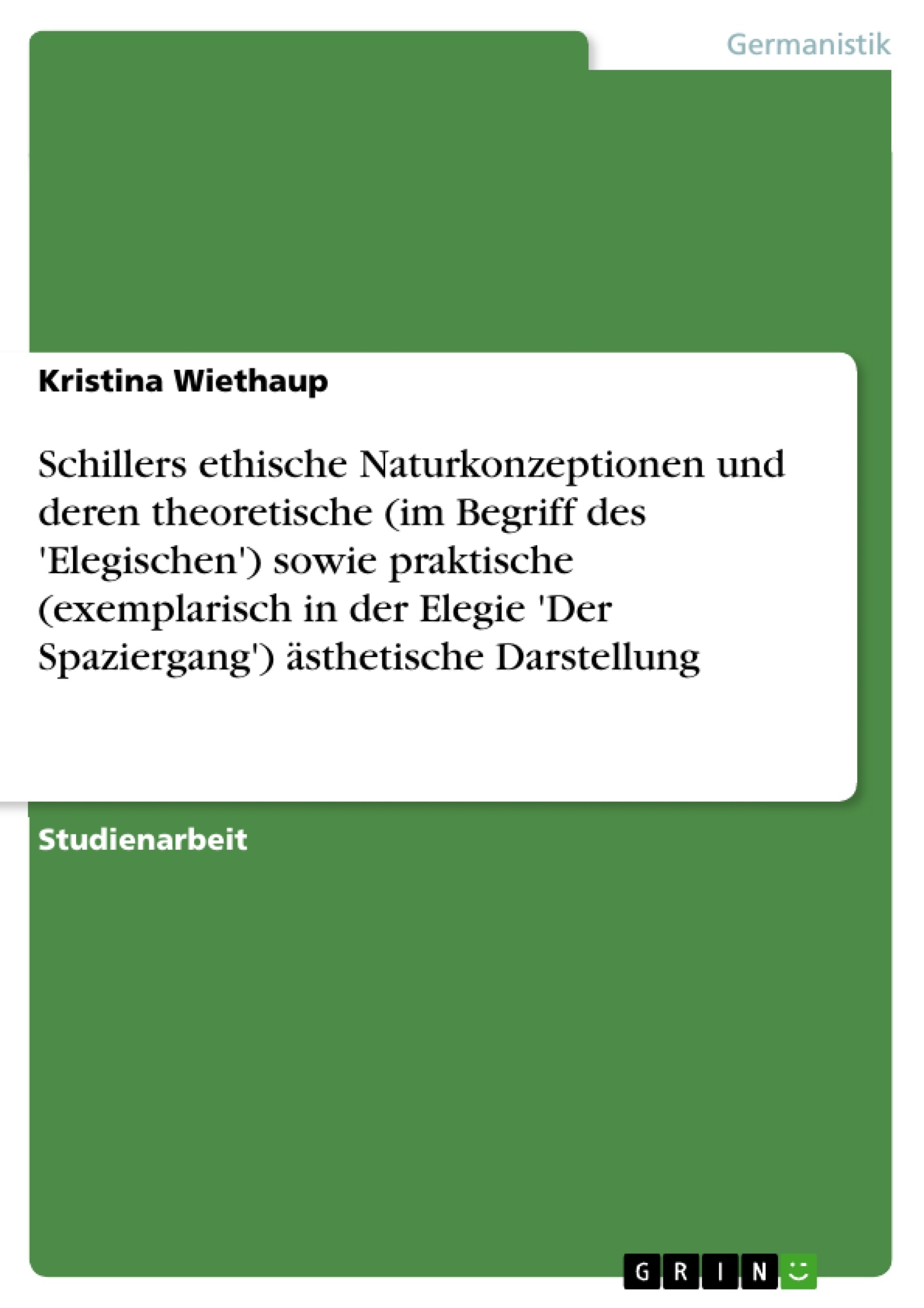Das griechische, antike zweizeilige elegeíon,also das elegische Distichon (welches nach heutigem Kenntnisstand im 7. Jh. v.u.Z. in Ionien, vermutlich durch Kallinos aus Ephesos oder Archilochos, entstand) besteht aus Daktylen, die auf einen Hexa- und einen Pentameter aufgeteilt werden, wobei im Pentameter die daktylische Dreigliederung (Länge-Kürze-Kürze) auch durch einen zweigeteilten Versfuß, einen Spondeus (Länge-Länge), ersetzt werden darf. Da jedoch das antike quantitierende Versmaß seit Renaissance und Humanismus (besonders durch F. G. Klopstock) in die neuzeitlichen akzentuierenden Sprachen transponiert wurde und sich bei dieser Übertragung zwar der Daktylus problemlos übernehmen ließ (Hebung-Senkung-Senkung), jedoch die Umsetzung des Spondeus Schwierigkeiten aufwarf, weil akzentuierende Sprachen keine Wörter mit zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Betonungen aufweisen, wird hier der Daktylus (wenn überhaupt) durch zweiteilige Trochäen (Hebung-Senkung) ersetzt, um eine möglichst große Ähnlichkeit zum antiken Metrum herzustellen. Später, besonders in neuerer Zeit, trat dieser Anspruch zunehmend in den Hintergrund (Ronsard, Donne, Gray, Shelley), und das verwendete Versmaß spielte ab dem 17. Jahrhundert allenfalls noch eine untergeordnete Rolle. Im Idealfall setzt sich der Hexameter aus fünf Daktylen und einem Trochäus am Zeilenende, der Pentameter hingegen aus vier Daktylen (wobei nach dem zweiten und vierten Daktylus je eine Einzelhebung eingeschoben ist) zusammen; des weiteren findet sich häufig eine Zäsur, in der Regel nach der jeweils 3. Betonung des Hexa- bzw. Pentameters.
Inhaltsverzeichnis
- I Einordnung der Elegien Schillers in die Tradition elegischer Dichtung
- I.1 Formgeschichtliche Entwicklung der Elegie
- I.2 Stoffgeschichtliche Entwicklung der Elegie
- II Schillers Abhandlung „Über naive und sentimentalische Dichtung“
- II.1 Entstehungsgeschichte
- II.2 Inhaltsüberblick
- II.3 Begriffsbestimmung
- II.4 Einteilung der Dichter in vier Klassen
- II.5 Weitere Differenzierungen innerhalb der Klassen
- II.6 Schillers Begriff des Elegischen
- III Beispiele aus der Geschichte der Idee eines Natur- oder Urzustandes in der Philosophie
- III.1 Bezug zu Schillers Naturbegriff
- III.2 Der Einfluß von Kants Ethik auf Schillers ästhetische Theorien
- IV Interpretation der Elegie „Der Spaziergang“
- IV.1 Einführung
- IV.2 Formanalyse
- IV.3 Inhaltliches Gefüge der Ereignisse
- IV.4 Abschlußrésumée unter der Fragestellung: Entspricht Schillers Elegie „Der Spaziergang" seiner Vorstellung von elegischer Dichtung, wie er sie in seiner Abhandlung konzipiert?
- V Verzeichnis verwendeter Literatur
- V.1 Zeitschriftenaufsätze
- V.2 Monographien
- V.3 Herausgeberschriften
- V.4 Aufsätze in Herausgeberschriften
- V.5 Fotomechanische Nachdrucke
- V.6 Multimedia
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Schillers ethische Naturkonzeptionen und deren ästhetische Darstellung, sowohl theoretisch im Begriff des „Elegischen“ als auch praktisch anhand der Elegie „Der Spaziergang“. Sie beleuchtet die Einordnung von Schillers Elegien in die Tradition elegischer Dichtung, analysiert Schillers Abhandlung „Über naive und sentimentalische Dichtung“, und interpretiert die ausgewählte Elegie im Kontext von Schillers Theorie.
- Entwicklung der elegischen Form und Stoffe
- Schillers Konzept des Elegischen in seiner ästhetischen Theorie
- Der Einfluss von Kant auf Schillers ästhetische Theorien
- Interpretation der Elegie „Der Spaziergang“
- Vergleich zwischen Theorie und Praxis in Schillers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
I Einordnung der Elegien Schillers in die Tradition elegischer Dichtung: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung der Elegie, beginnend mit dem antiken elegischen Distichon und seinen metrischen Besonderheiten. Es verfolgt die Veränderungen der elegischen Form und der behandelten Themen von der Antike bis zur Neuzeit, wobei die verschiedenen Traditionsstränge (threnetische Elegie, römische Liebeselegie, Graveyard Poetry) hervorgehoben werden. Die Entwicklung des elegischen Metrums von der quantitierenden zur akzentuierenden Sprache wird detailliert beschrieben, ebenso wie die Verschiebung des Schwerpunktes von der metrischen Form zum inhaltlichen Kriterium. Schillers acht Elegien werden in diesem Kontext eingeordnet und ihre Einzigartigkeit herausgestellt.
II Schillers Abhandlung „Über naive und sentimentalische Dichtung“: Dieses Kapitel befasst sich mit Schillers bedeutender Abhandlung. Die Entstehungsgeschichte wird nachvollzogen, wobei der schrittweise Entstehungsprozess aus einzelnen Aufsätzen und Teiluntersuchungen herausgestellt wird. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Schillers Gedanken zum Naiven und Sentimentalischen, und wie diese Konzepte mit seiner Auffassung des Elegischen zusammenhängen. Die Einteilung der Dichter in vier Klassen und die weitere Differenzierung innerhalb dieser Klassen werden erläutert. Besonders wird Schillers eigene Positionierung als sentimentalischer Dichter und die Bedeutung dieser Selbstreflexion für sein Verständnis des Elegischen beleuchtet.
III Beispiele aus der Geschichte der Idee eines Natur- oder Urzustandes in der Philosophie: Dieses Kapitel untersucht philosophische Konzepte von Natur- und Urzustand und deren Beziehung zu Schillers Naturbegriff. Der Einfluss von Kants Ethik auf Schillers ästhetische Theorien wird analysiert, um den theoretischen Hintergrund seiner elegischen Konzeptionen zu verstehen. Es werden spezifische Beispiele aus der Philosophiegeschichte herangezogen, um die Entwicklung und Bedeutung dieser Ideen im Kontext von Schillers Werk zu veranschaulichen.
IV Interpretation der Elegie „Der Spaziergang“: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Interpretation von Schillers Elegie „Der Spaziergang“. Es beinhaltet eine Formanalyse, eine Beschreibung des inhaltlichen Gefüges und eine abschließende Bewertung im Hinblick auf die Übereinstimmung mit Schillers eigener Theorie der elegischen Dichtung. Die verschiedenen Aspekte der Elegie werden im Detail analysiert und in Bezug zu Schillers theoretischen Ausführungen gesetzt. Die Bedeutung der gewählten Bildsprache und Motive wird im Kontext des Gesamtwerks erörtert.
Schlüsselwörter
Schiller, Elegie, „Der Spaziergang“, Naive und sentimentale Dichtung, Naturkonzeption, Ästhetik, Kant, Formgeschichte, Stoffgeschichte, Lyrik, Metrum, Ethik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Schillers Elegien und die Abhandlung „Über naive und sentimentale Dichtung“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Schillers ethische Naturkonzeptionen und deren ästhetische Darstellung in Theorie und Praxis. Sie analysiert Schillers Elegien im Kontext seiner Abhandlung „Über naive und sentimentalische Dichtung“ und interpretiert die Elegie „Der Spaziergang“ als Beispiel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Elegie (Form und Stoff), Schillers Konzept des Elegischen, den Einfluss Kants auf Schillers Ästhetik, eine detaillierte Interpretation der Elegie „Der Spaziergang“ und einen Vergleich zwischen Schillers Theorie und Praxis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel I ordnet Schillers Elegien in die Tradition elegischer Dichtung ein. Kapitel II analysiert Schillers Abhandlung „Über naive und sentimentalische Dichtung“. Kapitel III behandelt philosophische Konzepte des Naturzustands im Kontext von Schillers Naturbegriff. Kapitel IV interpretiert die Elegie „Der Spaziergang“. Kapitel V enthält ein Literaturverzeichnis.
Was wird in Kapitel I behandelt?
Kapitel I untersucht die historische Entwicklung der Elegie von der Antike bis zur Neuzeit, beleuchtet verschiedene Traditionsstränge (threnetische Elegie, römische Liebeselegie, Graveyard Poetry) und die Entwicklung des elegischen Metrums. Es ordnet Schillers Elegien in diesen Kontext ein.
Was wird in Kapitel II behandelt?
Kapitel II befasst sich mit Schillers Abhandlung „Über naive und sentimentalische Dichtung“, ihrer Entstehungsgeschichte, der Entwicklung seiner Gedanken zum Naiven und Sentimentalischen, der Einteilung der Dichter in vier Klassen und der Bedeutung dieser für sein Verständnis des Elegischen.
Was wird in Kapitel III behandelt?
Kapitel III untersucht philosophische Konzepte von Natur- und Urzustand und deren Beziehung zu Schillers Naturbegriff. Es analysiert den Einfluss Kants auf Schillers ästhetische Theorien.
Was wird in Kapitel IV behandelt?
Kapitel IV bietet eine detaillierte Interpretation der Elegie „Der Spaziergang“, einschließlich Formanalyse, Inhaltsanalyse und einer Bewertung im Hinblick auf Schillers Theorie der elegischen Dichtung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Schiller, Elegie, „Der Spaziergang“, Naive und sentimentale Dichtung, Naturkonzeption, Ästhetik, Kant, Formgeschichte, Stoffgeschichte, Lyrik, Metrum, Ethik.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Personen, die sich mit Schillers Werk, insbesondere seinen Elegien und seiner ästhetischen Theorie, auseinandersetzen möchten.
Wo finde ich das vollständige Literaturverzeichnis?
Das vollständige Literaturverzeichnis befindet sich in Kapitel V der Arbeit.
- Citar trabajo
- M.A. Kristina Wiethaup (Autor), 2004, Schillers ethische Naturkonzeptionen und deren theoretische (im Begriff des 'Elegischen') sowie praktische (exemplarisch in der Elegie 'Der Spaziergang') ästhetische Darstellung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54119