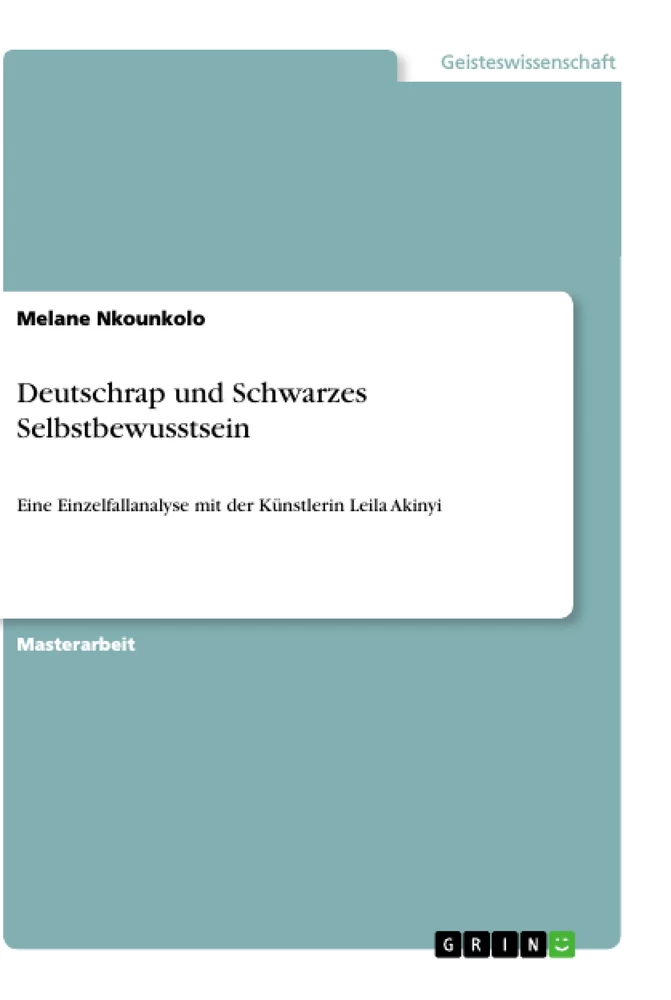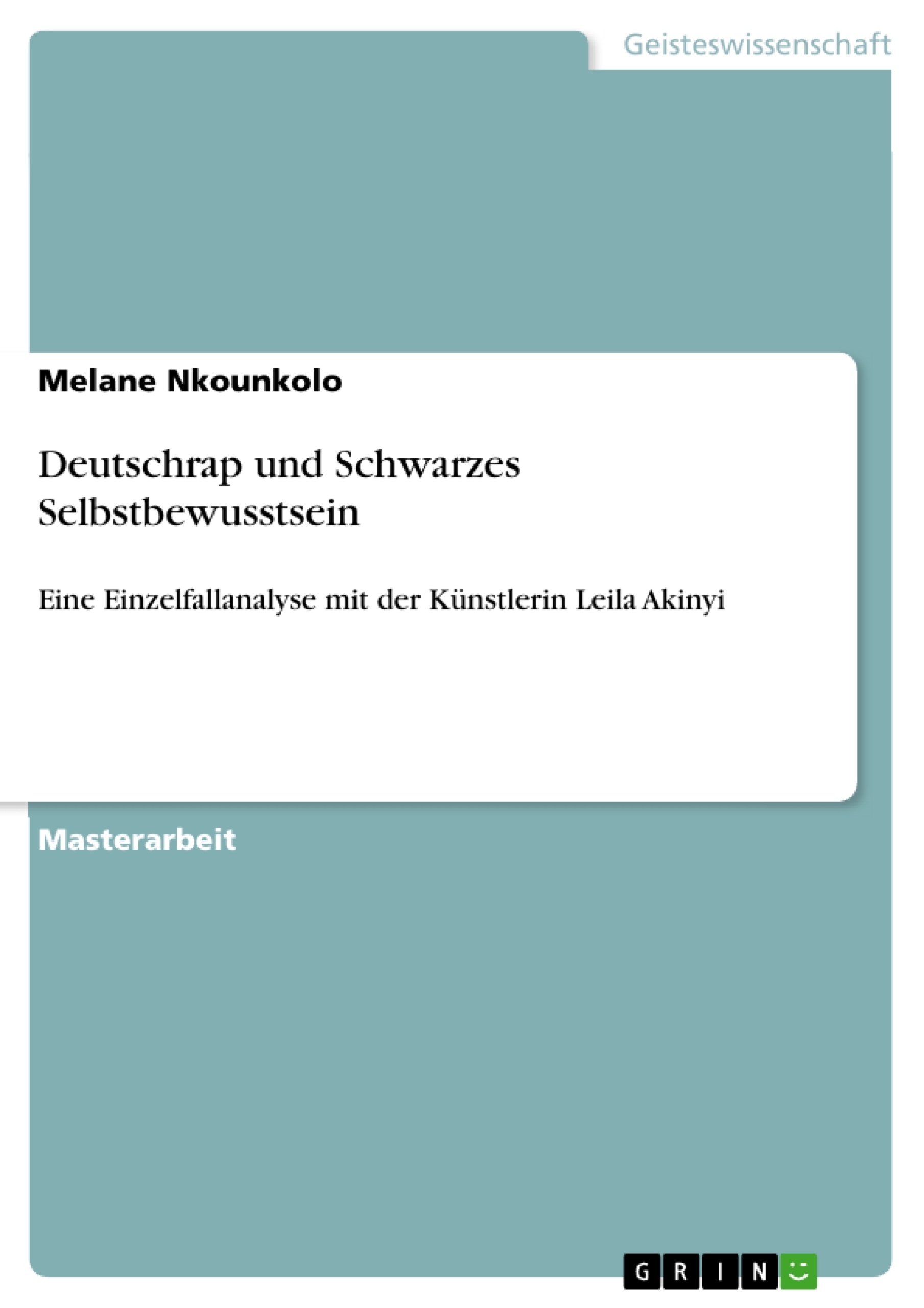Unter Einbezug von historischen, politischen, soziologischen und kulturellen Aspekten soll der Fokus auf der Identitätskonstruktion durch Hip-Hop von ausschließlich WoC-Rapperinnen (WoC = Women of Color) in Deutschland liegen. So besteht eine Zielsetzung in der Erforschung, wie WoC-Künstlerinnen in Deutschland ihre eigene Identität erschaffen. Außerdem darin, inwiefern Hip-Hop-Musik ein Ausdrucksmittel ist, das dabei hilft, Selbstbewusstsein zu stärken und ein eigenes, positives Selbstbild zu kreieren. Es soll ebenso ergründet werden, wie WoC-Rapperinnen mit Unterdrückungs- oder Diskriminierungsprozessen in einer Mehrheitsgesellschaft umgehen.
Mein Interesse gilt der Erforschung der Konstruktion musikbezogener Identität, der künstlerische Umgang mit Rassismus und Diskriminierung. So wird versucht, die Frage zu beantworten, inwiefern sich die Inhalte und die Sprache neuer Texte, wie „Afro Spartana (weil ich schwarz bin)“ der Künstlerin Leila Akinyi, die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen soll, im Vergleich zu den Texten der Gruppe Sisters Keepers und ihrem Song „Mit Liebe und Verstand“ verändert haben. Die zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit lauten: Inwiefern hat sich der Inhalt und die Sprache des Textes „Afro Spartana (weil ich schwarz bin)“ von Leila Akinyi im Vergleich zum Song „Mit Liebe & Verstand“ der Gruppe Sisters Keepers verändert? Wie konstruieren die WoC-Künstlerinnen Leila Akinyi und Sisters Keepers durch Hip-Hop ihre Identität? Wie nimmt Leila Akinyi Diskriminierung auf Grund ihrer Hautfarbe oder Geschlechts wahr? Inwiefern bietet Hip-Hop für Leila Akinyi Identifikationsmöglichkeiten?
Anfang der 1990er Jahre und nach Deutschlands 41-jähriger Teilung gab der Song „Fremd im eigenem Land“ (1995) der Band „Advanced Chemistry“ insbesondere denjenigen eine Stimme, die in der Nachwendezeit Opfer rassistischer Gewalt und der Diskriminierung wurden und deren Akzeptanz als deutsche Bürger seitens der Gesellschaft verweigert wurde. Erstmals rückte das Thema Rassismus und Diskriminierung in die deutsche Öffentlichkeit. Es liegen sechs Jahre zwischen der ersten kommerziell relevanten Veröffentlichung der Gruppe „Advanced Chemistry“ und dem im Jahr 2001 veröffentlichten Song „Adriano (Letze Warnung)“ der Band „Brothers Keepers“, deren Song die Ermordung des Mosambikaners Alberto Adriano durch Neonazis zum Gegenstand hatte.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Forschungsstand
- Methodisches Vorgehen
- Theoretische Überlegungen
- Begriffserklärung
- Identität
- Afrodeutsche, Schwarze Deutsche, People of Color
- Drei Konzepte der Identität nach Stuart Hall
- Kulturelle Repräsentation
- Nation und kulturelle Nation
- Die Identitätskonstruktion „Schwarz“
- Wir (und) die Anderen: Schwarzsein und Deutschsein
- Critical Whiteness und Identitätskonstruktion
- Hip-Hop
- Geschichte des Hip-Hops
- Hip-Hop, Identität und Identitätskonstruktionen
- Performative Identifikationsmöglichkeiten
- Konzepte als Werkzeuge zur Identitätsbildung
- Repräsentation
- Differenzierung
- Hip-Hop in Deutschland
- Geschichte des Hip-Hops in Deutschland - 1980 bis 1990
- Das sozial-politisches Klima und die Bedeutung des Hip-Hops für PoCs in Deutschland
- Advanced Chemistry „Fremd im eigenem Land“
- Brothers- und Sisters Keepers
- Women of Color - Identitäten in der deutschen Medienkultur
- Women of Color - Identitäten und Frauenbewegung in Deutschland
- Schwarze (WoC-) Identitäten in der Popmusik
- Die Musikgruppe „Tic Tac Toe“
- Die postmoderne Entertainment Medienkultur
- Empirischer Teil
- Die „Qualitative Inhaltsanalyse“ nach Philip Mayring
- Die „Kritische Diskursanalyse“ nach Siegfried Jäger
- Die Feinanalyse
- Durchführung: Qualitative Inhaltsanalyse
- Methodisches Vorgehen
- Biografie „Leila Akinyi“
- Biografie „Sisters Keepers“
- Darstellung der Ergebnisse: Das Kategoriensystems
- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- Afro Spartana (weil ich schwarz bin)
- Mit Liebe und Verstand Sisters Keepers
- Gegenüberstellung und Interpretation der Ergebnisse
- Die Einzelfallanalyse
- Falldefinition und Fragestellung
- Materialaufbereitung
- Festlegung der Methoden und konkrete Vorgehensweise
- Vorstellung des Kategoriensystems
- Interpretation der Ergebnisse
- Fazit und weiterführende Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion von Identität schwarzer Frauen im deutschen Hip-Hop, insbesondere anhand der Künstlerin Leila Akinyi. Ziel ist es, zu erforschen, wie diese Künstlerinnen ihre Identität im Kontext von Rassismus und Diskriminierung in der deutschen Gesellschaft darstellen und wie Hip-Hop als Mittel zur Stärkung des Selbstbewusstseins und zur Schaffung eines positiven Selbstbildes dient. Die Arbeit analysiert, wie mit Unterdrückungs- und Diskriminierungsprozessen umgegangen wird und wie sich die Inhalte und die Sprache neuerer Texte im Vergleich zu älteren Äußerungen verändert haben.
- Identitätskonstruktion schwarzer Frauen im deutschen Hip-Hop
- Rassismus und Diskriminierung im deutschen Kontext
- Hip-Hop als Mittel der Selbstrepräsentation und des Widerstands
- Vergleichende Analyse von Texten verschiedener Künstlerinnen
- Entwicklung des Diskurses um Schwarzes Selbstbewusstsein im deutschen Hip-Hop
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung zum Thema: Die Einleitung beleuchtet die Situation von People of Color (PoC) in Deutschland nach dem Mauerfall, den Anstieg rassistischer Vorfälle und die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz. Sie führt in die zweite Welle der afrodeutschen Bewegung ein, die aus der Frauenbewegung hervorgeht, und verweist auf wichtige Songs wie „Fremd im eigenen Land“ von Advanced Chemistry und „Mit Liebe und Verstand“ von Sisters Keepers als Meilensteine im Diskurs um Rassismus und Diskriminierung. Der Fokus liegt auf der unterrepräsentierten Rolle von schwarzen Frauen im deutschen Hip-Hop und der Entwicklung hin zu einer bewussteren Selbstrepräsentation in der Gegenwart, exemplifiziert an Künstlerinnen wie Leila Akinyi.
Theoretische Überlegungen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert zentrale Begriffe wie Identität, Afrodeutsche, Schwarze Deutsche und People of Color und beschreibt Hall's Konzepte der Identität. Weiterhin werden die Identitätskonstruktion "Schwarz", der Umgang mit "Schwarzsein" und "Deutschsein" sowie die Bedeutung von Critical Whiteness für die Identitätsbildung diskutiert. Diese theoretischen Überlegungen bilden die Basis für die Analyse der kommunikativen Verhandlungen von Identitäten im empirischen Teil.
Hip-Hop: Dieser Abschnitt beleuchtet die Geschichte des Hip-Hops und seine Rolle bei der Identitätskonstruktion. Es werden performative Identifikationsmöglichkeiten, Konzepte der Identitätsbildung im Hip-Hop, die Aspekte von Repräsentation und Differenzierung innerhalb der Hip-Hop-Kultur analysiert. Dieser Abschnitt bereitet den Leser auf die spezifischen Kontexte des deutschen Hip-Hop vor, in dem die empirische Untersuchung stattfindet.
Hip-Hop in Deutschland: Hier wird die Geschichte des deutschen Hip-Hops von den 1980er Jahren bis in die Gegenwart nachgezeichnet, mit Schwerpunkt auf dem sozialen und politischen Kontext sowie der Bedeutung von Hip-Hop für PoCs. Die Analyse der Songs „Fremd im eigenen Land“ (Advanced Chemistry) und „Adriano (Letzte Warnung)“ (Brothers Keepers), sowie „Mit Liebe und Verstand“ (Sisters Keepers) veranschaulicht die Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierung in der deutschen Gesellschaft. Die Entwicklung von der Darstellung konkreter rassistischer Übergriffe hin zu einer offensiveren und provokanteren Auseinandersetzung mit der eigenen Identität wird beleuchtet.
Women of Color - Identitäten in der deutschen Medienkultur: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Women of Color (WoC) in der deutschen Medienlandschaft und ihren Beitrag zum Identitätsdiskurs. Es betrachtet die Rolle von WoC in der Frauenbewegung, ihre Darstellung in der Popmusik (am Beispiel von Tic Tac Toe) und die Auswirkungen der postmodernen Entertainment-Medienkultur auf die Konstruktion von WoC-Identitäten. Dies bildet den Rahmen für das Verständnis der spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Selbstrepräsentation für WoC-Künstlerinnen im deutschen Hip-Hop.
Schlüsselwörter
Deutschrap, Schwarzes Selbstbewusstsein, People of Color (PoC), Women of Color (WoC), Identität, Identitätskonstruktion, Rassismus, Diskriminierung, Hip-Hop, Medienkultur, Qualitative Inhaltsanalyse, Kritische Diskursanalyse, Leila Akinyi, Sisters Keepers, Afrodeutsche Bewegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Identitätskonstruktion schwarzer Frauen im deutschen Hip-Hop
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Identität schwarzer Frauen im deutschen Hip-Hop, insbesondere anhand der Künstlerin Leila Akinyi. Sie analysiert, wie diese Künstlerinnen ihre Identität im Kontext von Rassismus und Diskriminierung darstellen und wie Hip-Hop als Mittel zur Stärkung des Selbstbewusstseins und zur Schaffung eines positiven Selbstbildes dient. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Umgang mit Unterdrückungs- und Diskriminierungsprozessen und der Veränderung der Inhalte und Sprache neuerer Texte im Vergleich zu älteren Äußerungen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse nach Philip Mayring und eine kritische Diskursanalyse nach Siegfried Jäger. Es werden Biografien von Leila Akinyi und Sisters Keepers sowie weitere relevante Texte analysiert. Die Analyse umfasst eine Feinanalyse, eine Gegenüberstellung und Interpretation der Ergebnisse sowie eine Einzelfallanalyse.
Welche theoretischen Konzepte werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf Halls Konzepte der Identität, die Identitätskonstruktion "Schwarz", den Umgang mit "Schwarzsein" und "Deutschsein" sowie Critical Whiteness. Diese Konzepte dienen der Analyse der kommunikativen Verhandlungen von Identitäten.
Welche Künstlerinnen und Gruppen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere die Künstlerin Leila Akinyi und die Gruppe Sisters Keepers. Zusätzlich werden Advanced Chemistry und Tic Tac Toe als Beispiele für die Entwicklung des Diskurses um schwarzes Selbstbewusstsein im deutschen Hip-Hop herangezogen.
Welche historischen Entwicklungen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Geschichte des Hip-Hops in Deutschland von den 1980er Jahren bis in die Gegenwart, den sozialen und politischen Kontext sowie die Bedeutung von Hip-Hop für People of Color (PoC). Sie betrachtet die Entwicklung von der Darstellung konkreter rassistischer Übergriffe hin zu einer offensiveren und provokanteren Auseinandersetzung mit der eigenen Identität.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Deutschrap, Schwarzes Selbstbewusstsein, People of Color (PoC), Women of Color (WoC), Identität, Identitätskonstruktion, Rassismus, Diskriminierung, Hip-Hop, Medienkultur, Qualitative Inhaltsanalyse, Kritische Diskursanalyse, Leila Akinyi, Sisters Keepers und Afrodeutsche Bewegung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Hinführung zum Thema (mit Forschungsstand und methodischem Vorgehen), theoretische Überlegungen (inklusive Begriffserklärungen und Halls Identitätstheorien), Hip-Hop allgemein und in Deutschland, Women of Color in der deutschen Medienkultur, den empirischen Teil (mit Methodenbeschreibung und -anwendung), sowie Fazit und weiterführende Überlegungen.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Identitätskonstruktion schwarzer Frauen im deutschen Hip-Hop zu untersuchen, die Darstellung ihrer Identität im Kontext von Rassismus und Diskriminierung zu analysieren und die Rolle des Hip-Hops als Mittel der Selbstrepräsentation und des Widerstands zu beleuchten. Ein Vergleich verschiedener Künstlerinnen und die Entwicklung des Diskurses um schwarzes Selbstbewusstsein im deutschen Hip-Hop bilden weitere Ziele.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsstand und das methodische Vorgehen beschreibt. Es folgen Kapitel mit theoretischen Überlegungen, der Analyse von Hip-Hop allgemein und im deutschen Kontext, der Darstellung von Women of Color in der Medienkultur und dem empirischen Teil mit der Auswertung der Daten. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und weiterführenden Überlegungen.
- Citation du texte
- Melane Nkounkolo (Auteur), 2018, Deutschrap und Schwarzes Selbstbewusstsein. Kommunikative Verhandlungen der Identitäten von PoC-Künstlerinnen in der Gattung des Hip-Hops, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541374