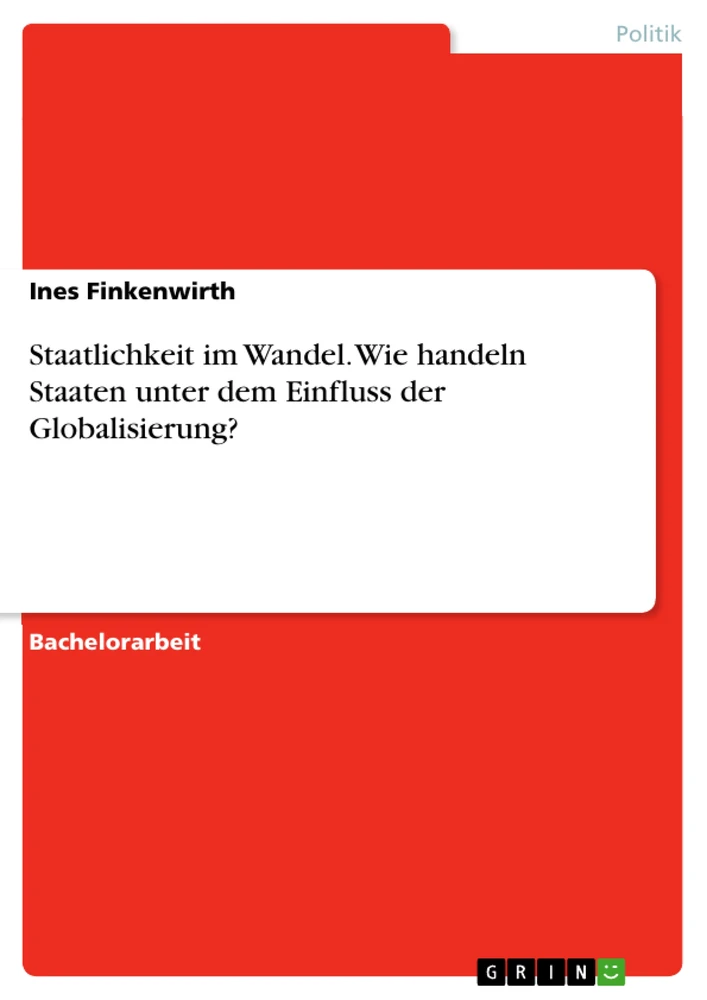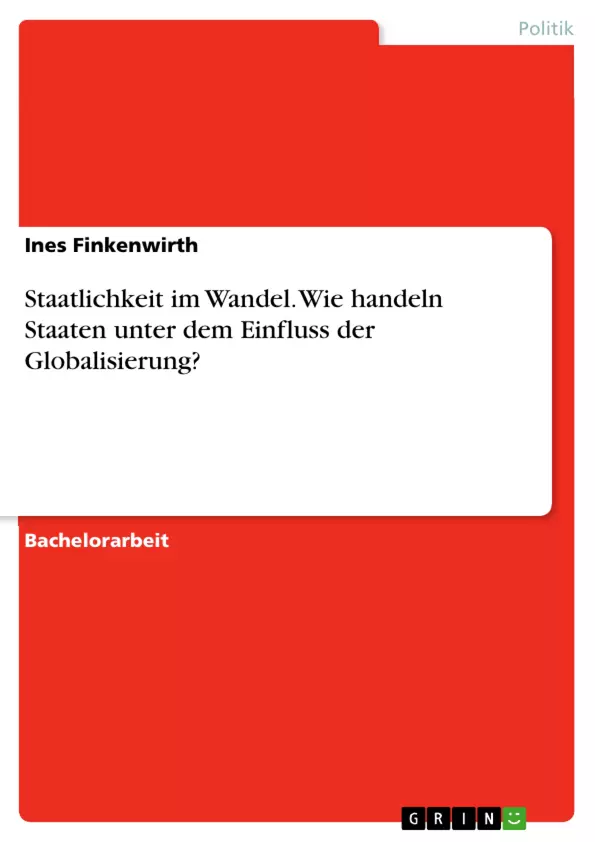Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit folgender Frage: Wie gehen Staaten mit dem Einfluss von Globalisierungsprozessen um? Ziel ist es, zu untersuchen, welche Rolle der einzelne Nationalstaat in diesen komplexen Strukturen einnimmt und welche Handlungsoptionen hinsichtlich zukünftiger, globaler Herausforderungen bestehen. Dabei wird stets die Verbindung zur Europäischen Union hergestellt.
Kaum eine gesellschaftliche Debatte kommt ohne die Verwendung jenes Schlagwortes aus, das sich auf beinahe alle Lebensbereiche erstreckt: Die Globalisierung, deren Auswirkungen in unserer vernetzten Welt deutlich spürbar sind. Inmitten dieser Prozesse stehen die Staaten, welche neue Herausforderungen meistern müssen. Zahlreiche Faktoren führen zu einem Wandel der Staatlichkeit, doch Globalisierung stellt die aktuell relevanteste Ursache dar. Die heutige Politik ist geprägt von globalen Kooperationen und der Mitwirkung supranationaler Institutionen. Unsere vielschichtige und schnelllebige Zeit verlangt den Staaten viel Flexibilität ab, weltweite Vernetzungen verändern die Handlungsweisen von Staaten. Die politische Mitwirkung nicht staatlicher Akteure stellt Staaten vor gänzlich neue Herausforderungen und lässt zuweilen sogar an der zukünftigen Existenz von Nationalstaaten zweifeln. Somit ist es relevanter denn je, die aktuelle Situation einzelner Staaten sowie deren mögliche Zukunft näher zu betrachten.
Der erste Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung von Staatlichkeit und zeigt auf, welche Aspekte den modernen Staat beeinflussen. Im folgenden Teil werden die Globalisierung und deren Einfluss auf Nationalstaaten thematisiert. Dabei wird auch auf ökonomische Faktoren und Verhaltensstrategien der Staaten eingegangen. Danach beschäftigt sich die Arbeit mit der konkreten Entwicklung von Nationalstaaten, bevor aufgezeigt wird, wie sich die Bedeutung von Grenzen wandelt. Der letzte Teil gibt einen Einblick in das Konzept von Global Governance, mithilfe dessen globale Handlungsalternativen aufgezeigt werden, die alle globalen Strukturen, Ebenen und Akteure umfassen.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Staatlichkeit als Ausgangsbasis
- I. Das Wesen von Staatlichkeit
- II. Von der Notwendigkeit der Verfassungen
- C) Der moderne Staat und seine Entwicklung
- I. Herausforderung Globalisierung
- II. Die Rolle des Staates in Zeiten der Globalisierung
- III. Der Bezug zur Europäischen Union
- IV. Ökonomie als Antrieb der Globalisierung
- V. Anpassung oder Autarkie?
- D) Abkehr vom Nationalstaat?
- E) Deterritorialisierung als Begleiterscheinung moderner Staatlichkeit
- F) Global Governance als mögliche Zukunftsperspektive
- G) Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Arbeit untersucht den Einfluss von Globalisierungsprozessen auf die Staatlichkeit. Sie analysiert die Rolle des Nationalstaates in globalen Strukturen und beleuchtet Handlungsoptionen für zukünftige Herausforderungen. Dabei wird der Fokus auf die Verbindung zur Europäischen Union gelegt.
- Das Wesen und die Elemente der Staatlichkeit
- Die Herausforderungen der Globalisierung für die Staatlichkeit
- Die Rolle des Staates in Zeiten der Globalisierung
- Die Entwicklung von Nationalstaaten im Kontext der Globalisierung
- Global Governance als mögliches Konzept für die Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A) stellt die Relevanz der Globalisierung und deren Einfluss auf die Staatlichkeit dar. Kapitel B) beschäftigt sich mit dem Wesen der Staatlichkeit, den Einflussfaktoren und der Bedeutung der Verfassungen. In Kapitel C) werden die Herausforderungen der Globalisierung für die Staatlichkeit und die Rolle des Staates in diesen Prozessen beleuchtet. Kapitel D) untersucht die Entwicklung von Nationalstaaten im Kontext der Globalisierung. Kapitel E) befasst sich mit der Deterritorialisierung als Begleiterscheinung der modernen Staatlichkeit. Schließlich wird in Kapitel F) Global Governance als mögliches Konzept für die Zukunft vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Staatlichkeit, Globalisierung, Nationalstaat, Europäische Union, Global Governance, Deterritorialisierung, supranationale Institutionen, Handlungsoptionen und Zukunftsperspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert die Globalisierung die moderne Staatlichkeit?
Die Globalisierung führt zu einer stärkeren Vernetzung, globalen Kooperationen und dem Einfluss nicht-staatlicher Akteure, was die Handlungsspielräume nationaler Regierungen verändert.
Was bedeutet Global Governance?
Global Governance ist ein Konzept für globale Handlungsalternativen, das alle Ebenen und Akteure (staatlich und supranational) umfasst, um weltweite Herausforderungen gemeinsam zu lösen.
Welche Rolle spielt die EU für den Nationalstaat in der Globalisierung?
Die Europäische Union dient als Beispiel für die Verlagerung staatlicher Kompetenzen auf eine supranationale Ebene, um in einer globalisierten Welt handlungsfähig zu bleiben.
Was ist Deterritorialisierung?
Deterritorialisierung beschreibt den Bedeutungswandel von Staatsgrenzen und die Entkopplung von politischem Handeln und festen Territorien im Zuge der Globalisierung.
Ist der Nationalstaat durch die Globalisierung bedroht?
Die Arbeit untersucht, ob die politische Mitwirkung nicht-staatlicher Akteure an der zukünftigen Existenz des klassischen Nationalstaats zweifeln lässt oder ob dieser sich lediglich anpasst.
- Quote paper
- Ines Finkenwirth (Author), 2019, Staatlichkeit im Wandel. Wie handeln Staaten unter dem Einfluss der Globalisierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541617