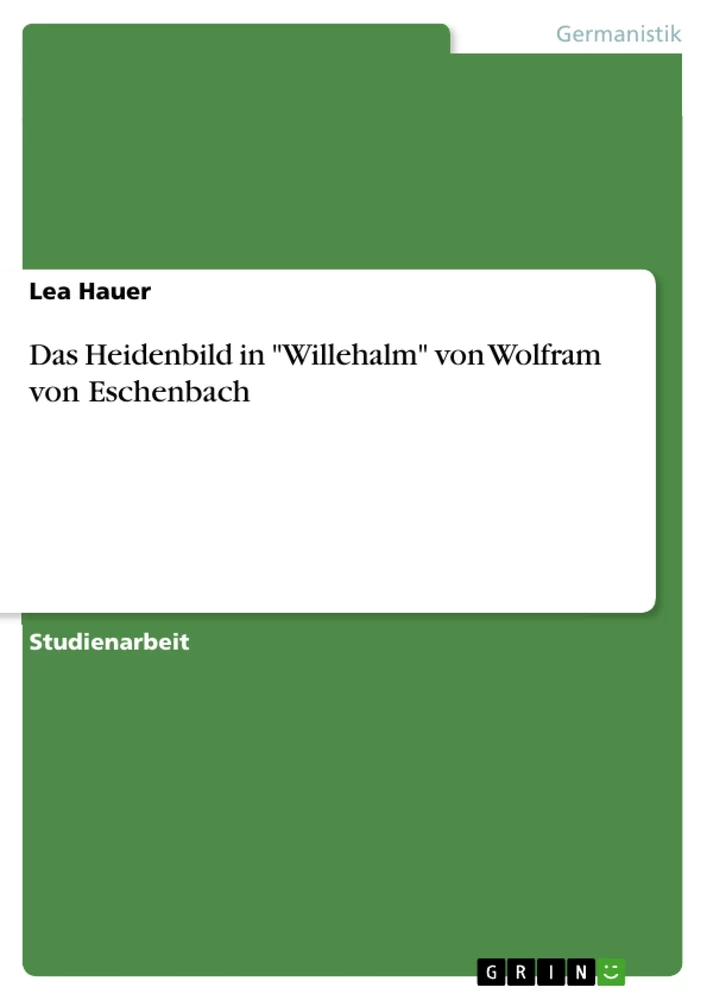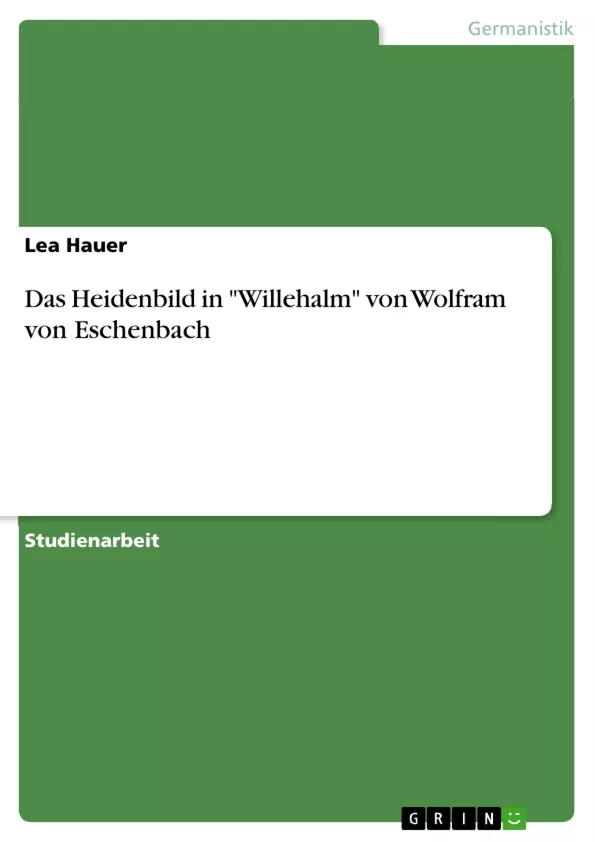Die Arbeit analysiert das Heidenbild in "Willehalm" von Wolfram von Eschenbach. Hierbei wird zunächst auf die allgemeine Darstellung der Heiden eingegangen, wobei ein besonderer Fokus auf die kriegerischen Motive und auf den Glauben der Heiden gelegt wird. Anschließend wird ein tieferer Blick auf das Verhältnis der beiden gegnerischen Fraktionen geworfen. Zusätzlich soll die Wichtigkeit eines christlichen Sakraments, der Taufe, durch ausgewählte Stellen des "Willehalms" verdeutlicht werden. Das Ziel dieser Analyse muslimischer Ritter wird es sein, herauszuarbeiten, ob diese als menschlich, vielleicht sogar den Christen im Kampfe ebenbürtig angesehen werden, obwohl sie nicht demselben Glauben angehören. Wird den Heiden sogar Bewunderung geschenkt oder gilt es bloß, diese andersgläubigen Fremden zu bekämpfen?
Wolfram von Eschenbach schildert in seinem "Willehalm" den kriegerischen Konflikt zwischen Christen und Heiden. Eine endgültige Lösung wurde trotz des Sieges des Christenheeres bis heute nicht gefunden und die Auseinandersetzung zwischen Okzident und Orient hält weiterhin an. Trotz der zeitgeschichtlich brandaktuellen Thematik befassen sich nur zwei Werke der höfischen Epik des deutschen Mittelalters mit den Kreuzzügen und den Kriegen gegen die Andersgläubigen: das "Rolandslied" des Pfaffen Rolands und der "Willehalm" von Wolfram von Eschenbach.
Im erstgenannten herrscht ungebrochene Begeisterung für die Kreuzzüge und den Krieg im Allgemeinen. Das selbst gesetzte Ziel, nämlich die Bekehrung oder gegebenenfalls die Tötung der Heiden, galt es, um jeden Preis zu erreichen. Die Andersgläubigen waren als "Kinder des Teufels" verschrien, womit der Mord an ihnen einen legitimen Rechtfertigungsgrund erhielt. Einen Gegensatz hierzu bietet Wolframs Protagonist Willehalm, er betrachtet seine heidnischen Gegner weitaus differenzierter. Die Erzählung fällt vor allem durch ihre tolerante Einstellung gegenüber diesen auf, was für die Entstehungszeit des Werkes äußerst ungewöhnlich ist. Während im "Rolandslied" die muslimischen Krieger durchgehend als gottlos und verdammt beschrieben werden, zeichnet Wolfram ein Bild eines den Christen ebenbürtigen Gegners, der nach einem Wertekodex handelt, der dem christlichen in vielen Belangen ähnlich ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Darstellung der Heiden im Willehalm.
- 2.1 Heidenbegriff und Heidnischer Glaube
- 2.2 Kriegsmotive der Heiden
- 3. Verhältnis von Heiden und Christen
- 3.1 Wertungen der Heiden durch den Erzähler
- 3.2 Die Taufe als Trennung zwischen Heiden und Christen
- 4. Spezifische Heidenporträts
- 4.1 Terramer - der ideale Feldherr
- 4.2 Rennewart – ein heidnischer Kämpfer fürs christliche Heer
- 4.3 Arofel – ein gütiger Krieger?
- 5. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Heidenbild, welches Wolfram von Eschenbach in seinem Werk Willehalm beschreibt. Der Fokus liegt auf der allgemeinen Darstellung der Heiden, deren kriegerischen Motiven und Glauben. Darüber hinaus wird das Verhältnis von Heiden und Christen beleuchtet und die Bedeutung der Taufe im Kontext des christlichen Glaubens und der heidnischen Andersgläubigkeit hervorgehoben. Die Arbeit untersucht auch spezifische Heidenporträts, um zu ergründen, ob diese als menschlich und den Christen ebenbürtig dargestellt werden.
- Das Heidenbild im Willehalm
- Kriegerische Motive der Heiden
- Das Verhältnis von Heiden und Christen
- Die Bedeutung der Taufe
- Spezifische Heidenporträts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Willehalm und die Rolle der Kreuzzüge in der höfischen Epik des Mittelalters vor. Es wird der Gegensatz zwischen der stark pro-Kreuzzug-Haltung des Rolandslieds und Wolframs toleranterer Sichtweise auf die Heiden herausgestellt.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der allgemeinen Darstellung der Heiden im Willehalm. Der Begriff "Heide" im Mittelalter wird erörtert, wobei die Bedeutung des Wortes "fremde" im Kontext der damaligen Zeit beleuchtet wird. Der Fokus liegt auf dem heidnischen Glauben, der im Vergleich zum christlichen Glauben dargestellt wird. Die Kriegsmotive der Heiden werden ebenfalls untersucht, wobei ihre Liebe zu ihren Frauen und ihre Loyalität zu ihren Verwandten hervorgehoben werden.
Kapitel 3 analysiert das Verhältnis von Heiden und Christen im Willehalm. Es wird die Wertung der Heiden durch den Erzähler und die Bedeutung der Taufe als Trennlinie zwischen den beiden Fraktionen beleuchtet. Die unterschiedlichen Motivlagen und Wertevorstellungen beider Seiten werden einander gegenübergestellt.
Kapitel 4 widmet sich spezifischen Heidenporträts. Es werden drei zentrale Charaktere - Terramer, Rennewart und Arofel - vorgestellt und ihre Rolle in der Erzählung analysiert. Durch die Darstellung dieser Figuren wird das komplexe Verhältnis zwischen Christen und Heiden weiter beleuchtet.
Schlüsselwörter
Heidenbild, Willehalm, Wolfram von Eschenbach, Kreuzzüge, höfische Epik, Mittelalter, Heidenbegriff, Heidnischer Glaube, Kriegsmotive, Verhältnis von Heiden und Christen, Taufe, spezifische Heidenporträts, Terramer, Rennewart, Arofel
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Heiden in Wolfram von Eschenbachs „Willehalm“ dargestellt?
Wolfram zeichnet ein ungewöhnlich tolerantes Bild; die Heiden werden als den Christen ebenbürtige Ritter dargestellt, die nach einem ähnlichen Wertekodex handeln.
Was unterscheidet den „Willehalm“ vom „Rolandslied“?
Während das Rolandslied Heiden als „Kinder des Teufels“ verteufelt, betrachtet Willehalm seine Gegner differenzierter und erkennt ihre Menschlichkeit an.
Welche Bedeutung hat die Taufe im Werk?
Die Taufe fungiert als zentrale Trennlinie zwischen Christen und Heiden, wobei die Arbeit untersucht, wie dieses Sakrament die Zugehörigkeit definiert.
Wer sind die zentralen heidnischen Figuren in der Analyse?
Die Arbeit analysiert Terramer (den idealen Feldherrn), Rennewart (einen heidnischen Kämpfer für die Christen) und Arofel.
Welche Kriegsmotive haben die heidnischen Ritter?
Ihre Motive sind oft persönlich geprägt, wie die Liebe zu ihren Frauen und die Loyalität gegenüber ihrer Verwandtschaft, was sie menschlich greifbar macht.
- Citar trabajo
- Lea Hauer (Autor), 2020, Das Heidenbild in "Willehalm" von Wolfram von Eschenbach, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542146