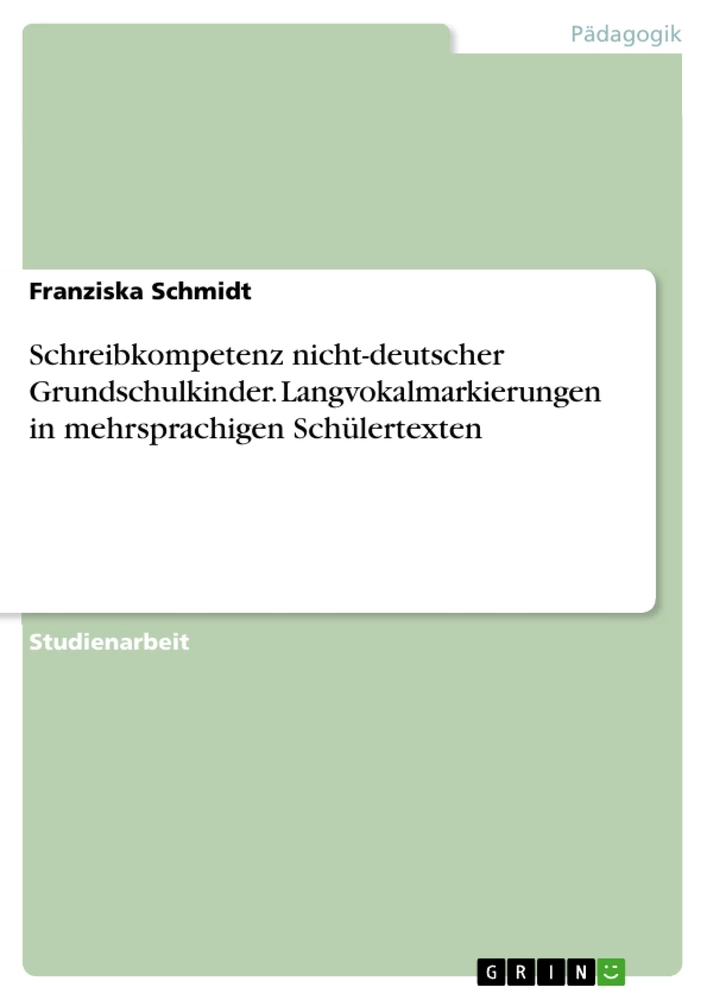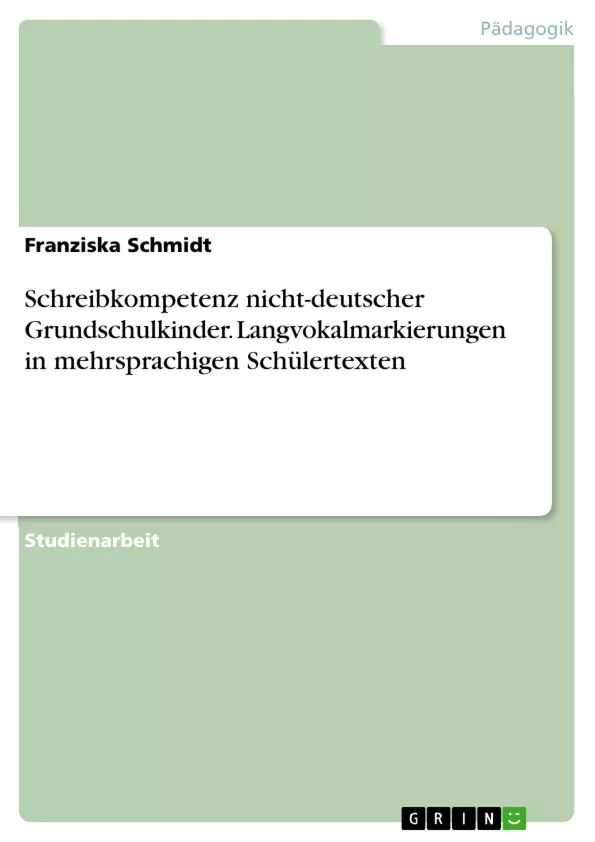In der Untersuchung soll die Schreibkompetenz in Grundschuljahren in einem mehrsprachigen, kindlichen Erwerbskontext untersucht werden. Hierbei wird die Problematik der Langvokalrealisierungen untersucht, wobei ein Fokus auf den Erstsprachen der SchülerInnen liegt, und Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Feldern stellen das Thema der hier getätigten Analyse dar.
Schriftsprache und Lesekompetenz als schriftsprachliche Kompetenzen werden in der Schule gelehrt. Sie sind ausschlaggebend für schulische Entwicklung und berufliche Werdegänge. Literale Strukturen sind demnach immer auch zukunftsorientierte Voraussetzungen für Erfolg im Bildungssystem. Hieraus lässt sich ableiten, dass der Erwerb dieser Kompetenzen einen wichtigen Untersuchungsgegenstand der Linguistik darstellt, um dahingehenden Probleme aufzuzeigen und weiterführend zu lösen.
Die Anforderungen an Lernende aller Erstsprachen im deutschen Schulsystem ist unter anderem das Erlernen der Orthografie. Hierbei bilden etwa 40 Phoneme um die 30 Grapheme ab, die dann die deutsche, lautorientierte Alphabetschrift abbilden. Das erste und zweite Schuljahr ist hierbei besonders auffallend, was die Entstehung von Schreib- und Lesekompetenzen betrifft. Insbesondere die Schreibkompetenz stellt in den Grundschuljahren eine große Herausforderung dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Korpus
- Untersuchungsgruppe
- Theoretischer Rahmen
- Vokalsysteme
- Ergebnisse
- Diskussion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Untersuchung analysiert die Realisierung von Langvokalmarkierungen in Schülertexten mit unterschiedlichen Erstsprachen (Türkisch, Russisch, Deutsch). Ziel ist es, herauszufinden, ob und in welchem Umfang die Erstsprache Einfluss auf die korrekte oder fehlerhafte Verschriftlichung von Langvokalen (Dehnungs-h und Dehnungs-e vor i) hat.
- Einfluss der Erstsprache auf die Verschriftlichung von Langvokalen
- Untersuchung von korrekter, fehlerhafter und übergeneralisierter Langvokalmarkierung
- Analyse von Dehnungs-h und Dehnungs-e vor i in Schülertexten
- Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Erstsprachgruppen
- Abgrenzung von Interferenzfehlern und typischen Entwicklungsphänomenen im Spracherwerb
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz von Schriftsprache und Lesekompetenz für schulische und berufliche Entwicklung heraus und definiert Langvokalmarkierungen im Deutschen.
- Fragestellung: Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, wie SchülerInnen mit unterschiedlichen Erstsprachen Langvokale verschriftlichen, und ob sich Interferenzeffekte der Erstsprache auf die Langvokalmarkierung feststellen lassen.
- Korpus und Untersuchungsgruppe: Die Arbeit verwendet den Osnabrücker Bildergeschichtenkorpus als Datengrundlage und beschreibt die Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe mit den jeweiligen familiären und sprachlichen Hintergründen der SchülerInnen.
- Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel erläutert den Orthografieerwerb und die verschiedenen Theorien zu Interferenz im mehrsprachigen Spracherwerb. Im Fokus steht der Vergleich der Vokalsysteme von Deutsch, Türkisch und Russisch.
- Ergebnisse: Die Ergebnisse der manuellen Analyse der Schülertexte bezüglich der Langvokalmarkierungen werden vorgestellt. Dabei wird die Häufigkeit von Fehlrealisierungen, korrekten Schreibungen und Übergeneralisierungen in den einzelnen Erstsprachgruppen verglichen.
- Diskussion: Die Ergebnisse werden diskutiert und die Hypothese bezüglich der Interferenzeffekte der Erstsprachen auf die Langvokalmarkierung im Deutschen bewertet.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Spracherwerb, Zweitspracherwerb, Orthografie, Langvokalmarkierung, Dehnungs-h, Dehnungs-e, Interferenz, Vokalsystem, Türkisch, Russisch, Deutsch, Osnabrücker Bildergeschichtenkorpus.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat die Erstsprache auf das Erlernen der deutschen Rechtschreibung?
Die Untersuchung zeigt, dass Unterschiede in den Vokalsystemen der Erstsprachen (z. B. Türkisch oder Russisch) zu spezifischen Schwierigkeiten bei der Markierung von Langvokalen im Deutschen führen können.
Was sind Langvokalmarkierungen im Deutschen?
Dazu gehören orthografische Mittel wie das Dehnungs-h (z. B. „Stahl“) oder das Dehnungs-e nach i (z. B. „Liebe“), um die Länge eines Vokals zu kennzeichnen.
Was ist der Osnabrücker Bildergeschichtenkorpus?
Es handelt sich um eine Sammlung von Schülertexten, die als Datengrundlage dient, um die Schreibentwicklung von Kindern mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen zu analysieren.
Was versteht man unter „Übergeneralisierung“ in der Rechtschreibung?
Schüler wenden eine gelernte Regel (z. B. das Dehnungs-h) auch dort an, wo sie orthografisch nicht korrekt ist (z. B. „faren“ statt „fahren“ oder fälschlich „Sahl“ statt „Salat“).
Warum ist die Schreibkompetenz in der Grundschule so entscheidend?
Schriftsprachliche Kompetenzen sind die Basis für den gesamten Bildungsweg und den späteren beruflichen Erfolg; Defizite in den ersten Schuljahren können langfristige Folgen haben.
- Quote paper
- Franziska Schmidt (Author), 2020, Schreibkompetenz nicht-deutscher Grundschulkinder. Langvokalmarkierungen in mehrsprachigen Schülertexten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542482