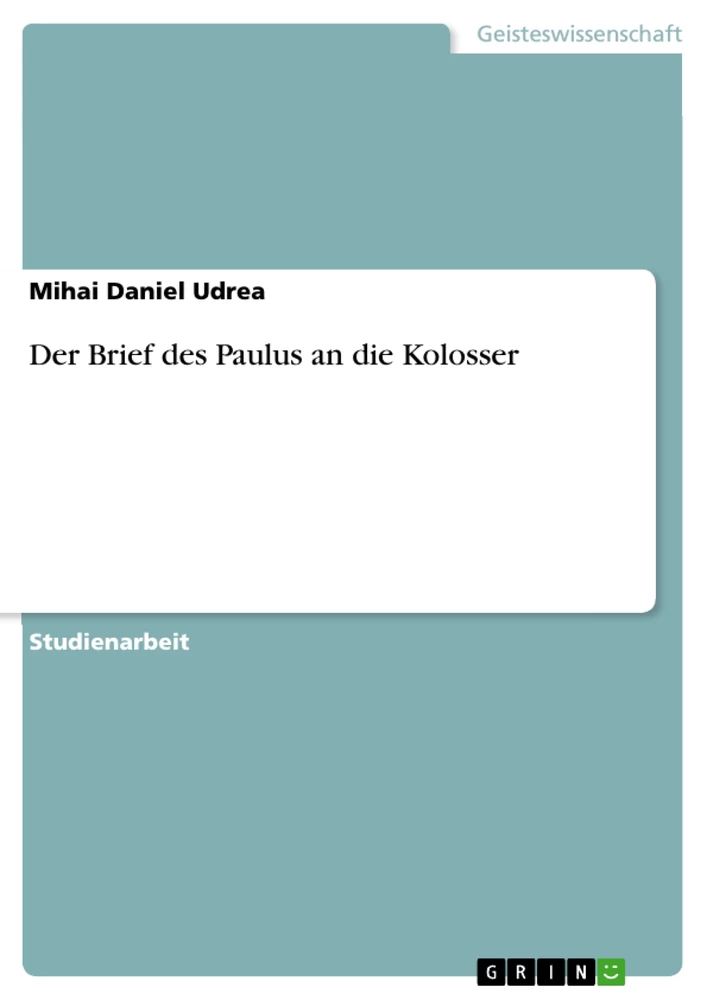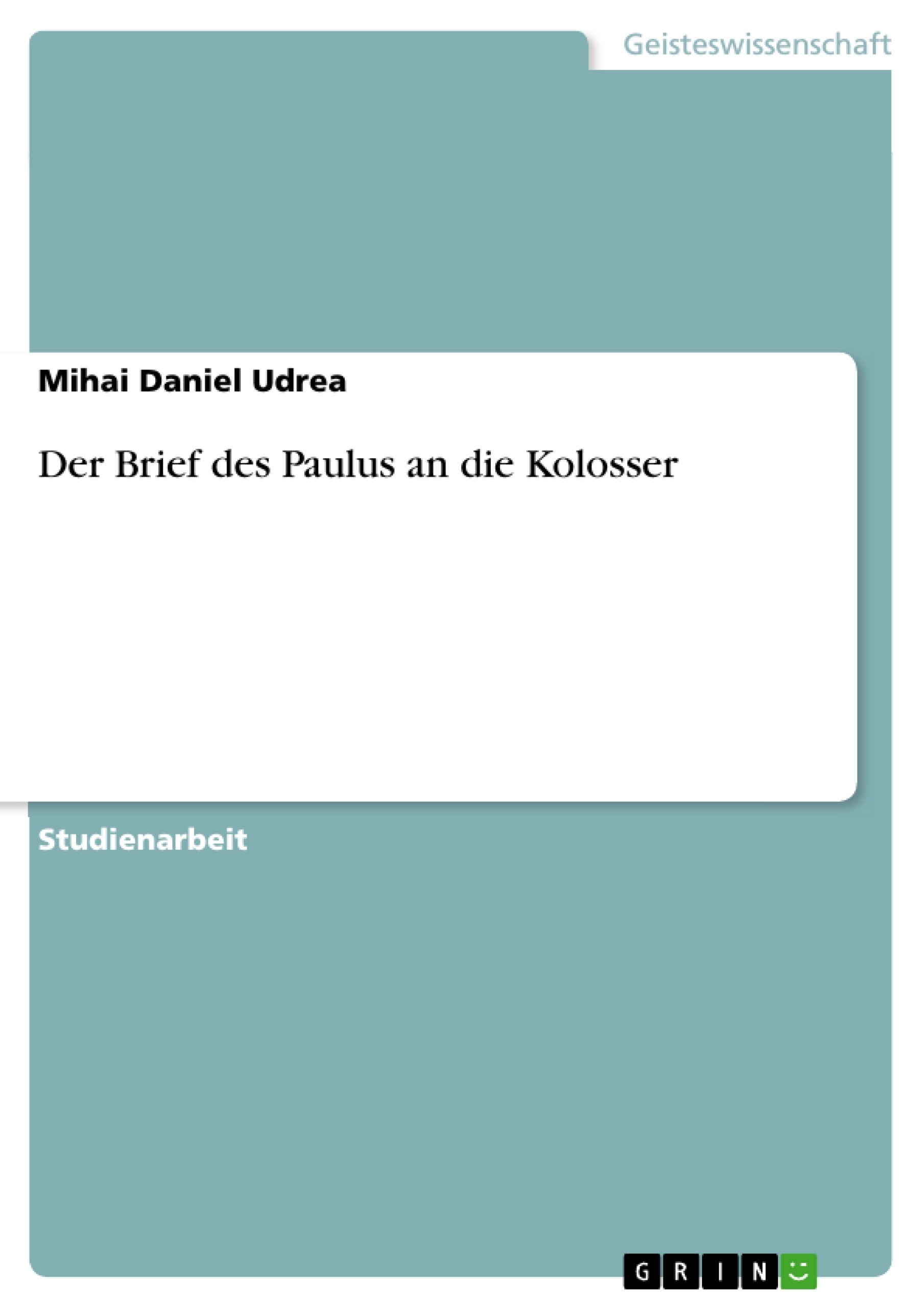Wie jeder Brief im Neuen Testament, hat auch der Brief des Paulus an die Kolosser einen besonderen und eigenen Charakter, Bedeutsamkeit und schließlich eine eigene Geschichte, sodass das Anliegen des Kolosserbriefs einerseits, die Einzigartigkeit des Christentums versus andere Irrlehren betont, und andererseits über das rechte Leben der Christen als Wahrung der Tradition predigt. Die vier Kapitel des Kolosserbriefs weisen jedoch, neben dieser Thematisierung, eine gewisse Ähnlichkeit mit den Römerbrief und besonders mit dem Epheserbrief auf, und darüber hinaus unterscheidet sich der Sprachstil und die Gedankenführung des Kolosserbriefs von dem der authentischen paulinischen Briefe. Dieses führt zu Fragen der Herkunft und des Entstehungsverhältnisses, der theologischen Themen und Schwerpunkte welche sich in den Kolosserbrief darstellen, und anderen Fragen, die zur Klärung bedürfen. Somit ist Ziel dieser Arbeit, einen kurzen inhaltlichen und einleitungswissenschaftlichen Überblick zu gewähren um anschließend die Streitfragen unter die Lupe zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitendes
- Einleitende Annäherung
- II. Kolosserbrief
- Der Kolosserbrief
- III. Konklusionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, einen kurzen inhaltlichen und einleitungswissenschaftlichen Überblick über den Kolosserbrief zu geben und anschließend die umstrittenen Punkte zu beleuchten.
- Herkunft und Entstehung des Kolosserbriefs
- Theologische Themen und Schwerpunkte
- Kritik an Irrlehren im Kolosserbrief
- Der Christushymnus und seine Bedeutung
- Die Paränese im Kolosserbrief
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitendes
Der Kolosserbrief, wie jeder Brief im Neuen Testament, hat seinen eigenen Charakter, Bedeutung und Geschichte. Er betont einerseits die Einzigartigkeit des Christentums im Vergleich zu anderen Irrlehren, andererseits predigt er das rechte Leben der Christen als Wahrung der Tradition. Die vier Kapitel des Kolosserbriefs weisen trotz dieser Themen Ähnlichkeiten zum Römerbrief und insbesondere zum Epheserbrief auf. Allerdings unterscheidet sich der Sprachstil und die Gedankenführung des Kolosserbriefs von denen der authentischen paulinischen Briefe, was zu Fragen der Herkunft, des Entstehungsverhältnisses, der theologischen Themen und Schwerpunkte führt, die geklärt werden müssen.
II. Kolosserbrief
Der Kolosserbrief ist in der ältesten Paulusbriefsammlung (P 46, Ende 2. Jh.) und in den großen Bibelhandschriften des 4. und 5. Jh. (Sinaitikus, Vatikanus B etc.) enthalten. Der Brief ist kunstvoll geschrieben und klar abgegrenzt. Der Briefrahmen umfasst das Präskript (Kol 1,1 -1,2), das die Absenderangabe (Superscriptio), die Adressatenangabe (Adscriptio) und den Gruß (Salutatio) beinhaltet. Die Superscriptio ist durch Paulus und Timotheus gekennzeichnet: „Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Bruder Timotheus.“ Die Adscriptio ist in Kol 1,2 gegeben: „(...) an die Heiligen in Kolossä, die gläubigen Brüder in Christus“. Der Brief ist also an die christliche Gemeinde in Kolossä gerichtet. Paulus kannte diese Gemeinde nicht persönlich (Kol 2,1). Die Salutatio erscheint in einer Kurzform: „Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater!“.
Aufgrund der Besonderheiten, die der Kolosserbrief gegenüber den eindeutig zugeschriebenen Briefen aufweist, wird angenommen, dass der Brief nicht von Paulus verfasst wurde, sondern vielmehr ein deuteropalinisches bzw. pseudepigraphisches Schriftstück darstellt. Dieser Brief stammte wahrscheinlich von einem Schüler des Paulus, der andere Paulusbriefe als Vorlage nutzte (Philemonbrief, Römerbrief). Die Sätze im Kolosserbrief sind deutlich länger als in anderen Paulusbriefen, die Empfänger werden mit der Bezeichnung „Geschwister“ angeredet (in den anderen Briefen nicht), die Gedankenführung unterscheidet sich von den authentischen Briefen, und die theologische Begrifflichkeit zeigt, dass diese an manchen Stellen weiterentwickelt wurde. Der Brief wurde nach dem Tod des Paulus, um das Jahr 70, geschrieben. Es wird vermutet, dass der Brief in Ephesus entstanden ist, wo man die Paulusschule vermutete. Die Gemeinde in Kolossä ist dem Paulus nicht persönlich bekannt, er kennt sie nur vom Hören. Paulus wird als Gefangener dargestellt, der trotz seines Elends ein lebendiges Interesse am Christus-Evangelium und der Kirche hat. Das Gefangenschaftsmotiv wurde aus dem Philemonbrief übernommen, der de facto ein echter paulinischer Gefangenschaftsbrief ist.
Der Briefkorpus (Kol 1,3 – 4,6) beinhaltet das Proömium (Kol 1,3-11), die Darlegung des thematischen Inhalts bzw. die Auseinandersetzung mit der >>Philosophie<< (1,12 -2,23) und die Paränese (Kol 3,1 – 4,1).
In der Danksagung/Proömium dankt der Verfasser für den Glauben der Gemeinde. Das Evangelium wurde von Epaphras verkündet und die Gemeinde hat das wahre Evangelium richtig empfangen. Das Evangelium trägt jetzt Früchte; Stichwörter an dieser Stelle lauten: Glaube, Liebe und Hoffnung (Kol 1,4 -1,5). Das Proömium schließt mit einer Fürbitte, die sich auf die völlige Erkenntnis des Willens Gottes durch die Gemeinde richtet und ein dem Herrn würdiges Leben der Christen propagiert.
Die Auseinandersetzung mit der >>Philosophie<< (Kol 1,12-2,23) legt folgende Punkte dar: Grundlegung des Christus-Hymnus (Kol 1,12-23), die Anwendung des Hymnus auf die Gemeinde und die heilsgeschichtliche Funktion des Apostels in Verbindung mit den Geschehen der Offenbarung (Kol 1,24 – 2,5) und die Kritik der Irrlehre und die Warnung vor der Irrlehre (Kol 2,6-23). Der Christushymnus ist quasi ein Lobpreis Christi, der folgende Aussagen bekräftigt: Christus ist der Schöpfermittler und Versöhner der Menschen mit Gott, und Christus ist der Erste in Schöpfung und Erlösung. Das Heilswerk Christi dehnt sich auf den gesamten Kosmos aus, alles besteht durch Ihm (Kol 1,15-16) und Er ist >>vor allem<<.
Die Bedeutung des Christushymnus für die Gemeinde wird dargestellt, und die heilsgeschichtliche Funktion des Apostels in Verbindung mit den Geschehen der Offenbarung wird aufgezeigt (Kol 1,24 -2,5). An dieser Stelle vergleicht man Paulus’ leidende Existenz als Apostel mit dem Evangelium vom Kreuz. Paulus wurde von Gott zu den Heiden gesandt. Die Leiden des Apostels sollen die Gemeinde stärken. Die Kolossergemeinde soll in Liebe zusammenhalten und Einsicht in das göttliche Geheimnis haben, welches Christus ist.
Die Darlegung der Irrlehre und die Warnung vor der Irrlehre wird in Kol 2,6-23 angesprochen.
Die Paränese (Kol 3,1 – 4,1) kann man wie folgt untergliedern:
- die christologische Begründung der Paränese (Kol 3,1 -4)
- Tugend- und Lasterkataloge, allgemeine Mahnungen (Kol 3,5 -17)
- Haustafel (Kol 3,18 -4,1)
Der Verfasser beginnt die Paränese mit einer kurzen theologischen Grundlegung, indem er die Auferweckung mit Christus durch die Taufe betont und zeigt, dass gleichzeitig ein Streben nach den himmlischen Dingen entsteht, denn die Offenbarung des Lebens der Christen erfolgt erst mit der Offenbarung Christi.
Die Adressaten sollen alles Irdische an sich >>töten<<, um nicht den Zorn Gottes herauszufordern. Sie sollen nicht vergessen, dass sie neugeboren sind, also zu neuen Menschen geworden sind, und sollen somit auch entsprechend leben. Eine ähnliche Aussage wird auch im Galaterbrief bekräftigt: „, Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.\" (Gal 3,28)
Die Haustafel, welche die Paränese abschließt, richtet sich an die paarweise zugeordneten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Fokusthemen des Kolosserbriefs umfassen die Einzigartigkeit des Christentums, Irrlehren, das rechte Leben der Christen, der Christushymnus, die heilsgeschichtliche Funktion des Apostels, die Paränese und die Haustafel.
- Quote paper
- Mihai Daniel Udrea (Author), 2019, Der Brief des Paulus an die Kolosser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542680