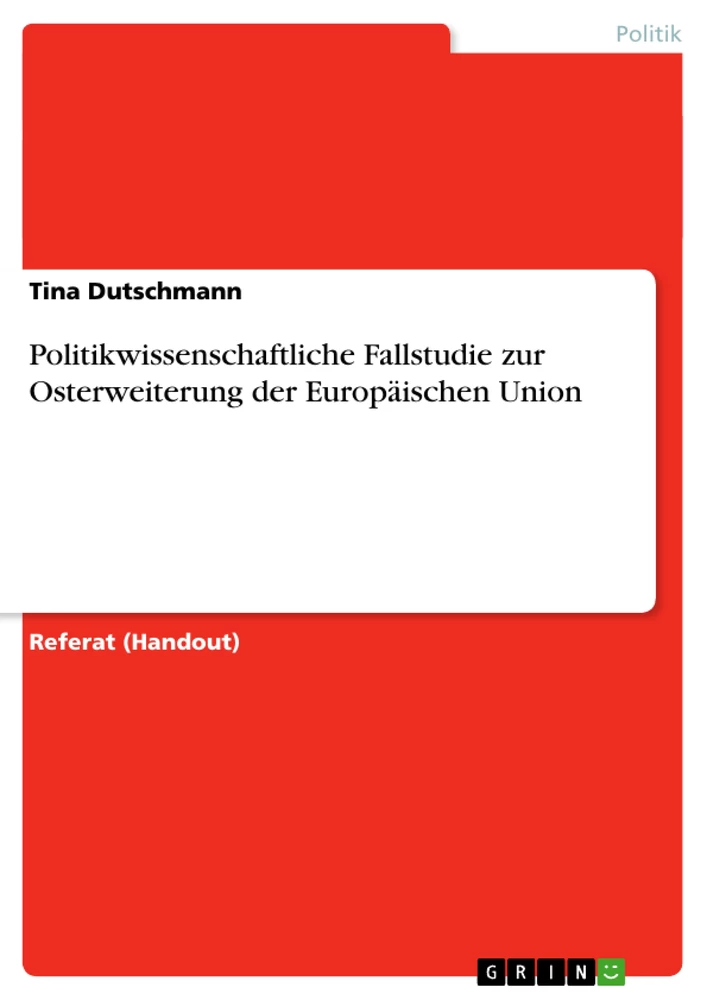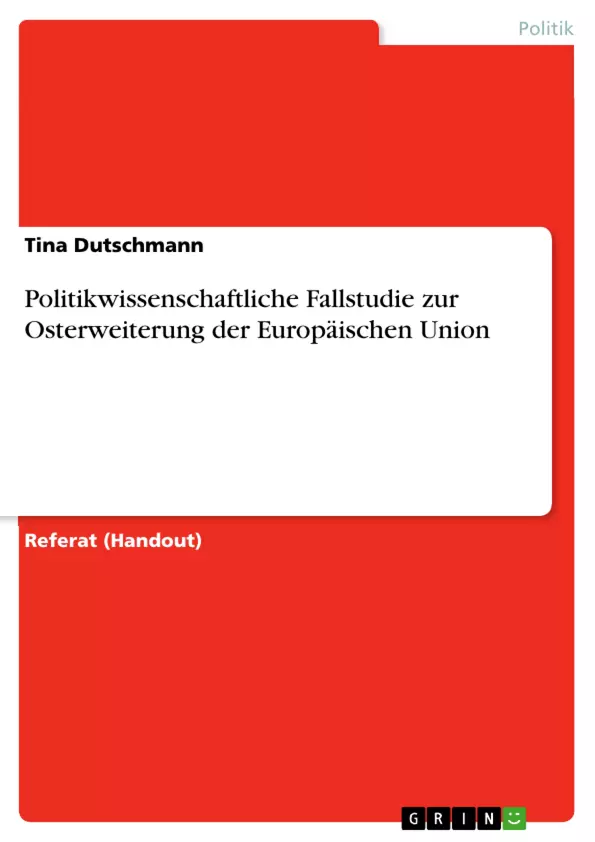1. Einleitung
In unserem Referat soll die Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten für eine Erweiterung der Union um mittel- und osteuropäische Länder (MOEL) aus der Sicht und mit Hilfe der vier Denkschulen der Internationalen Beziehungen erklärt werden.
Unser Explanandum lautet also: Warum beschließt die EU eine Osterweiterung, obwohl ihnen bekannt ist, dass es auch Verlierer unter den Alt-EU-Mitgliedern geben wird.
Wie wir bereits wissen, filtert die IB aus den einzelnen Theorien die Teilerklärungen einer komplexen Wirklichkeit heraus, um so die besten Ergebnisse erzielen zu können. Aus diesem Grund werden wir wie folgt vorgehen:
1. Analyse anhand jeder einzelnen der vier Denkschulen
2. Vergleich der Erklärungskraft
Die EU-Osterweiterung stellt einen regulierten Konflikt dar, d.h. dieser ist zwar geregelt, aber
die Unvereinbarkeit bleibt.
Folgende Konfliktpunkte gibt es:
· Fragen der Sicherheits- und Außenpolitik
· Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Angleichung der verschiedenen Staaten
· Eine EU-Osterweiterung würde das bisherige Agrarsystem der EU sprengen. Die nach den Regeln der geltenden Praxis zu zahlenden Subventionen würden in unrealistische Höhen schnellen ? Reform notwendig
· Das niedrige Lohnniveau in den Beitrittsländern könnte den Markt der EU mit konkurrenzlosen Billigprodukten überschwemmen.
· Einige Altmitglieder der EU befürchten eine politische und wirtschaftliche Stärkung (mehr als bisher) für die BRD aufgrund der geografischen Lage ? BRD rückt die in die Mitte der EU
· Griechenland oder Portugal sind nicht ohne weiteres bereit, die ihnen zustehenden Hilfen aus dem EU-Haushalt mit mehreren noch ärmeren Staaten zu teilen.
· Die Institutionen und das Entscheidungssystem der EU, zunächst auf sechs Mitgliedstaaten zugeschnitten, wäre in der jetzigen Form einer Integration von etwa 25 oder mehr Staaten nicht gewachsen ? Reform notwendig und dennoch kooperativer Konfliktaustrag
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der realistische Ansatz
- Der institutionalistische Ansatz
- Der liberalistische Ansatz
- Der konstruktivistische Ansatz
- Vergleichende Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese politikwissenschaftliche Fallstudie befasst sich mit der Osterweiterung der Europäischen Union und analysiert die Motivation der EU-Mitgliedstaaten für die Aufnahme von mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) unter Verwendung der vier Denkschulen der Internationalen Beziehungen.
- Die Erklärung der EU-Osterweiterung aus Sicht der vier Denkschulen der Internationalen Beziehungen
- Analyse der Konfliktpunkte im Kontext der Osterweiterung, wie z.B. Sicherheits- und Außenpolitik, Finanzierung der Angleichung und wirtschaftliche Auswirkungen
- Bewertung der Erklärungskraft der verschiedenen Denkschulen im Hinblick auf die Osterweiterung
- Untersuchung der Rolle von Institutionen und Entscheidungssystemen der EU im Kontext der Erweiterung
- Bewertung der Auswirkungen der Osterweiterung auf die EU und die Beitrittsländer
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Explanandum der Studie vor: Warum beschließt die EU eine Osterweiterung, obwohl es auch Verlierer unter den Alt-EU-Mitgliedern geben wird?
Der realistische Ansatz
Dieses Kapitel untersucht die EU-Osterweiterung aus Sicht des Realismus. Es analysiert die Hypothese, dass die EU sich aus machtpolitischen Gründen erweitert, um eine Machtbasis gegen die USA zu erhalten. Der realistische Ansatz kann jedoch nicht vollständig erklären, warum es zur EU-Osterweiterung kommt.
Der institutionalistische Ansatz
Dieses Kapitel widmet sich der Erklärung der EU-Osterweiterung durch den institutionalistischen Ansatz. Es argumentiert, dass die starke Institutionalisierung des internationalen Systems in Form der EU zu friedlicher Kooperation mit den osteuropäischen Staaten führt. Der hohe Grad an Institutionalisierung wird als Hauptgrund für die Aufnahme der osteuropäischen Staaten in die EU identifiziert.
Der liberalistische Ansatz
Der liberalistische Ansatz wird in diesem Kapitel vorgestellt und auf die EU-Osterweiterung angewendet. Das Kapitel untersucht, ob die liberale Theorie die Erweiterung der EU aus Sicht von wirtschaftlichen Interessen und dem Streben nach Wohlstand erklären kann.
Der konstruktivistische Ansatz
Das Kapitel analysiert die EU-Osterweiterung aus der Perspektive des konstruktivistischen Ansatzes. Es untersucht die Rolle von Normen, Ideen und Identitäten im Kontext der EU-Erweiterung und wie diese die Entscheidungsprozesse beeinflussen.
Vergleichende Zusammenfassung
Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der vier Denkschulen der Internationalen Beziehungen zusammen und vergleicht deren Erklärungskraft im Hinblick auf die EU-Osterweiterung. Es bewertet die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze und identifiziert die wichtigsten Faktoren, die zur Entscheidung für die Osterweiterung geführt haben.
Schlüsselwörter
Osterweiterung, Europäische Union, Internationale Beziehungen, Realismus, Institutionalismus, Liberalismus, Konstruktivismus, Konflikt, Kooperation, Sicherheitspolitik, Wirtschaftspolitik, Integration, Institutionen, Entscheidungssysteme, MOEL, Alt-EU-Mitgliedstaaten, Gewinnverteilung, Machtbasis, Institutionalisierung, Normen, Ideen, Identitäten.
Häufig gestellte Fragen
Warum beschließt die EU die Osterweiterung trotz möglicher Nachteile?
Die Studie untersucht diese Frage anhand von vier Denkschulen der Internationalen Beziehungen, um zu erklären, warum die Vorteile oder systemischen Zwänge die Befürchtungen der Alt-Mitglieder überwogen.
Welche Denkschulen der Internationalen Beziehungen werden herangezogen?
Die Analyse erfolgt auf Basis des Realismus, Institutionalismus, Liberalismus und Konstruktivismus.
Was sind die zentralen Konfliktpunkte der EU-Osterweiterung?
Wichtige Konfliktfelder sind die Finanzierung der Angleichung, Reformen des Agrarsystems, das niedrige Lohnniveau in Beitrittsländern und notwendige institutionelle Reformen der EU.
Wie erklärt der institutionalistische Ansatz die Erweiterung?
Dieser Ansatz argumentiert, dass die starke Institutionalisierung der EU friedliche Kooperation fördert und den Rahmen bietet, in dem die Aufnahme der osteuropäischen Staaten als logische Folge der Systemregeln erscheint.
Welche Rolle spielen wirtschaftliche Interessen im liberalistischen Ansatz?
Der Liberalismus untersucht, inwieweit das Streben nach Wohlstand und die Erschließung neuer Märkte die Hauptmotive für die Erweiterungsentscheidung waren.
- Citar trabajo
- Tina Dutschmann (Autor), 2002, Politikwissenschaftliche Fallstudie zur Osterweiterung der Europäischen Union, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5426