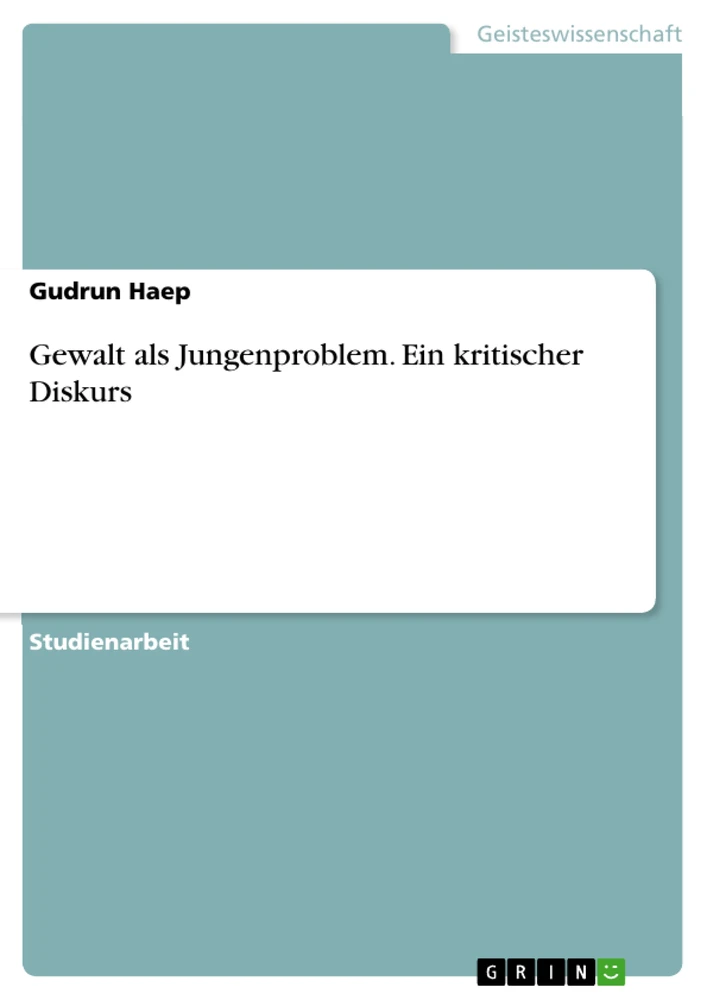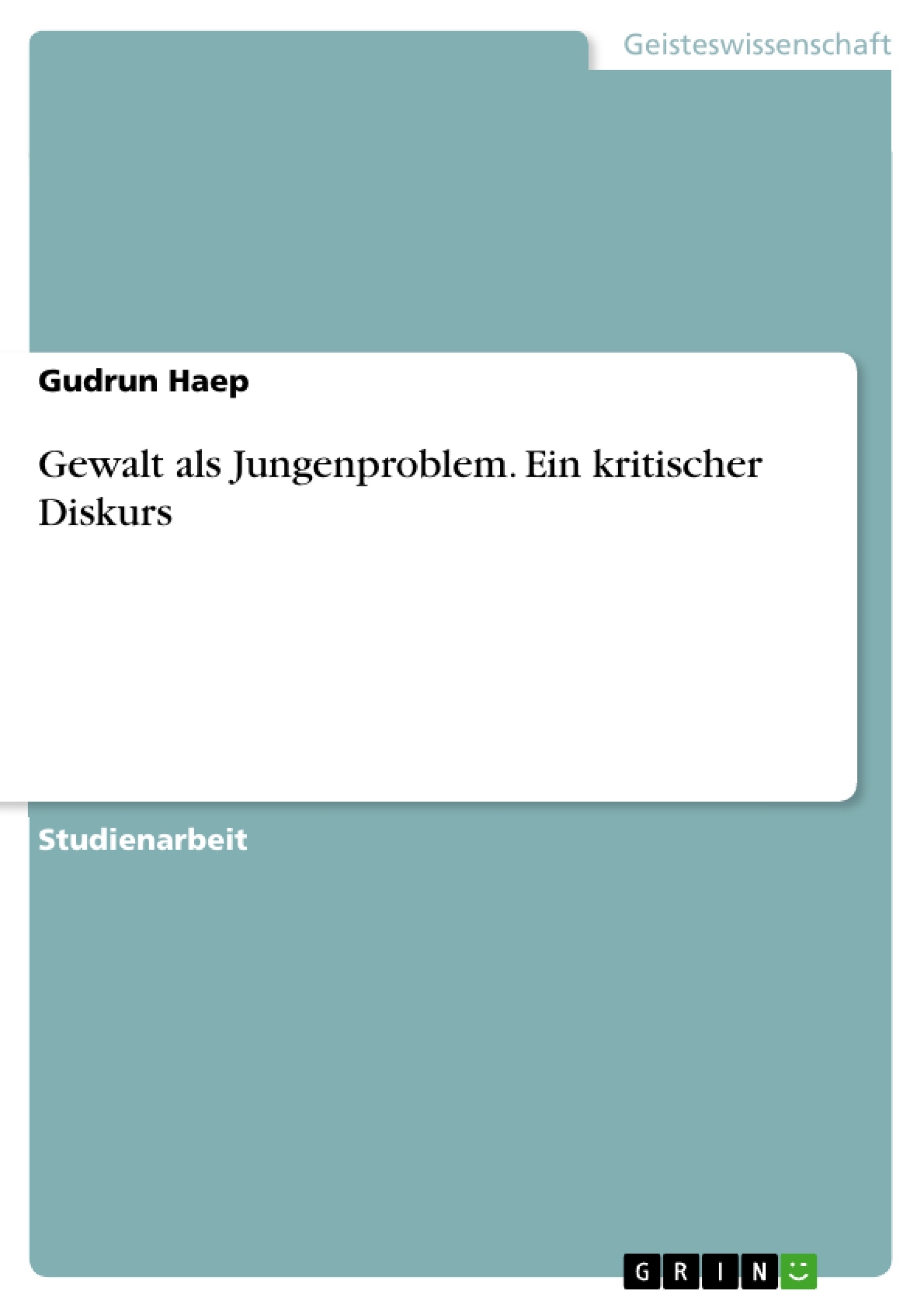In der hier vorliegenden Arbeit wird das Wort Gewalt für Handlungen verwendet, die auf andere, den Handelnden selbst oder Sachen schädigend wirken. Da ein Motor oder Auslöser für Gewalt nach außen gerichtete Aggressionen sein können, werden im Folgenden sowohl Gewalt als auch die negative Konnotation der Aggression untersucht. Christine Buth schreibt in ihrem Beitrag "Jugendgewalt in Deutschland", dass Jugendgewalt überwiegend Jungengewalt ist. Ist Gewalt also ein Jungenproblem?
Nach Wolfgang Melzers und Wilfried Schubarths Beitrag "Gewalt" im "Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen" ist Gewalt ein interdisziplinär, vor allem in den Sozial- und Erziehungswissenschaften sowie in der Kriminologie verwendeter Begriff in Abgrenzung zu benachbarten Termini und Konzepten wie etwa der Aggression.
Nach Scheithauer "Aggressives Verhalten von Jungen und Mädchen" bezeichnet Aggression zunächst keinen exakten wissenschaftlichen Terminus, sondern eher alltagssprachlich Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, einer anderen Person Schaden zuzufügen. Scheithauer zitiert einige Autoren wie Bushman & Anderson, 2001, Green, 1990, Lightdale & Prentice, 1994, Maccoby & Jacklin, 1974, Verres & Sobez, 1980, die den Aggressionsbegriff um das Element erweitern, dass Aggression immer mit psychischer oder körperlicher Schädigung assoziiert wird.
In der Psychologie wird Aggression als wertneutrales Verhalten betrachtet, während mit Gewalt eine negative Schädigungsabsicht verbunden ist. Anders wird zum Beispiel in den Rechtswissenschaften oder der Soziologie Gewalt als Machtbegriffe beschreibender Ober-begriff definiert, während Aggression zumeist mit Schädigungsabsicht verknüpft und entsprechend negativ konnotiert ist. Siehe hierzu auch Mechthild Schäfers Beitrag "Aggression" in "Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Gewalt und Aggression
- Jugendkultur: Jungen und Gewalt aus historischer Sicht
- Halbstarken in der wilhelminischen Zeit
- Verhaltensweisen in der Weimarer Republik
- Jugendkultur in der Bundesrepublik und Westeuropa
- Endogene Risikofaktoren
- Biologisch-genetische Faktoren
- Hormonelle Faktoren
- Entwicklungspsychologische Faktoren
- Sprach- und Lernstörungen als Faktor
- Bewegungsunruhe als Faktor
- Sozialisation in Familie und Institutionen
- Erziehung in der Familie
- Rolle des Vaters
- Rolle von Idolen und Helden
- Rolle der Mutter
- Erziehung in Kita und Schule
- Veränderte Gesellschaft
- Rolle der Medien
- Fehlende Frei-Räume
- Gewalt bei muslimischen Jungen
- ADHS oder Zappelphillipsyndrom
- Mädchengewalt
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Gewalt ein Jungenproblem ist und untersucht verschiedene Faktoren, die zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten bei Jungen beitragen können. Dabei werden sowohl historisch-gesellschaftliche Entwicklungen als auch biologische, psychologische und soziale Einflüsse betrachtet.
- Gewalt als soziales Phänomen
- Historische Entwicklung von Jugendkultur und Gewalt
- Biologische und hormonelle Faktoren
- Psychologische und sozialisationstheoretische Aspekte
- Rolle der Familie, Schule und Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Gewalt und Aggression
Die Einleitung stellt zunächst den Begriff der Gewalt im Vergleich zur Aggression dar und beleuchtet die unterschiedlichen Definitionen in verschiedenen Disziplinen. Sie führt dann die These ein, dass Jugendgewalt überwiegend Jungengewalt ist und stellt die Frage, ob Gewalt tatsächlich ein Jungenproblem ist.
Jugendkultur: Jungen und Gewalt aus historischer Sicht
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung von Jugendkultur und Gewalt in einem historischen Kontext, angefangen von den „Halbstarken“ in der wilhelminischen Zeit bis hin zur modernen Jugendkultur. Es zeigt, wie Gewalt immer wieder als Ausdrucksform von männlicher Jugendlichkeit in Erscheinung trat, und wie sich die Formen und Ursachen im Laufe der Zeit veränderten.
Endogene Risikofakoren
Dieses Kapitel befasst sich mit biologischen und genetischen Faktoren, die als Risikofaktoren für aggressives und gewalttätiges Verhalten bei Jungen gelten können. Dazu zählen die hormonelle Disposition, insbesondere der Einfluss von Testosteron, sowie bestimmte genetische Prädispositionen.
Sozialisation in Familie und Institutionen
Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Sozialisation in der Familie, Kita und Schule als prägende Faktoren für das Verhalten von Jungen. Hier werden insbesondere die Erziehungsformen, die Rolle des Vaters und der Mutter, sowie die Bedeutung von Idolen und Helden betrachtet.
Veränderte Gesellschaft
Dieses Kapitel beleuchtet die Einflüsse einer veränderten Gesellschaft, wie die Rolle der Medien und der Mangel an Freiräumen, auf die Entwicklung von Gewalt bei Jungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Gewalt, Aggression, Jugendkultur, Sozialisation, biologische und hormonelle Faktoren, Erziehung, Familie, Schule, Medien, Geschlechterrollen und männliche Identität.
Häufig gestellte Fragen
Ist Jugendgewalt primär ein Jungenproblem?
Die Arbeit untersucht diese These kritisch und beleuchtet verschiedene biologische, psychologische und soziale Faktoren, die zu diesem Bild beitragen.
Was ist der Unterschied zwischen Gewalt und Aggression?
In der Psychologie gilt Aggression oft als wertneutral, während Gewalt eine negative Schädigungsabsicht beinhaltet. In anderen Disziplinen variieren diese Definitionen.
Welche biologischen Faktoren spielen eine Rolle?
Diskutiert werden hormonelle Einflüsse (wie Testosteron) sowie genetische Prädispositionen, die als endogene Risikofaktoren gelten.
Welchen Einfluss hat die Familie auf das Gewaltpotenzial?
Besonders die Rolle des Vaters, Erziehungsstile und das Vorhandensein von Idolen werden als prägende Faktoren der Sozialisation analysiert.
Gibt es auch gewalttätiges Verhalten bei Mädchen?
Ja, die Arbeit enthält ein Kapitel zur Mädchengewalt, um das Phänomen ganzheitlich im Vergleich zur Jungengewalt zu betrachten.
- Quote paper
- Gudrun Haep (Author), 2019, Gewalt als Jungenproblem. Ein kritischer Diskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542849