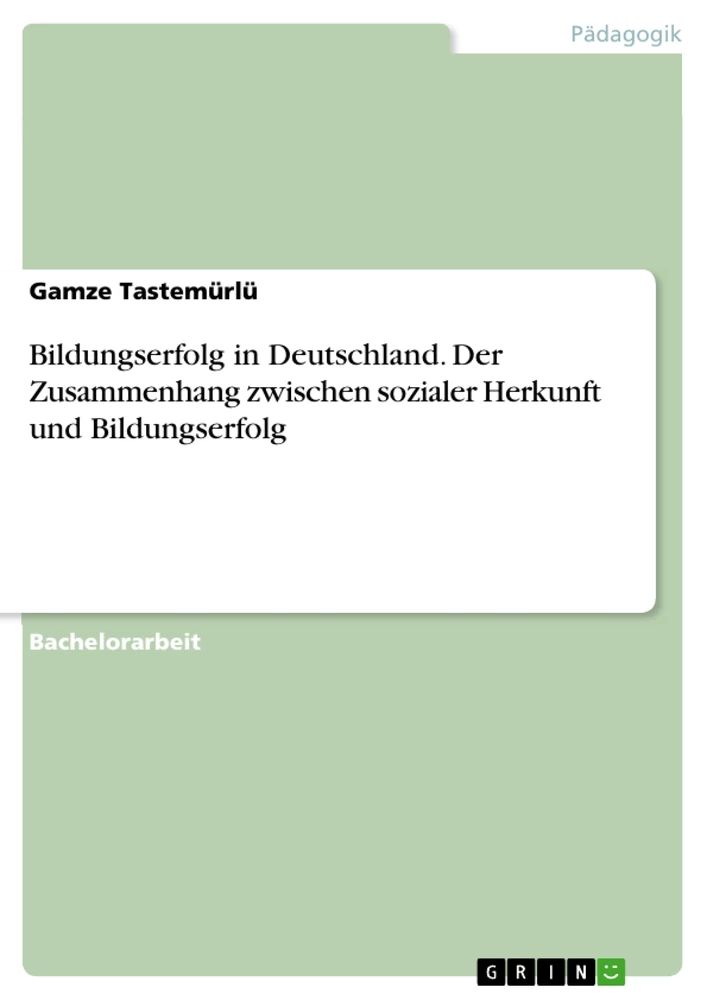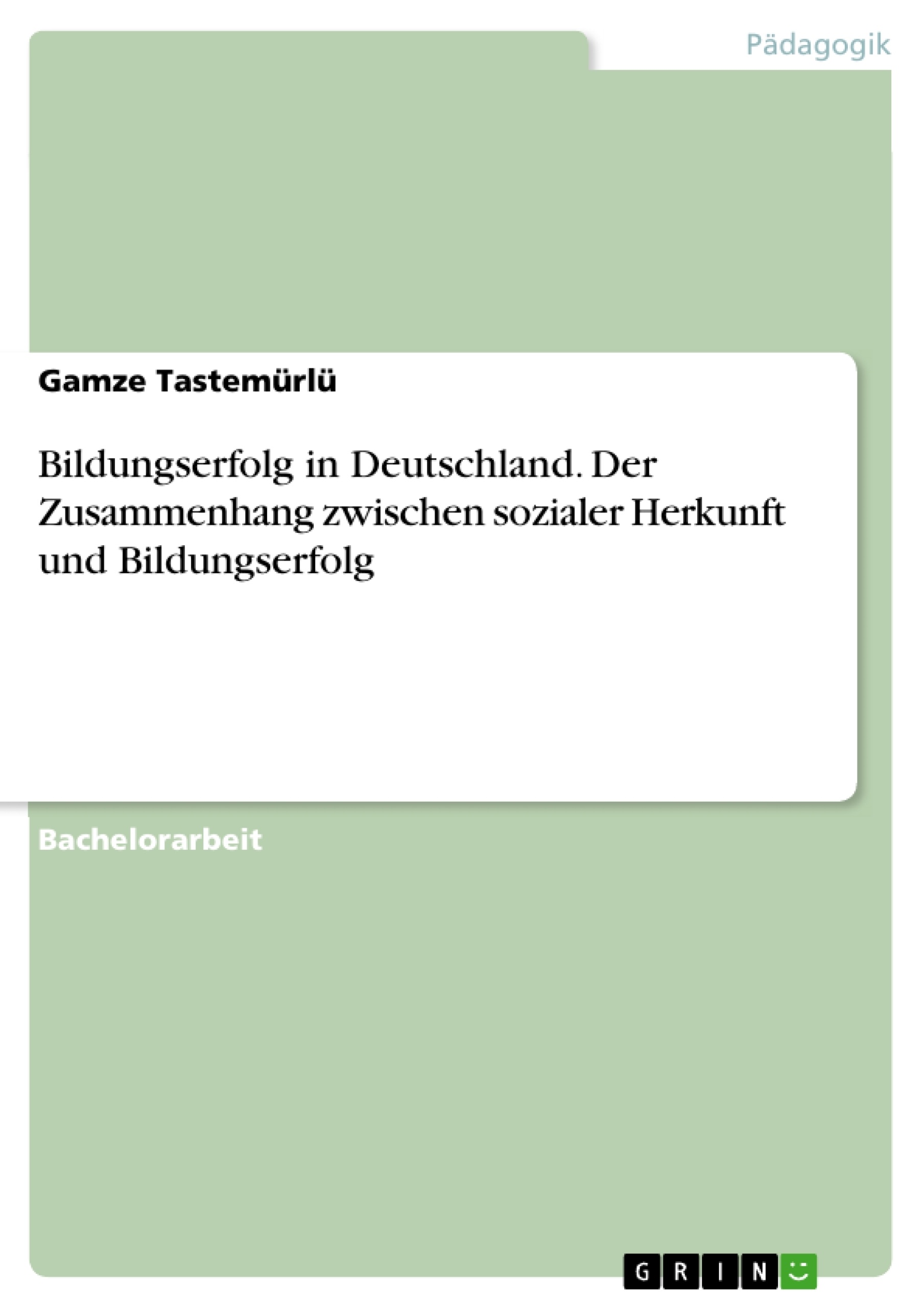Die vorliegende Arbeit widmet sich der Fragestellung, inwieweit der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland von ihrer sozialen Herkunft abhängt, wie diese Chancenungleichheit entstanden ist, wie sie erklärt werden kann und ob heutzutage immer noch eine schichtspezifische Ungleichheit im Bildungssystem herrscht. Soziale Ungleichheit ist im Bildungssystem nach wie vor präsent, und der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Schulerfolg ist immer noch, vor allem im internationalen Vergleich, sehr hoch. Das deutsche Bildungssystem sollte eigentlich in besonderem Maße zu Chancengleichheit verpflichtet sein, jedoch zeigten die Ergebnisse der PISA-Studie, insbesondere PISA 2000, deutliche schichtspezifische Differenzen im Leistungsvermögen von Schülerinnen und Schülern. Der Bildungserfolg in Deutschland hängt stärker von der sozialen Herkunft ab als in vielen anderen OECD-Ländern (Organisation for Economic Co-operation and Development).
Die Ergebnisse der PISA-Studien haben der deutschen Öffentlichkeit vor Augen geführt, dass in Deutschland die Bildungsungleichheiten gravierend sind, die Bildungschancen schlecht sind und im internationalen Vergleich empörend. Zudem verstärken sich diese sozialen Disparitäten von Bildungsstufe zu Bildungsstufe. Dadurch dass Bildung als zentrale Ressource für Lebenschancen gesehen werden kann, sei es im Hinblick auf den Zugang zum Arbeitsmarkt, die Möglichkeit gesellschaftlicher Teilhabe oder die Verteilung materieller Ressourcen, ergibt sich durch die ungleiche Chancenverteilung ein großes Gerechtigkeitsproblem. Besonders Schulen und Hochschulen müssen eine Chancengleichheit schaffen, da sie als öffentliche Institutionen einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag erfüllen müssen. Dieser beinhaltet, vor allem Menschen mit unterschiedlichen sozialen Merkmalen Zugang zu Bildung zu ermöglichen und Bildungsungleichheiten abzubauen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1 Bildungsungleichheit
- 2.2 Soziale Herkunft
- 3. Das Schulsystem in Deutschland
- 3.1 Aufbau des deutschen Schulsystems
- 3.2 Wirkung des Schulsystems auf die Bildungschancen
- 3.3 Bildungserfolg im deutschen Schulsystem
- 3.4 Die Bedeutung des Bildungserwerbs
- 4. Die geschichtliche Entwicklung von Bildungsungleichheiten in Deutschland
- 4.1 Die Bildungsexpansion
- 4.2 Ursachen der Bildungsexpansion
- 4.3 Folgen der Bildungsexpansion
- 4.4 Auswirkung der Bildungsexpansion auf die schichtspezifische Ungleichheit der Bildungschancen
- 4.5 Fazit zu den Bildungschancen nach sozialer Herkunft nach der Bildungsexpansion
- 5. Die PISA-Studie
- 5.1 Aufbau der PISA-Studie
- 5.2 Der ,,PISA-Schock“
- 5.3 Ergebnisse der PISA-Studie (2000) in Bezug auf die Bildungsungleichheit durch soziale Herkunft
- 5.4 Vergleich PISA 2000 und PISA 2018
- 5.5 Ergebnisse der PISA-Studie (2018) in Bezug auf die Bildungsungleichheit durch soziale Herkunft
- 5.6 Fazit PISA 2000 und PISA 2018
- 6. Theorien zur Bildungsungleichheit
- 6.1 Humankapitaltheorie
- 6.2 Das Modell von Raymond Boudon
- 6.3 Pierre Bourdieu
- 6.3.1 Kapitaltheorie
- 6.3.1.3 Kulturelles Kapital
- a) Inkorporiertes Kulturkapital
- b) Objektiviertes Kulturkapital
- c) Institutionalisiertes Kulturkapital
- 6.3.1.4 Soziales Kapital
- 6.4 Familiale Ressourcen und ihr Einfluss auf den Schulerfolg
- 6. 5 Die Illusion der Chancengleichheit
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen in Deutschland von ihrer sozialen Herkunft abhängt. Dabei werden die Entstehung dieser Chancenungleichheit, mögliche Erklärungen dafür und die Frage, ob eine schichtspezifische Ungleichheit im Bildungssystem noch immer besteht, untersucht.- Definition und Analyse von Bildungsungleichheit und sozialer Herkunft
- Einblick in das deutsche Schulsystem und dessen Einfluss auf die Bildungschancen
- Analyse der historischen Entwicklung von Bildungsungleichheiten in Deutschland, insbesondere der Bildungsexpansion und deren Folgen
- Auswertung der Ergebnisse der PISA-Studien aus den Jahren 2000 und 2018 im Hinblick auf Bildungsungleichheiten durch soziale Herkunft
- Relevanz und Bedeutung verschiedener Theorien zur Bildungsungleichheit, wie die Humankapitaltheorie, das Modell von Raymond Boudon und die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bildungsungleichheit und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg ein. Sie stellt die Relevanz des Themas im Kontext des deutschen Bildungssystems und der Ergebnisse der PISA-Studien heraus.
- Kapitel 2: Begriffserklärungen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Bildungsungleichheit“ und „soziale Herkunft“, um die Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen.
- Kapitel 3: Das Schulsystem in Deutschland: Hier wird das deutsche Schulsystem in seinen verschiedenen Facetten dargestellt. Der Fokus liegt auf dem Aufbau, der Wirkung des Schulsystems auf die Bildungschancen, dem Begriff des Bildungserfolgs und der Bedeutung des Bildungserwerbs für die Lebenschancen von Individuen.
- Kapitel 4: Die geschichtliche Entwicklung von Bildungsungleichheiten in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung von Bildungsungleichheiten in Deutschland, insbesondere die Bildungsexpansion und ihre Folgen. Die Auswirkungen der Bildungsexpansion auf die schichtspezifische Ungleichheit der Bildungschancen werden analysiert.
- Kapitel 5: Die PISA-Studie: Das fünfte Kapitel befasst sich mit den PISA-Studien aus den Jahren 2000 und 2018. Die Ergebnisse der Studien werden im Hinblick auf die Bildungsungleichheit durch soziale Herkunft analysiert und miteinander verglichen.
- Kapitel 6: Theorien zur Bildungsungleichheit: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Bildungsungleichheit. Die Humankapitaltheorie, das Modell von Raymond Boudon, die Kapitaltheorie nach Pierre Bourdieu und die Illusion der Chancengleichheit nach Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron werden in Bezug auf Bildungsungleichheiten und den Einfluss auf den Schulerfolg erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Bildungserfolg, Schulsystem, Bildungsexpansion, PISA-Studie, Humankapitaltheorie, Raymond Boudon, Pierre Bourdieu, Chancengleichheit. Die Analyse untersucht die Faktoren, die zur Entstehung von Bildungsungleichheiten beitragen, und analysiert die Rolle des deutschen Schulsystems sowie die Ergebnisse internationaler Studien wie PISA. Die Arbeit beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Bildungsungleichheiten und betrachtet den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg.- Quote paper
- Gamze Tastemürlü (Author), 2020, Bildungserfolg in Deutschland. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542914