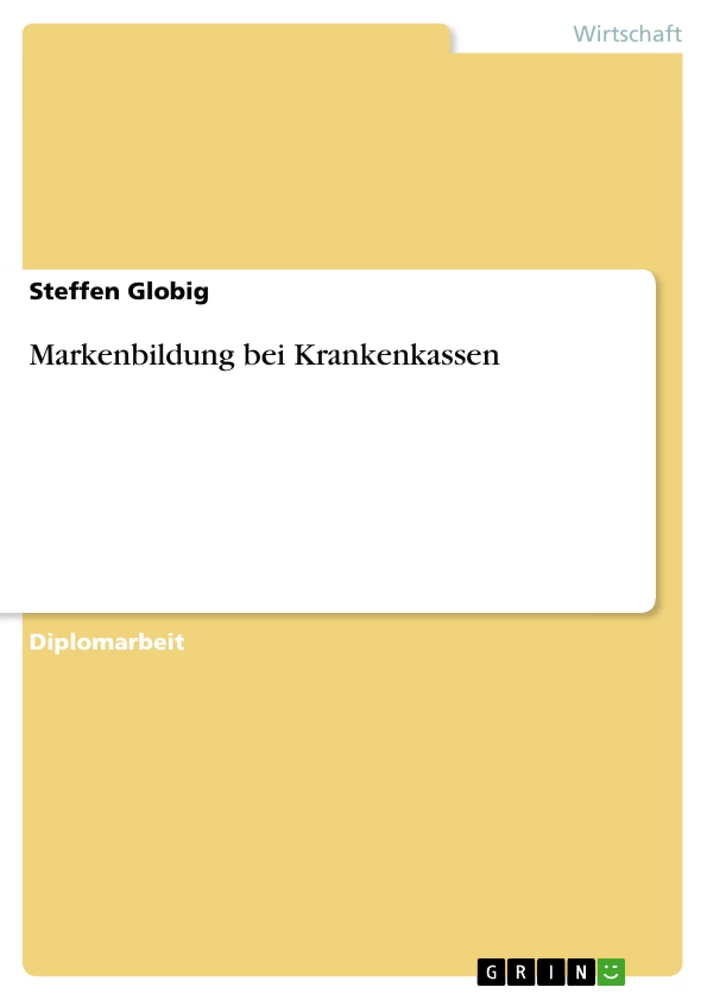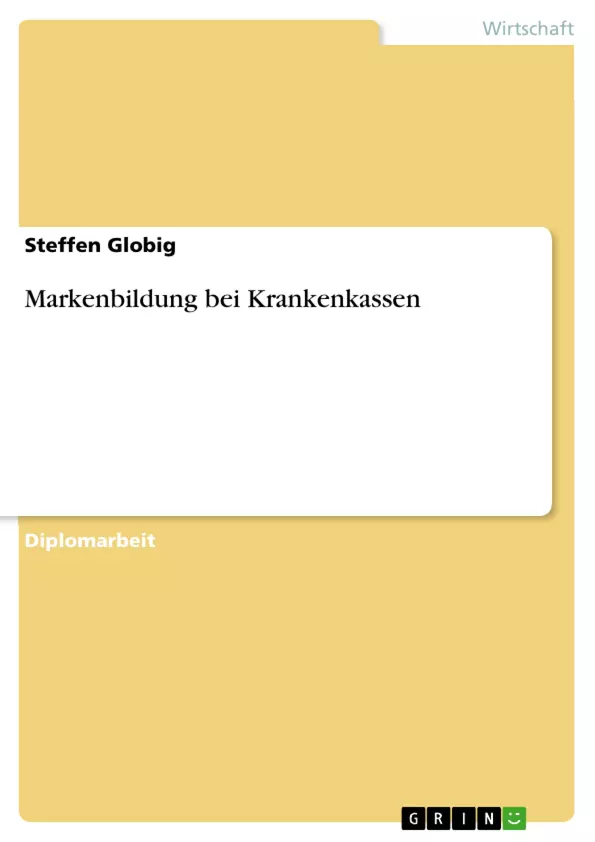I. Problemstellung
Der Markt der Krankenversicherung hat sich in den letzten Jahren immer stärker etabliert. Nötig wurde dies durch die Einführung des Wettbewerbs der Krankenkassen mit dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von 1992 und seinem Inkrafttreten am 01.01.1996.
Die Einführung des Gesetzes war die "Reaktion auf Wettbewerbsverzerrungen unter Verteilungs- und Gerechtigkeitsgesichtspunkten". Die immensen Beitragssatzunterschiede der Krankenkassen und die Priveligierung von freiwilligen Mitgliedern bzw. Diskriminierung von Arbeitern war mit dem freiheitlichen Grundgedanken nicht länger vereinbar.
Es bestanden zwar schon vorher wettbewerbliche Beziehungen, aber ohne konzeptionelle Rahmenbedingungen. So führte z.B. das Nebeneinander von Zuweisungszwang und Wahlmöglichkeit zu einer "Risikoselektion via Gesetz", da gute Risiken die Möglichkeit des Abwanderns hatten und so eine immer größere Schieflage in der Landschaft der gesetzlichen Krankenversicherer entstand.
Seit dem 01.01.1996 ist nun ein Wettbewerb unter den Krankenkassen entstanden, den der Gesetzgeber so gewollt hat. Nach einer Umfrage des Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen im Jahre 1999 stuften 71% der Bundesbürger den Wettbewerb unter den Krankenkassen als wichtig bis sehr wichtig ein.
Der geschaffene Markt unter den Krankenkassen war die Ergänzung zur freien Wahl der eigentlichen Leistungserbringer (Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Apotheken usw.)
Die Folge mündete ökonomisch gesehen im effizienten Umgang mit den knappen Ressourcen und das gesellschaftliche Streben nach größtmöglicher Handlungs- und Wahlfreiheit bzw. die Entwicklung zu wettbewerbsorientierten Dienstleistern mit dem Risiko des Verschwindens vom Markt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Dienstleistungen
- Einordnung der Dienstleistung in die allgemeine Wirtschaftsordnung
- Begriff der Dienstleistung
- Merkmale und deren marketingrelevanten Auswirkungen
- Systematisierung von Dienstleistungen
- Marken
- Definition und Besonderheiten von Dienstleistungsmarken
- Bedeutung von Marken
- Ziele von Marken
- Grundlagen
- Markenfunktionen für den Anbieter
- Markenfunktionen für den Nachfrager
- Gesellschaftliche Funktionen
- Die gesetzliche Krankenversicherung
- Einordnung in das Dienstleistungssystem
- Bedeutung der gesetzlichen Krankenversicherung
- Besonderheiten der gesetzlichen Krankenversicherung
- Abgrenzung des Marktes
- Anbieter
- Nachfrager
- Produkte
- Wettbewerbsparameter
- Wettbewerb kontra Solidarität
- Abgrenzung des Marktes
- Konsumentenverhalten
- Trends
- Veränderung des Umfeldes
- Gesundheit und Wellness
- E-Shopping und virtueller Konsum
- Einflussgrößen
- Trends
- Markenaufbau und Markendreiklang
- Aufbau
- Bekanntheit
- Sympathie/Image
- Imageaufbau
- Markenpersönlichkeit
- Handlungstendenz und Kaufentscheidung
- Elemente und Instrumente der Markierung
- Grundlagen
- Träger der Markierung
- Der Markenname
- Das Logo
- Die Farbe
- Der Slogan
- Markenkommunikation
- Kommunikationsbedingungen
- Mittel der Kommunikation – Marketingmix
- Schlussbetrachtung
- Stand der Markenbildung in der gesetzlichen Krankenversicherung
- Schlussfolgerung für das Management von Krankenkassen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Markenbildung bei Dienstleistungsunternehmen, dargestellt am Beispiel der gesetzlichen Krankenversicherung. Ziel ist es, die Bedeutung von Marken im Wettbewerbsumfeld der gesetzlichen Krankenversicherung zu analysieren und die Herausforderungen bei der Entwicklung und Positionierung von Dienstleistungsmarken in diesem Sektor zu beleuchten.
- Die Entwicklung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung nach der Einführung des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG)
- Die Besonderheiten der Markenbildung bei Dienstleistungen im Vergleich zu Sachgütern
- Die Herausforderungen bei der Entwicklung und Positionierung von Dienstleistungsmarken in der gesetzlichen Krankenversicherung
- Die Bedeutung von Konsumentenverhalten und Trends für den Markenaufbau in der gesetzlichen Krankenversicherung
- Die Instrumente und Strategien der Markenkommunikation in der gesetzlichen Krankenversicherung
Zusammenfassung der Kapitel
- Problemstellung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung nach der Einführung des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) und zeigt die damit einhergehenden Herausforderungen für Krankenkassen auf.
- Dienstleistungen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Dienstleistung, ihren Merkmalen und deren Auswirkungen auf das Marketing. Außerdem wird die Systematisierung von Dienstleistungen behandelt.
- Marken: Dieses Kapitel definiert und erklärt die Besonderheiten von Dienstleistungsmarken. Es werden die Bedeutung von Marken, deren Ziele und die Markenfunktionen für Anbieter und Nachfrager sowie die gesellschaftlichen Funktionen von Marken beleuchtet.
- Die gesetzliche Krankenversicherung: Dieses Kapitel betrachtet die gesetzliche Krankenversicherung im Kontext des Dienstleistungssystems. Es wird auf die Bedeutung, die Besonderheiten und die Abgrenzung des Marktes der gesetzlichen Krankenversicherung eingegangen, sowie auf die Produkte, Wettbewerbsparameter und das Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerb und Solidarität.
- Konsumentenverhalten: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Trends und Veränderungen im Konsumentenverhalten auf die Markenbildung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Themen wie Preis-Qualitätsorientierung, Convenience-Orientierung, Erlebnis- und Sinnorientierung sowie Gesundheit und Wellness und E-Shopping und virtueller Konsum werden beleuchtet.
- Markenaufbau und Markendreiklang: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau von Dienstleistungsmarken in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es behandelt die drei Säulen des Markendreiklangs – Bekanntheit, Sympathie/Image und Handlungstendenz und Kaufentscheidung.
- Elemente und Instrumente der Markierung: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Elemente und Instrumente der Markierung, die zur Gestaltung einer Dienstleistungsmarke eingesetzt werden. Dazu gehören der Markenname, das Logo, die Farbe und der Slogan.
- Markenkommunikation: Dieses Kapitel beleuchtet die Kommunikationsbedingungen und die Mittel der Kommunikation, die im Rahmen der Markenbildung eingesetzt werden können. Der Marketingmix wird dabei als zentrales Instrument der Markenkommunikation dargestellt.
Schlüsselwörter
Dienstleistung, Markenbildung, gesetzliche Krankenversicherung, Wettbewerb, Konsumentenverhalten, Markenkommunikation, Marketingmix, Gesundheitsstrukturgesetz (GSG), Markendreiklang, Dienstleistungsmarken
- Citation du texte
- Steffen Globig (Auteur), 2002, Markenbildung bei Krankenkassen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5430