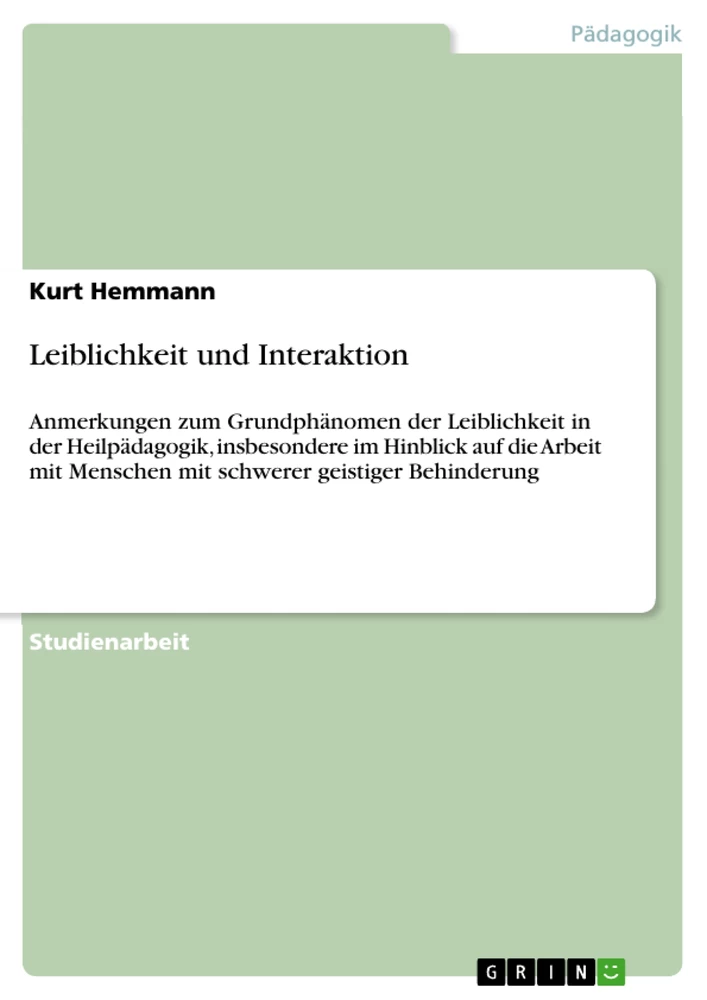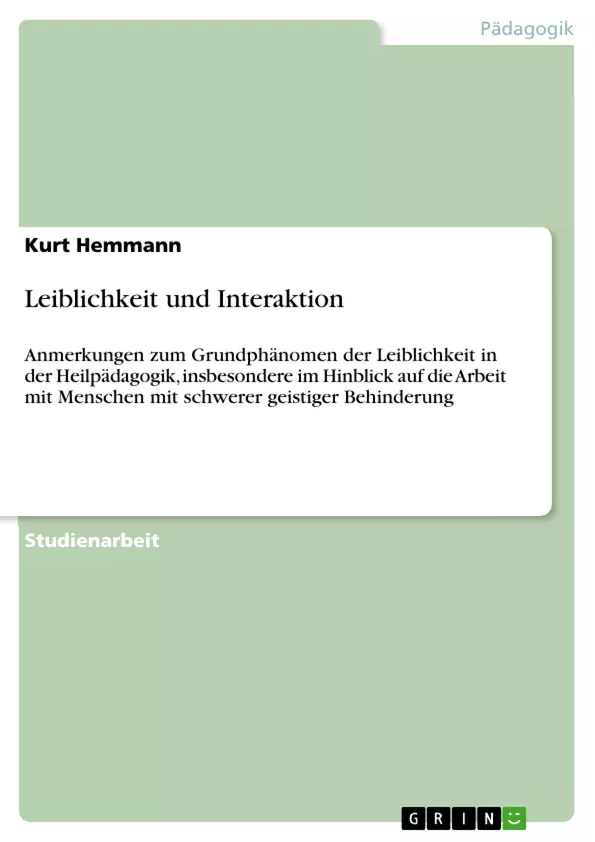Der Leib als Ausgangspunkt aller Erfahrungen ist das Zentrum aller Sinneswahrnehmungen und Tätigkeiten. Er beherbergt die Sinnesorgane und dient als Ganzes der Eigen- und Weltwahrnehmung. Die ersten Erfahrungen mit seiner individuellen Leiblichkeit macht das Kind durch Gefühle wie hungrig und satt sein, lustvolles und schmerzhaftes Erleben, Geborgenheit und Angst fühlen und im spielerischen Spüren und Entdecken seines Körpers.
Sich in Einklang befinden mit seiner Leiblichkeit, sich in seinem Körper wohl – zu Hause – zu fühlen, sind zentrale Grundvoraussetzungen für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes. Sind diese Voraussetzungen beeinträchtigt, ist auch eine erschwerte Selbstwahrnehmung zu erwarten.
Diese Arbeit zeigt auf, wie das Phänomen der Leiblichkeit die Basis bildet für die Anerkennung eines Menschen in seinem einzigartigen und unverkennbaren Person-Sein. Es wird eine Form heilpädagogischer Arbeit skizziert, die immer auch an der Beziehung interessiert und dialogisch orientiert ist.
So fühlt sich die betreffende Person Ernst genommen und akzeptiert, so, wie sie ist, und mit allen ihren (für andere oft unverständlichen) Eigenschaften. Der Ausspruch Sokrates’ – ich weiss, dass ich nichts weiss – ist in einem solchen Setting wegleitend, um – vielleicht – mit der Zeit in die Lage zu kommen, etwas von dem verstehen zu können, was der Partner oder die Partnerin selber durch leibliches Verhalten mitteilt.
Eine Vertiefung in dieses grundlegenden Konzepte lohnt sich für alle, die auf der Basis einer leiborientierten Pädagogik partnerschaftliches Lehren und Lernen von und mit Menschen mit schweren Behinderungen praktizieren wollen!
Inhaltsverzeichnis
- Begründung der Themenwahl
- Hinwendung zum Thema: Leiblichkeit als Konstante menschlichen Seins
- Schlussbetrachtungen
- Konsequenzen - Gedanken zur heilpädagogischen Praxis
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Grundphänomen der Leiblichkeit in der Heilpädagogik, insbesondere im Hinblick auf die Arbeit mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung. Das Ziel ist es, die Bedeutung der Leiblichkeit in diesem Kontext zu erforschen und die Herausforderungen und Chancen aufzuzeigen, die sich aus der Interaktion mit dieser Personengruppe ergeben.
- Die Rolle der Leiblichkeit als Basis der menschlichen Existenz
- Das Spannungsfeld zwischen Norm und Abweichung in Bezug auf Leiblichkeit und Behinderung
- Die Bedeutung der individuellen Ausdrucksmöglichkeiten für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung
- Die Herausforderung der gesellschaftlichen Diskriminierung und die Notwendigkeit einer inklusiven Haltung
- Die ethischen Aspekte der Arbeit mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Begründung der Themenwahl und beleuchtet die persönlichen Erfahrungen des Autors mit Menschen mit geistiger Behinderung. Im zweiten Kapitel wird die Leiblichkeit als Konstante menschlichen Seins thematisiert und der Stellenwert des Körpers in der Heilpädagogik erläutert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Schlussbetrachtungen und zieht die Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis.
Schlüsselwörter
Leiblichkeit, Interaktion, Heilpädagogik, Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, Inklusion, Diskriminierung, ethische Aspekte, individuelle Ausdrucksmöglichkeiten, gesellschaftliche Normen, Behinderung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Leiblichkeit“ in der Heilpädagogik?
Leiblichkeit beschreibt den Körper als Zentrum aller Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen. In der Heilpädagogik ist der Leib das primäre Medium der Kommunikation und Weltwahrnehmung.
Wie erfahren Kinder mit Behinderungen ihre Leiblichkeit?
Oft durch grundlegende Gefühle wie Hunger, Sättigung, Geborgenheit oder Schmerz. Ein positives Selbstkonzept entwickelt sich nur, wenn das Kind lernt, sich in seinem Körper „zu Hause“ zu fühlen.
Welche Rolle spielt die Interaktion bei schwerer Behinderung?
Heilpädagogische Arbeit muss dialogisch orientiert sein. Das bedeutet, auch kleinste leibliche Signale als Kommunikation ernst zu nehmen und darauf partnerschaftlich zu reagieren.
Was meint Sokrates' Ausspruch in diesem Kontext?
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ mahnt Pädagogen zur Offenheit. Man muss bereit sein, das Gegenüber immer wieder neu zu verstehen, ohne voreilige Schlüsse über seine Fähigkeiten zu ziehen.
Wie kann man Diskriminierung von Menschen mit Behinderung entgegenwirken?
Indem man Leiblichkeit als Konstante menschlichen Seins anerkennt und jeden Menschen in seinem einzigartigen Person-Sein akzeptiert, unabhängig von gesellschaftlichen Normen.
- Quote paper
- Kurt Hemmann (Author), 2006, Leiblichkeit und Interaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54369