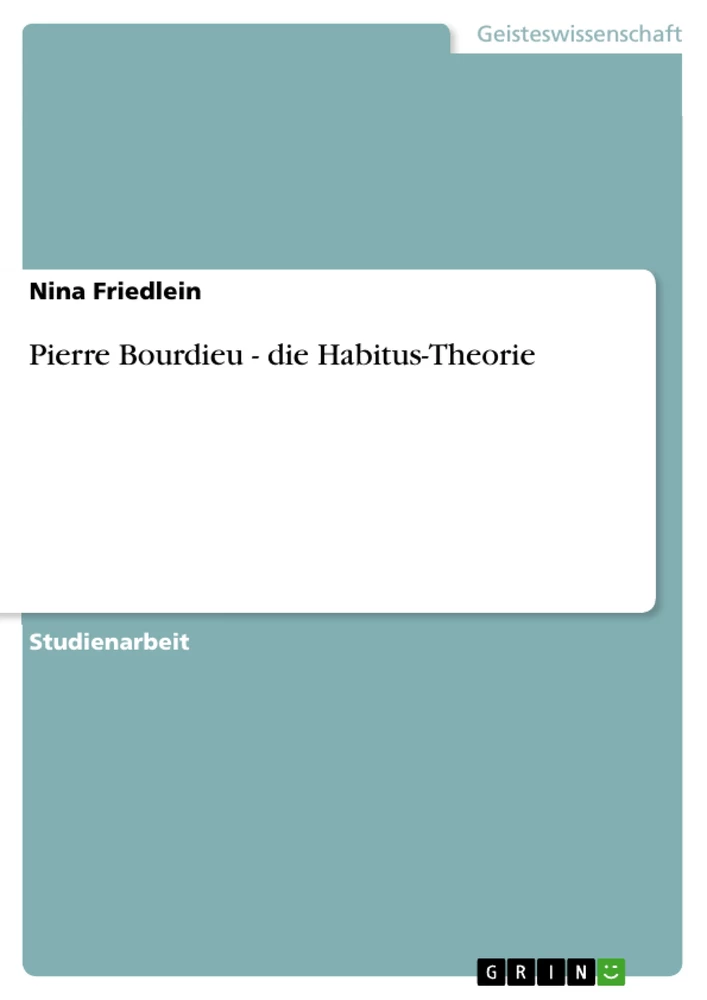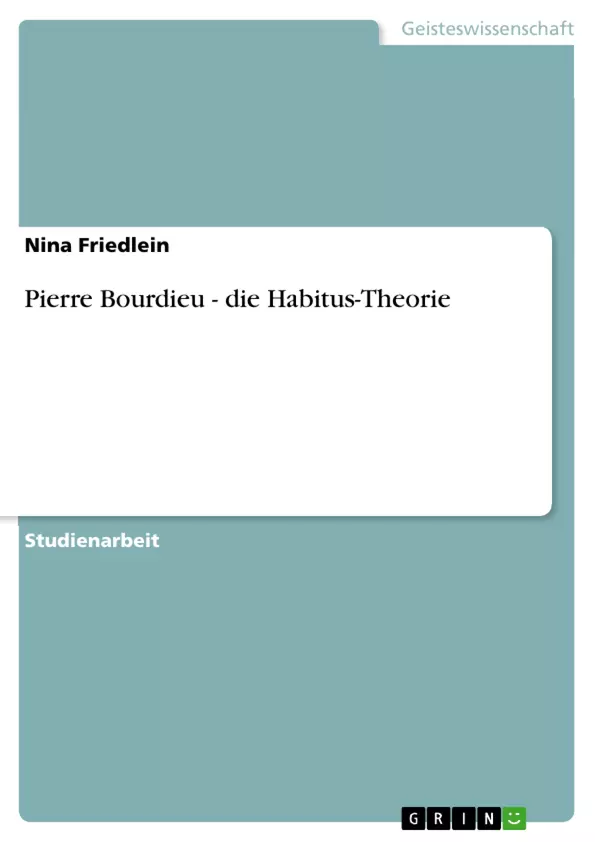Einleitungsgedanken
Laut SCHWINGEL (1995) galt der französische Soziologe und Intellektuelle Pierre BOURDIEU vor allem unter soziologischen Kollegen bereits als Klassiker seines Metiers. Sein wissenschaftliches Gesamtwerk beschäftigt sich mit einer Vielfalt von Themen aus den Bereichen der Ethnologie, Soziologie, aber auch Philosophie und Politik, wodurch seine Arbeiten über die Soziologie hinaus auch in anderen Fachwissenschaften wie z. B. Geschichte, Erziehungs- oder Literaturwissenschaft oder aber auch bei einer breiten, an soziopolitischen Fragen interessierten Öffentlichkeit Beachtung fanden.
BOURDIEUs soziologische Forschungsarbeit bestand überwiegend aus empirischen Studien über alltägliche Erfahrungen von Individuen, welche er in die Entwicklung seiner Theorien mit einbezog. Sein Gesamtwerk beinhaltet nicht eine „große Theorie“, sondern besteht aus verschiedenen Teilkomponenten wie der Theorie der Praxis, der Habitustheorie oder der Kapitaltheorie. (vgl. SCHWINGEL 1995)
Neben den Vorstellungen vom sozialen Raum, vom sozialen Feld oder dem kulturellen Kapital gehört das Habitus-Konzept zu den „zentralen Erkenntnisinstrumenten“, die BOURDIEU den Sozialwissenschaften hinterlassen hat. (vgl. KRAIS / GEBAUER 2002)
Mit BOURDIEUs Habitus-Theorie werde ich mich in dieser Arbeit beschäftigen. Zu Beginn werde ich zunächst einen knappen Überblick über BOURDIEUs Biografie und über seine umfangreiche soziologische Forschungsarbeit geben, um den Hintergrund der Soziologie BOURDIEUs zu umreißen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitungsgedanken
- Zur Person P. BOURDIEU
- Die Habitus-Theorie
- Ursprung des Habitus-Konzepts
- Die Habitus-Theorie
- Der sprachliche Habitus - ein Beispiel
- Habitus und soziologische Strukturkategorien
- Habitus und Klasse
- Habitus und Geschlecht
- Habitus und (soziales) Feld
- Schlussgedanken
- Einleitungsgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Habitus-Theorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Sie zielt darauf ab, die Entstehung und Entwicklung des Habitus-Konzepts im Kontext von Bourdieus umfassender soziologischer Forschungsarbeit zu beleuchten und dessen Relevanz für die Analyse sozialer Strukturen aufzuzeigen.
- Biographie und soziologische Forschungsarbeit von Pierre Bourdieu
- Entstehung und Entwicklung des Habitus-Konzepts
- Der sprachliche Habitus als Beispiel für die Anwendung der Habitus-Theorie
- Verbindung des Habitus-Begriffs mit soziologischen Strukturkategorien wie Klasse, Geschlecht und Feld
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen kurzen Überblick über Pierre Bourdieus Biografie und seine umfassende soziologische Forschungsarbeit. Es beleuchtet seine frühen ethnologischen Studien, die sich mit den Verwandtschaftsverhältnissen und Machtstrukturen bei den Kabylen befassten, und seinen späteren Fokus auf die französische Gesellschaft und das Bildungssystem.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Habitus-Theorie, erläutert ihre Ursprünge und beschreibt sie als eines der zentralen Erkenntnisinstrumente von Bourdieu. Der sprachliche Habitus wird als Beispiel für die Anwendung der Theorie präsentiert.
Das dritte Kapitel untersucht die Zusammenhänge zwischen dem Habitus-Begriff und soziologischen Strukturkategorien wie Klasse, Geschlecht und Feld. Es zeigt auf, wie der Habitus die soziale Positionierung von Individuen innerhalb dieser Kategorien prägt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Habitus-Theorie, die ein zentrales Element im Werk von Pierre Bourdieu ist. Zu den weiteren wichtigen Begriffen gehören soziale Strukturen, soziale Klassen, Geschlecht, soziale Felder und das Bildungssystem. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Entstehung und Bedeutung des Habitus als Werkzeug zur Erklärung sozialer Phänomene.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Habitus-Konzept von Pierre Bourdieu?
Der Habitus ist ein System dauerhafter Dispositionen, das das Handeln, Denken und Wahrnehmen von Individuen prägt und als zentrales Erkenntnisinstrument zur Analyse sozialer Strukturen dient.
Welche Themenbereiche umfasst Bourdieus wissenschaftliches Gesamtwerk?
Sein Werk erstreckt sich über Ethnologie, Soziologie, Philosophie und Politik, wobei er sich intensiv mit Machtstrukturen, Bildung und alltäglichen Erfahrungen beschäftigte.
Was wird unter dem „sprachlichen Habitus“ verstanden?
Der sprachliche Habitus ist ein Beispiel für die Anwendung der Theorie und beschreibt, wie die soziale Herkunft die Art und Weise der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und Kommunikation beeinflusst.
Wie hängen Habitus und soziale Klasse zusammen?
Der Habitus vermittelt zwischen der sozialen Position (Klasse) und dem individuellen Handeln; er sorgt dafür, dass Menschen ihrer sozialen Stellung entsprechend agieren.
Welche Rolle spielt das „Feld“ in Bourdieus Theorie?
Ein soziales Feld ist ein abgegrenzter Bereich der Gesellschaft (z. B. Kunst oder Wissenschaft), in dem Individuen mit ihrem spezifischen Habitus und Kapital um Positionen konkurrieren.
Auf welchen Studien basieren Bourdieus Theorien?
Seine Theorien entwickelten sich aus empirischen Studien, etwa über die Kabylen in Algerien oder über das französische Bildungssystem und die Lebensstile in Frankreich.
- Citation du texte
- Nina Friedlein (Auteur), 2005, Pierre Bourdieu - die Habitus-Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54379