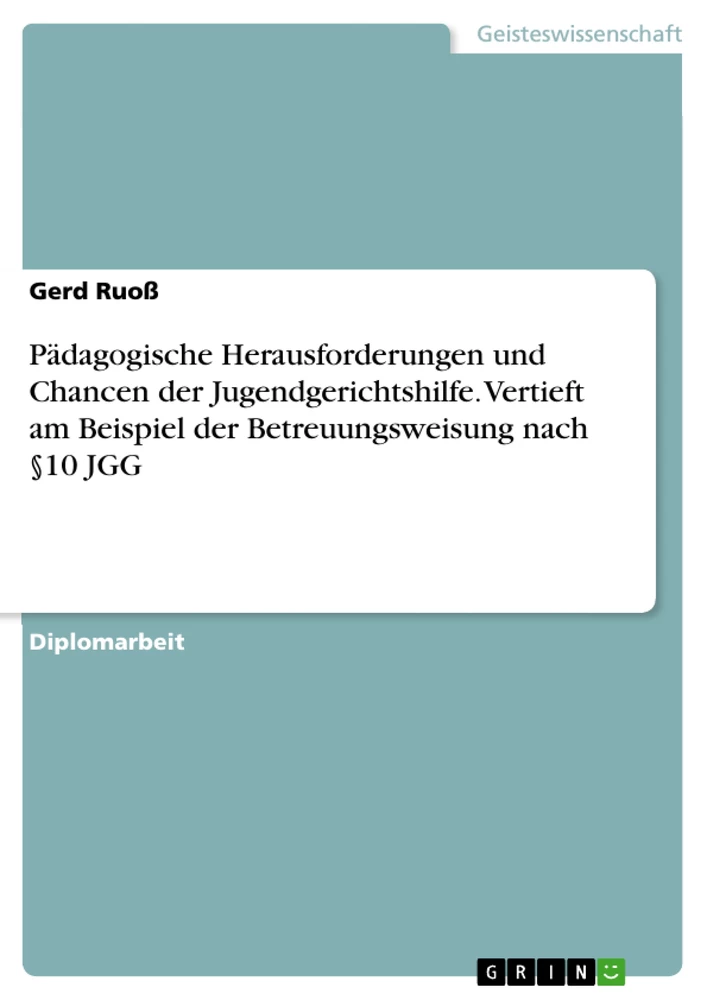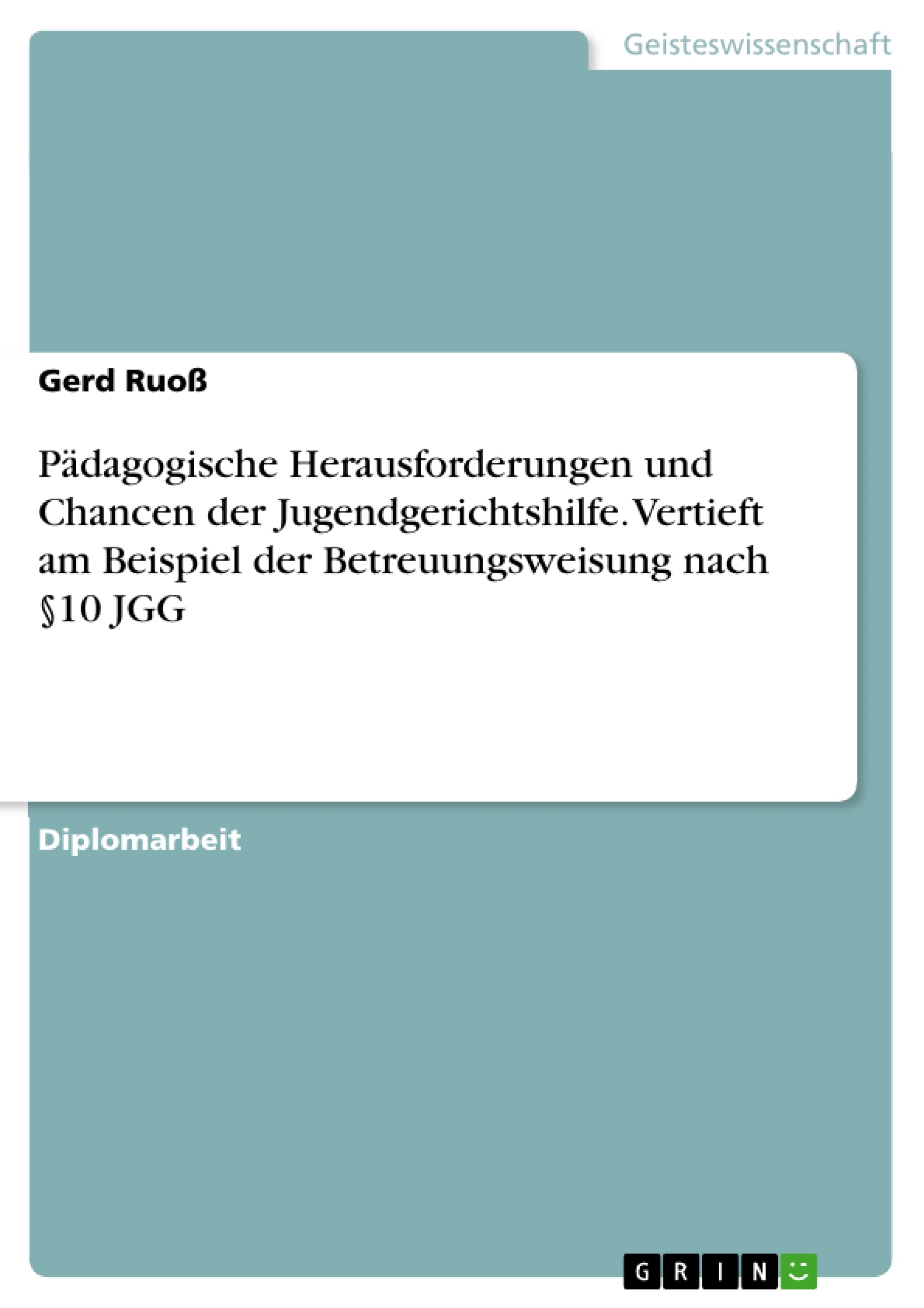Im ersten Teil meiner Arbeit gehe ich zunächst auf die Grundbegriffe Erziehung und Strafe ein, um auf mein Thema hinzuführen.
Im Zweiten Teil meiner Arbeit stelle ich die Entstehung des Jugendstrafrechts unter beson-derer Berücksichtigung der pädagogischen Ziele bzw. des Erziehungsgedankens von der Gesetzesgrundlegung bis zur Gegenwart dar. Dadurch soll der eigentliche pädagogische Grundgedanke des Jugendstrafrechts verdeutlicht werden, der die Basis für die verschiede-nen Sanktionsmaßnahmen des heutigen JGG ist. In Punkt 4. beschreibe ich die einzelnen Sanktionsarten des JGG im Hinblick auf die darin enthaltenen (Erziehungs-) Ziele. Der zweite Teil endet mit einem statistischen Überblick über die Anwendung der verschiedenen Sank-tionsmaßnahmen in Deutschland.
Der Dritte Teil meiner Arbeit beschreibt die gesetzlichen und pädagogischen Aufgaben, Ziele und Handlungsschwerpunkte der JGH. In diesem Zusammenhang werde ich auch auf das Spannungsverhältnis zwischen JGH und Justiz eingehen.
Der Vierte Teil beschäftigt sich mit den pädagogischen Herausforderungen und Chancen, denen sich die JGH vor allem durch den gesetzlichen Kontext stellen muss. Die Herausfor-derungen – aber auch Chancen – beziehen sich besonders auf die so genannten „schwierigen Paragraphen“, wie z.B. der „pädagogisch“ formulierten gesetzlichen Definition des Beginns der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei Jugendlichen. Anhand dieser Paragraphen werde ich einige Herausforderungen und Chancen bezüglich der Arbeit der JGH aufzeigen. Weitere Herausforderungen und Chancen liegen in der Überwachung und Durchführung von Weisungen, die sich durch die Einführung der NAM durch das 1. JGG Änderungsgesetz er-geben haben.
Im letzten Teil der Diplomarbeit werde ich eine dieser richterlichen Weisungen – die Be-treuungsweisung – vertiefen. Dazu beschreibe ich zunächst die BTW nach § 10 JGG und anschließend gehe ich auf die Herausforderungen und Chancen der JGH im Zusammenhang mit dieser Sanktionsform ein. In einem weiteren Schritt werde ich anhand von drei Ex-perteninterviews die BTW aus verschiedenen Sichtweisen beleuchten, um so eine möglichst vielfältige Antwort auf die pädagogischen Herausforderungen und Chancen der BTW zu be-kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Erziehung und Strafe
- 2.1. Der Begriff Erziehung
- 2.2. Der Begriff Strafe
- 2.3. „Erziehung statt Strafe“
- 3. Das Jugendstrafrecht
- 3.1. Entstehung des Jugendgerichtsgesetzes
- 3.2. Ziele des Jugendgerichtsgesetzes seit dem 1. Änderungsgesetz von 1990
- 3.3. Der Erziehungsgedanke des Jugendgerichtsgesetzes
- 4. Sanktionsmaßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes
- 4.1. Erziehungsmaßregeln
- 4.2. Zuchtmittel
- 4.3. Jugendstrafe
- 4.4. Weitere Sanktionsmaßnahmen und Folgen einer Straftat
- 4.5. Jugendgerichtliche Sanktionspraxis
- 4.6. Statistik: Überblick über die Verhängung von Sanktionsmaßnahmen
- 5. Die Jugendgerichtshilfe
- 5.1 Von der Jugendgerichtshilfe zur Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren
- 5.2. Die rechtliche Grundlage der Jugendgerichtshilfe
- 5.3. Ziele der Jugendgerichtshilfe
- 5.3.1. Die Jugendgerichtshilfe zwischen Justiz und Jugendhilfe
- 5.4. Aufgaben und Handlungsschwerpunkte der Jugendgerichtshilfe
- 5.4.1. Präventive Aufgaben der Jugendgerichtshilfe
- 5.4.2. „Klassische\" Jugendgerichtshilfe-Arbeit
- 5.4.3. Aufgaben der Jugendgerichtshilfe nach einem Strafverfahren
- 6. Pädagogische Herausforderungen und Chancen der Jugendgerichtshilfe
- 6.1. Gesetzliche Herausforderungen und Chancen
- 6.1.1. § 3 Jugendgerichtsgesetz: Verantwortlichkeit
- 6.1.2. §17 Jugendgerichtsgesetz: Schädliche Neigungen
- 6.1.3. §17 Jugendgerichtsgesetz: Schwere der Schuld
- 6.1.4. § 105 Jugendgerichtsgesetz: Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende
- 6.2. Sonstige Herausforderungen und Chancen
- 6.2.1. Einführung der „Neuen ambulanten Maßnahmen“ durch das 1. Jugendgerichts-Änderungsgesetz
- 6.2.2. Überwachung und Durchführung von Weisungen und Auflagen
- 7. Die Betreuungsweisung
- 7.1. Entstehung der Betreuungsweisung
- 7.2. Rechtsgrundlage der Betreuungsweisung
- 7.3. Zielgruppe der Betreuungsweisung
- 7.4. Voraussetzung und Rahmenbedingungen einer Betreuungsweisung
- 7.5. Aufgaben und Ziele der Betreuungsweisung
- 7.5.1. Themen und Inhalte der Betreuungsweisung
- 7.6. Methoden und Gesprächsführung der Betreuungsweisung
- 7.7. Ablauf einer Betreuungsweisung
- 7.8. Statistik: Die Betreuungsweisung in Deutschland
- 7.9. Exkurs: Ambulante Intensive Begleitung
- 8. Die Betreuungsweisung als pädagogische Herausforderung und Chance
- 8.1. Herausforderungen und Chancen in Bezug auf die Zielgruppe der Betreuungsweisung
- 8.2. Herausforderungen und Chancen in Bezug auf die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen einer Betreuungsweisung
- 8.3. Ziele der Betreuungsweisung
- 8.4. Erfolg der Betreuungsweisung
- 8.5. Grenzen der Betreuungsweisung
- 8.6. Die Betreuungsweisung als Ersatzsanktionsmaßnahme
- 8.7. Die Betreuungsweisung im richterlichen Zwangskontext
- 8.8. Richterliche Autorität versus Eigenständigkeit der Sozialpädagogik
- 8.9. Stigmatisierung in Bezug auf die Betreuungsweisung
- 8.10. Herausforderungen und Chancen in Bezug auf das Arbeitsfeld
- 8.11. Änderungen und Zukunft der Betreuungsweisung
- 9. Abschließende Gedanken
- 10. Anhang
- 10.1. Die Interviewleitfäden
- 10.2. Interview mit einer Jugendrichterin
- 10.3. Interview mit einer Betreuungshelferin
- 10.4. Interview mit einem Jugendlichen
- 10.5. Jugendrichterliche Sanktionen als Formelles und Materielles Schaubild
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit den pädagogischen Herausforderungen und Chancen der Jugendgerichtshilfe. Am Beispiel der Betreuungsweisung im Jugendstrafverfahren nach § 10 JGG soll gezeigt werden, wie die Jugendgerichtshilfe die spezifischen Bedürfnisse von Jugendlichen im Strafverfahren berücksichtigt und gleichzeitig zur Resozialisierung und Rehabilitation beiträgt.
- Der Erziehungsgedanke des Jugendgerichtsgesetzes und seine Bedeutung für die Jugendgerichtshilfe
- Die Aufgaben und Handlungsschwerpunkte der Jugendgerichtshilfe im Jugendstrafverfahren
- Die Betreuungsweisung als pädagogische Herausforderung und Chance
- Die Herausforderungen und Chancen der Jugendgerichtshilfe im Umgang mit Jugendlichen im Strafverfahren
- Die Bedeutung der Sozialpädagogik in der Zusammenarbeit mit der Justiz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Konzepte von Erziehung und Strafe, um den hintergrund des Jugendstrafrechts zu beleuchten. Anschließend werden das Jugendgerichtsgesetz und seine Ziele sowie die Sanktionsmaßnahmen des Jugendstrafrechts vorgestellt. Es wird die Arbeit der Jugendgerichtshilfe erläutert, ihre rechtliche Grundlage, Ziele, Aufgaben und Handlungsschwerpunkte.
Die Arbeit fokussiert sich dann auf die pädagogischen Herausforderungen und Chancen der Jugendgerichtshilfe, insbesondere im Kontext der Betreuungsweisung. Hier werden die rechtlichen Grundlagen, die Zielgruppe, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Betreuungsweisung sowie ihre Ziele und Methoden beschrieben. Die Arbeit untersucht die Betreuungsweisung als pädagogische Herausforderung und Chance, indem sie die Herausforderungen und Chancen in Bezug auf die Zielgruppe, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die Ziele, den Erfolg, die Grenzen und die Rolle der Betreuungsweisung im richterlichen Zwangskontext analysiert.
Die Arbeit schließt mit abschliessenden Gedanken zu den Themen der Jugendgerichtshilfe und der Betreuungsweisung. Die Arbeit greift auf Interviews mit einer Jugendrichterin, einer Betreuungshelferin und einem Jugendlichen zurück, um den Praxisbezug zu stärken.
Schlüsselwörter
Jugendgerichtshilfe, Jugendstrafrecht, Jugendstrafverfahren, Betreuungsweisung, Pädagogik, Resozialisierung, Rehabilitation, Strafrecht, Erziehungsgedanke, Sanktionsmaßnahmen, Jugendhilfe, Justiz, Jugendgerichtsgesetz, § 10 JGG, Sozialpädagogik
- Quote paper
- Dipl.-Soz.Arb/Soz.Päd. (FH) Gerd Ruoß (Author), 2006, Pädagogische Herausforderungen und Chancen der Jugendgerichtshilfe. Vertieft am Beispiel der Betreuungsweisung nach §10 JGG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54513