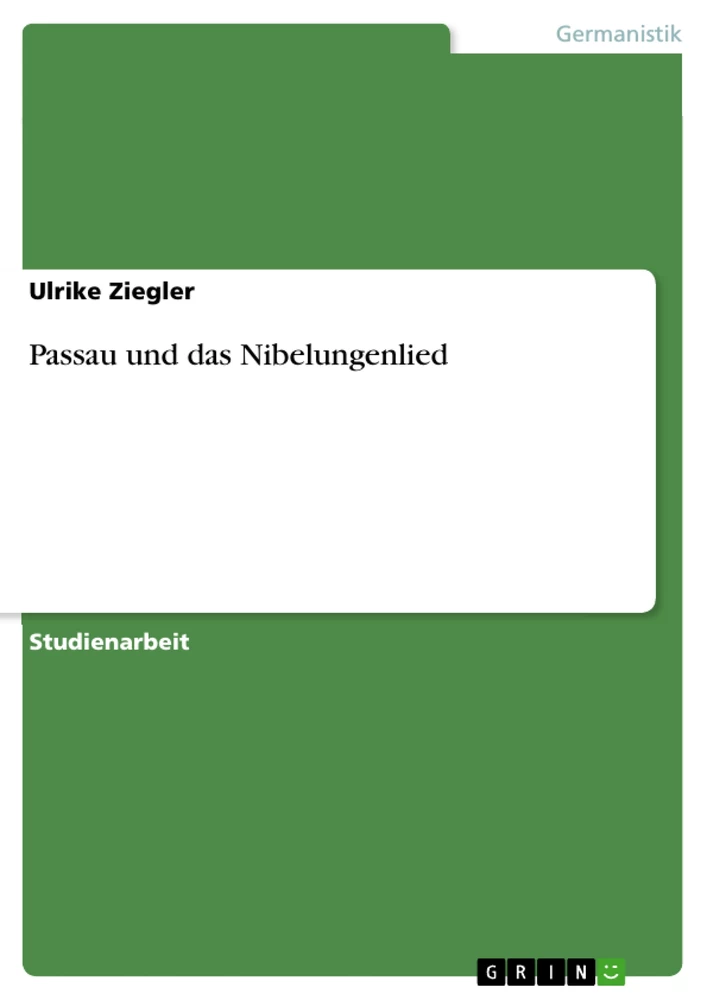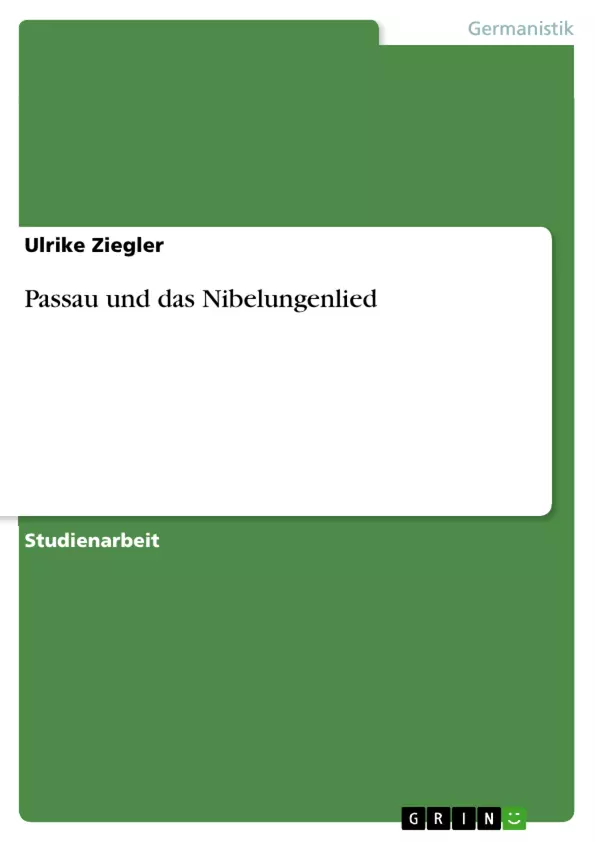Die Forschung beschäftigt sich schon seit rund 200 Jahren mit dem Nibelungenlied, aber da auf viele Fragen - z.B. nach dem Autor oder der definitiven Entstehungszeit - keine belegbaren Antworten zu finden sind, kann vieles nur spekulativ sein. Viele Vorschläge können nicht mehr als eine Hypothese sein; manches Hypothesengerüst fällt bald in sich zusammen, andere Hypothesengerüste sind in sich schlüssig und scheinen den wahren Begebenheiten zu entsprechen.
Bei der Annahme, dass das Nibelungenlied in Passau, bzw. im Umkreis des Passauer fürstbischöflichen Hofes von Wolfger von Erla entstanden ist, scheint es sich um ein stabiles Gerüst zu handeln. Zwar gibt es außerordentlich gegensätzliche Anläufe, das Nibelungenlied z. B. in Soest oder Worms zu verorten, um nur zwei der Alternativen zu nennen, aber bei genauerem Hinsehen kann keine der Thesen einer Untersuchung standhalten.1
Dagegen sprechen viele Punkte für eine Lokalisierung nach Passau. Darauf hat sich die Forschung relativ einmütig geeinigt.
Ziel dieser Untersuchung soll es sein, darzulegen, weshalb man auf Passau und den fürstbischöflichen Hof kommt, was dafür und möglicherweise auch dagegen spricht oder Fragen aufwirft.
Ein grundlegendes Problem für eine hieb- und stichfeste Verortung ist, dass das Nibelungenlied und seine Quellen aus der Zeit der germanischen Völkerwanderung stammen. Dementsprechend erscheint der Handlungsspielraum der Geschichte sehr weit gefasst und geht vom Ober- und Niederrhein bis nach Bayern, Österreich und schließlich Ungarn. Jedoch ist der Raum im Bistum Passau lebendiger beschrieben, als die restliche Reise, was schon eine erste Spur zum Donauraum ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Passau im Nibelungenlied
- Grobe Einordnung in den südlichen Donauraum durch den Dialekt
- Die regionale Tradition der Theologie im Nibelungenlied
- Die Ortskenntnis des Autors innerhalb der Stadt Passau
- Bischof Wolfger von Erla
- Das Bistum Passau in der Zeit der Territorialfürstentümer
- Die Vogtei über Kloster Neuburg
- Strophe 1302, die Bayernfeindlichkeit und die Ortenburger Grafen
- Die Kultur am Hofe Wolfgers
- Bischof Pilgrim im Nibelungenlied und in der Klage
- Die Ortskenntnis des Autors innerhalb des Bistums Passau
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Untersuchung ist es, die Lokalisierung des Nibelungenliedes im Raum Passau zu beleuchten und Argumente dafür und dagegen zu präsentieren. Dabei werden die Ortskenntnisse des Autors, die Rolle der Bischöfe Wolfger von Erla und Pilgrim sowie die Bedeutung des Bistums Passau in der Zeit der Territorialfürstentümer analysiert.
- Die Ortskenntnis des Autors im Nibelungenlied und in der Klage
- Die Rolle von Bischof Wolfger von Erla und Bischof Pilgrim
- Das Bistum Passau in der Zeit der Territorialfürstentümer
- Die Bedeutung des südlichen Donauraums in der Geschichte des Nibelungenliedes
- Die Kultur am Hofe Wolfgers von Erla
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Nibelungenliedes und die Debatte um seine Entstehung ein. Sie stellt die These auf, dass das Nibelungenlied in Passau entstanden ist und erläutert die Schwerpunkte der Untersuchung.
Kapitel 2 analysiert die Ortskenntnis des Autors im Nibelungenlied und untersucht, wie die Stadt Passau und das Bistum Passau im Text beschrieben werden. Das Kapitel diskutiert die Bedeutung des Dialekts, der regionalen Tradition der Theologie und die Ortskenntnis des Autors innerhalb der Stadt Passau.
Kapitel 3 befasst sich mit der Persönlichkeit von Bischof Wolfger von Erla, der in der Zeit des angenommenen Entstehungszeitraums des Nibelungenliedes in Passau residierte. Es wird die Bedeutung des Bistums Passau in der Zeit der Territorialfürstentümer untersucht, die Vogtei über Kloster Neuburg analysiert und die Strophe 1302, die Bayernfeindlichkeit und die Ortenburger Grafen untersucht.
Kapitel 4 beleuchtet die Rolle von Bischof Pilgrim im Nibelungenlied und in der Klage. Es wird seine Bedeutung für die Forschung und die Frage nach einer möglichen Vorstufe des Nibelungenliedes diskutiert.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Ortskenntnis des Autors innerhalb des Bistums Passau und untersucht die Detailliertheit seiner Beschreibungen der Reise nach Ungarn im zweiten Teil des Nibelungenliedes. Es wird die Bedeutung einzelner Orte für das Bistum Passau untersucht.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Passau, Bischof Wolfger von Erla, Bischof Pilgrim, Bistum Passau, Territorialfürstentümer, Vogtei, Kloster Neuburg, Bayernfeindlichkeit, Ortenburger Grafen, Ortskenntnis, Kultur am Hofe, südlicher Donauraum, Nibelungenliedforschung, Klage, Entstehung, Datierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Passau als Entstehungsort des Nibelungenliedes vermutet?
Die Forschung weist auf die detaillierte Ortskenntnis des Autors im Passauer Raum sowie auf die Verbindung zum fürstbischöflichen Hof von Wolfger von Erla hin.
Wer war Wolfger von Erla?
Wolfger von Erla war Bischof von Passau zur Zeit der Entstehung des Epos und gilt als bedeutender Förderer von Literatur und Kultur an seinem Hof.
Welche Rolle spielt Bischof Pilgrim im Nibelungenlied?
Bischof Pilgrim tritt als literarische Figur im Nibelungenlied und in der "Klage" auf, was als Hinweis auf eine lokale Passauer Tradition des Stoffes gedeutet wird.
Gibt es sprachliche Hinweise auf den Entstehungsort?
Ja, der Dialekt des Nibelungenliedes erlaubt eine grobe Einordnung in den südlichen Donauraum (Bayern/Österreich).
Warum ist die Verortung des Nibelungenliedes schwierig?
Da der Autor anonym blieb und das Werk auf älteren Quellen der Völkerwanderungszeit basiert, bleiben viele Details zur Entstehung hypothetisch.
- Citar trabajo
- MA Ulrike Ziegler (Autor), 2001, Passau und das Nibelungenlied, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54759