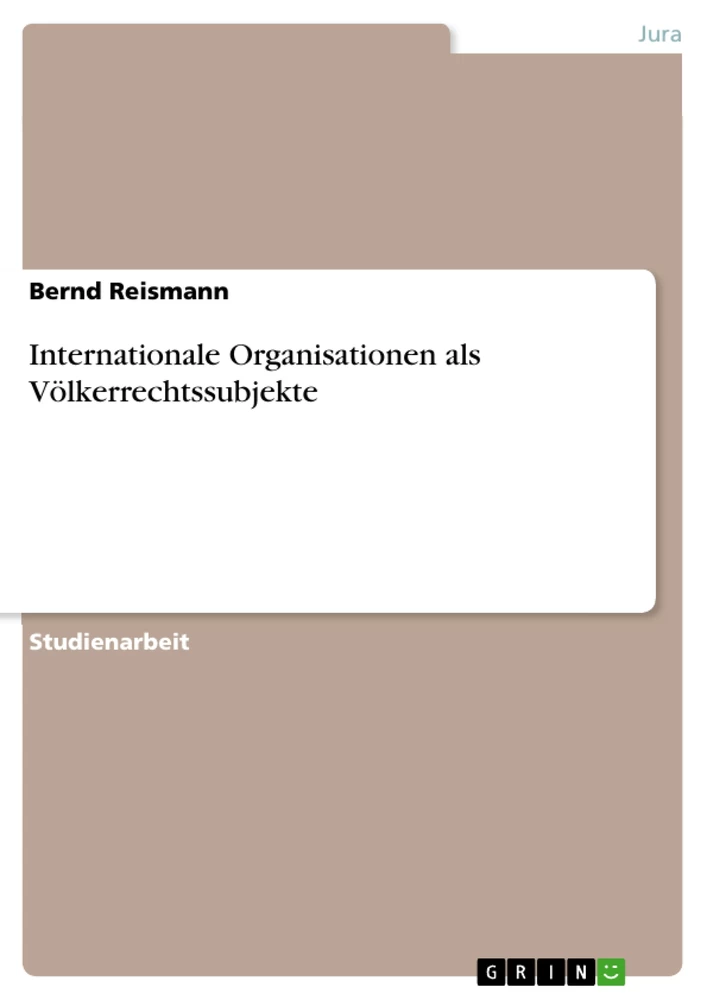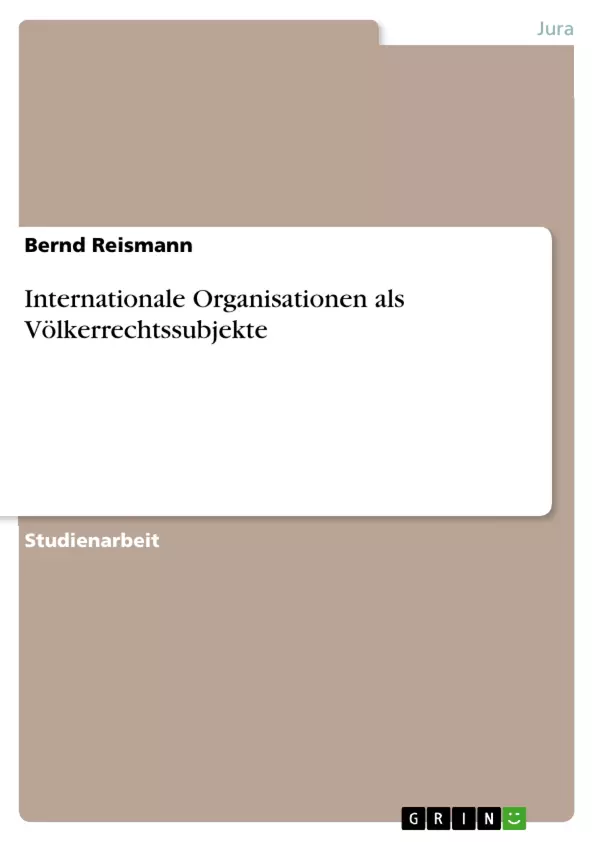Als Völkerrechtssubjekt bezeichnet man solche Einheiten, denen durch die Völkerrechtsordnung die Fähigkeit zuerkannt wird, Träger völkerrechtlicher Rechte und/oder Pflichten zu sein. Art und Umfang dieser Rechte und Pflichten richten sich nach der Natur des einzelnen Völkerrechtssubjekts und nach seiner Stellung in der Völkerrechtsordnung.
Noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts galten Staaten als einzige Völkerrechtssubjekte. Der seit 1945 enorm gestiegene grenzüberschreitende Verkehr von Waren, Personen und Finanzdienstleistungen machte jedoch eine institutionalisierte Form der Zusammenarbeit der Staaten nötig. Damit einher ging nicht nur die wachsende Anzahl und Bedeutung internationaler Organisationen (im Folgenden abgekürzt als i.O.), sondern auch die Frage nach Art, Umfang und Erwerb ihrer Völkerrechtssubjektivität.
Wegen ihrer Bedeutung als „Motoren des Völkerrechts“ werden Staaten als „geborene“ oder „originäre“ Völkerrechtssubjekte bezeichnet. I.O. dagegen können nur durch Zuweisung eigener völkerrechtlicher Rechten und Pflichten von den Mitgliedsstaaten in einer Satzung oder einem Gründungsvertrag zu Völkerrechtssubjekten „erkoren“ werden. Die Völkerrechtssubjektivität einer i.O. ist dabei jedoch zwei Einschränkungen unterworfen. Zum einen ist ihre Völkerrechtssubjektivität partiell, d.h. ihre Rechtspersönlichkeit reicht nur soweit, wie es zur Erreichung des Organisationszwecks erforderlich ist. Zum anderen ist ihre Völkerrechtssubjektivität relativ, da sie zunächst nur gegenüber den Mitgliedsstaaten gilt. Gegenüber einem Drittstaat kann eine i.O. erst als Völkerrechtssubjekt auftreten, wenn dieser die i.O. als solche anerkannt hat.
Einzig der UNO sprach der Internationale Gerichtshof in seinem Urteil zum Bernadotte-Fall von 1949 die uneingeschränkte bzw. universelle Völkerrechts-subjektivität zu. Der IGH hatte in seinem Gutachten festgestellt, dass die Gründungsstaaten der UN, die die überwiegende Mehrheit der internationalen Gemeinschaft repräsentierten, die Rechtsmacht besessen hatten, eine Einheit mit universeller Völkerrechtssubjektivität zu schaffen, die auch gegenüber Dritten ohne deren Anerkennung wirkt.
Durchaus umstritten ist daher, dass Organisationen wie z.B. multinationalen Konzernen oder internationalen Nichtregierungsorganisationen bis heute keine Völkerrechtssubjektivität zuerkannt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Völkerrechtssubjektivität
- Internationale Organisationen
- IGH-Fall Bernadotte und seine Bedeutung für die Völkerrechtssubjektivität internationaler Organisationen
- Sachverhalt und Entscheidung
- Einteilung der Völkerrechtssubjekte
- Handlungsfähigkeit und Befugnisse
- Supranationale Organisationen
- Kritik der Völkerrechtssubjektivität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Völkerrechtssubjektivität internationaler Organisationen und untersucht deren Bedeutung im Kontext der modernen Völkerrechtsordnung. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, inwieweit verschiedene Abstufungen der Völkerrechtssubjektivität noch sinnvoll sind, insbesondere vor dem Hintergrund der Globalisierung und der Diskussion um ein "Weltinnenrecht".
- Definition und Entwicklung der Völkerrechtssubjektivität internationaler Organisationen
- Der IGH-Fall Bernadotte als Schlüsselmoment für die Anerkennung internationaler Organisationen als Völkerrechtssubjekte
- Kritik am Prinzip der Völkerrechtssubjektivität und die Diskussion um die Anerkennung von Nichtregierungsorganisationen und transnationalen Konzernen
- Die Bedeutung des Prinzips der Völkerrechtssubjektivität im Kontext der Globalisierung
- Die Rolle supranationaler Organisationen innerhalb der Völkerrechtsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt die grundlegenden Definitionen von Völkerrechtssubjektivität und internationalen Organisationen dar, die für das Verständnis der weiteren Ausführungen relevant sind. Das zweite Kapitel analysiert den IGH-Fall Bernadotte, der ausschlaggebend für die Anerkennung internationaler Organisationen als Völkerrechtssubjekte war. Es werden die verschiedenen Arten von Völkerrechtssubjekten, die Handlungsfähigkeit und Befugnisse internationaler Organisationen sowie die Besonderheiten supranationaler Organisationen im Kontext der Völkerrechtssubjektivität beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich der Kritik am Begriff der Völkerrechtssubjektivität und beleuchtet die Notwendigkeit und Begründetheit des Prinzips, insbesondere die Unterscheidung zwischen partieller und universeller Völkerrechtssubjektivität. Die Diskussion um die Anerkennung von Nichtregierungsorganisationen und transnationalen Konzernen als Völkerrechtssubjekte wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Völkerrechtssubjektivität, internationaler Organisationen, Globalisierung, "Weltinnenrecht", supranationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, transnationale Konzerne, IGH-Fall Bernadotte, partielle und universelle Völkerrechtssubjektivität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Völkerrechtssubjekt?
Ein Völkerrechtssubjekt ist eine Einheit, die fähig ist, Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten zu sein. Während Staaten originäre Subjekte sind, gelten internationale Organisationen als abgeleitete Subjekte.
Welche Bedeutung hat der Bernadotte-Fall von 1949?
In diesem Gutachten sprach der IGH der UNO erstmals eine universelle Völkerrechtssubjektivität zu. Dies war der entscheidende Moment für die völkerrechtliche Anerkennung internationaler Organisationen über ihre Mitgliedsstaaten hinaus.
Was unterscheidet partielle von universeller Völkerrechtssubjektivität?
Partielle Subjektivität gilt meist nur gegenüber den Mitgliedsstaaten und für den Organisationszweck. Universelle Subjektivität (wie bei der UN) wirkt gegenüber der gesamten internationalen Gemeinschaft, auch ohne explizite Anerkennung durch Drittstaaten.
Sind NGOs und transnationale Konzerne Völkerrechtssubjekte?
Aktuell wird ihnen keine klassische Völkerrechtssubjektivität zuerkannt, was in der Rechtswissenschaft im Zuge der Globalisierung jedoch zunehmend kritisch diskutiert wird.
Was sind supranationale Organisationen?
Dies sind Organisationen (wie die EU), denen Mitgliedsstaaten Hoheitsrechte übertragen haben. Sie nehmen eine Sonderstellung ein, da ihr Recht unmittelbar in den Mitgliedsstaaten wirken kann.
- Citation du texte
- Bernd Reismann (Auteur), 2006, Internationale Organisationen als Völkerrechtssubjekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54775