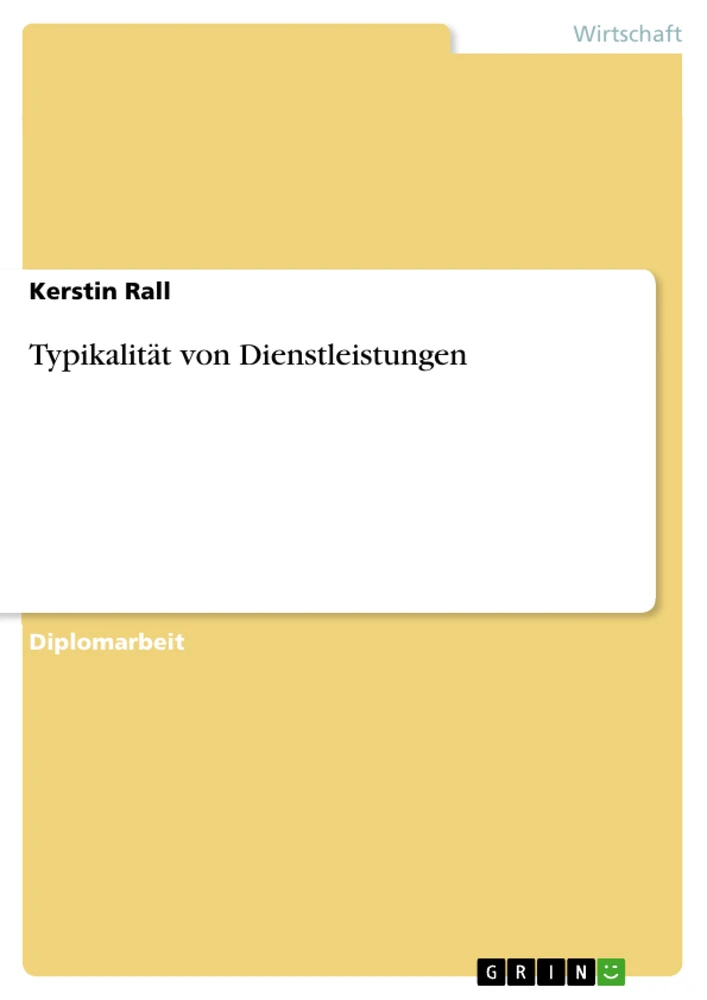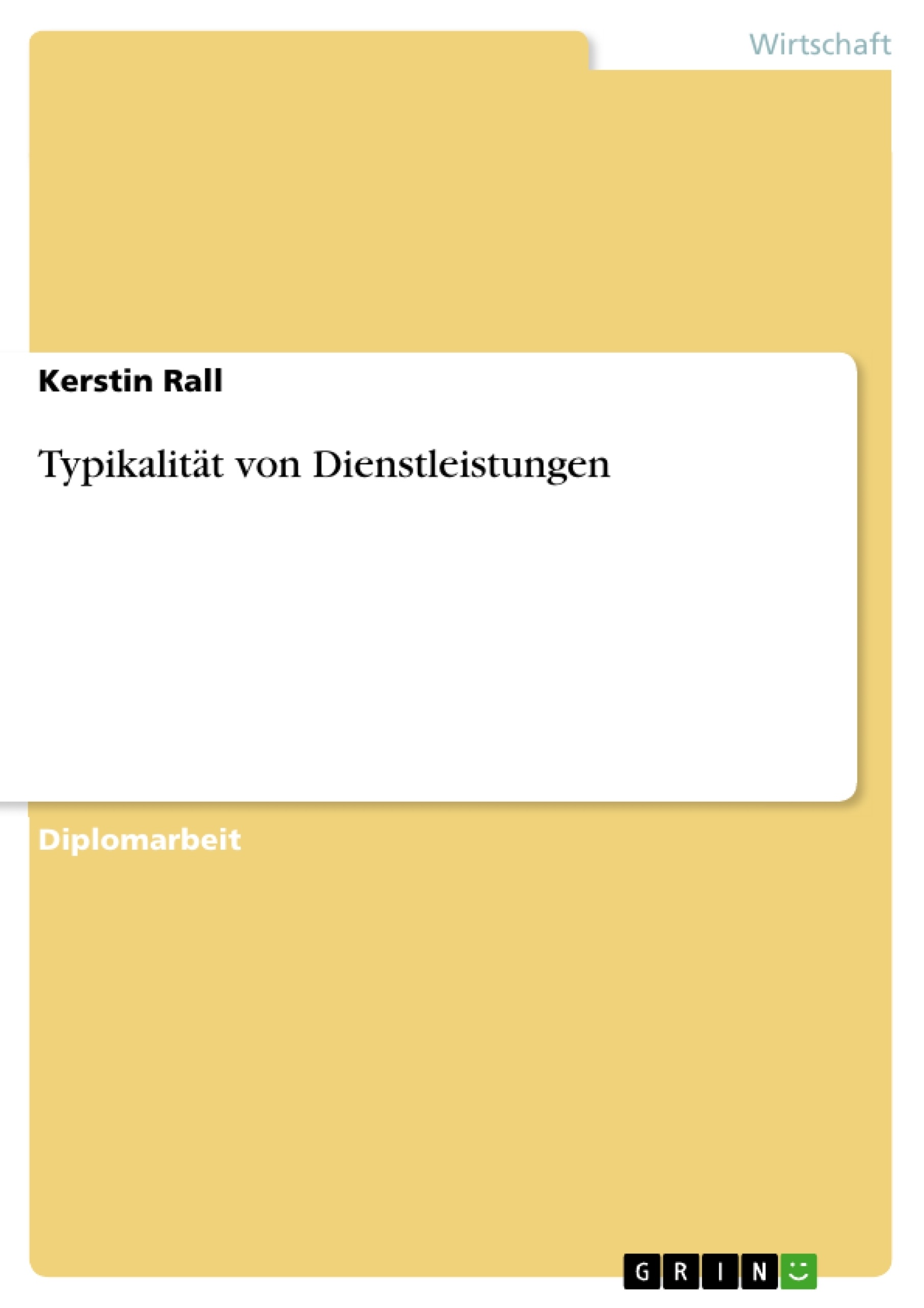Seit den 1960er Jahren sind Deutschland und andere hoch entwickelte Gesellschaften durch einen tiefgreifenden Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft geprägt. Die heutige dominierende Stellung des Tertiären Sektors lässt sich an Merkmalen wie der Bruttowertschöpfung und der Beschäftigung ableiten, aber auch aus der Tatsache, dass Dienstleistungen nicht mehr nur von klassischen Dienstleistungsunternehmen sondern zunehmend auch von Sachgüterunternehmen angeboten werden. So existieren zwar einige wenige Absatzleistungen, die ausschließlich aus Dienstleistungen bestehen (z.B. ärztliche Beratung); es gibt allerdings keine Sachleistung, die ohne jeglichen, wenn auch mitunter geringen Dienstleistungsanteil abgesetzt werden kann (z.B. erklärungsbedürftige Gebrauchsgüter). Design und Werbung entscheiden in der heutigen, schnelllebigen Welt mehr als je zuvor, ob und wie sich ein Produkt oder eine Dienstleistung im Markt etablieren kann. Doch was entscheidet letztendlich über Erfolg oder Misserfolg? Welche kognitiven Prozesse laufen im Konsumenten ab, wenn es um die Frage geht, ein typisches oder untypisches Produkt zu kaufen bzw. eine vertraute oder eine neuartige Dienstleistung in Anspruch zu nehmen? Die kognitive Psychologie bietet hierzu einige interessante Ansätze, die im Zuge dieser Arbeit diskutiert werden sollen. Phänomene wie „Prototyp“ und „Typikalität“ stehen dabei im Mittelpunkt der Betrachtung. Sie wurden aus der psychologischen Literatur zur Kategorisierung übernommen und fanden in den letzten Jahren in verschiedenen Untersuchungen im Marketingbereich Anwendung. Demnach sind einzelne Beispiele unterschiedlich typisch für eine Kategorie. Typikalität ist demzufolge der Grad der Repräsentativität bzw. Kategoriezugehörigkeit. Allerdings konzentrieren sich die empirischen Studien bis heute fast ausschließlich auf Allgemeinbegriffe für Klassen von konkreten, sinnlich wahrnehmbaren Objekten oder Sachverhalten.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. PROBLEMSTELLUNG, ZIELSETZUNG UND GANG DER UNTERSUCHUNG
2. RELEVANZ DER DIENSTLEISTUNGSTYPIKALITÄT FÜR DAS MARKETING
2.1. Der Begriff der Dienstleistung
2.2. Besonderheiten beim Absatz von Dienstleistungen
2.3. Der Begriff der Typikalität
2.4. Typikalität als Einflussgröße des Konsumentenverhaltens
3. TYPIKALITÄT IM KONTEXT DER KOGNITIONSPSYCHOLOGIE
3.1. Informationsverarbeitung und Gedächtnis
3.1.1. Prinzipien menschlicher Informationsverarbeitung
3.1.1.1. Modelle der Informationsverarbeitung
3.1.1.2. Prinzipien der menschlichen Informationsverarbeitung
3.1.1.3. Formen der Informationsverarbeitung
3.1.2. Prozedurales vs. Deklaratives Gedächtnis
3.2. Wissen und seine Struktur
3.2.1. Psychometrischer Ansatz
3.2.2. Netzwerk-Ansatz
3.2.3. Schemata und Skripte
3.3. Wahrnehmung und Kategorisierung
3.3.1. Wahrnehmungsprozess und Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und issen
3.3.2. Kategorisierung und ihre Determinanten
3.3.2.1. Kategorisierungsprozess und gradiententheoretische Modelle
3.3.2.2. Hierarchieebenen von Begriffen
4. DETERMINANTEN, WIRKUNGEN UND MESSUNG DER TYPIKALITÄT VON DIENSTLEISTUNGEN
4.1. Einführung und Definition
4.2. Determinanten der Typikalität
4.2.1. Attribute Sharing
4.2.1.1. Familienähnlichkeit
4.2.1.2. Feature-Similarity Approach nach Tversky
4.2.2. Vertrautheit und Häufigkeit der Instantiierung
4.2.2.1. Vertrautheit
4.2.2.2. Begriffsspezifische Exemplar-Häufigkeit
4.2.3. Einstellung zu einem Exemplar und Attributgewichtung
4.2.3.1. Ähnlichkeit zu Idealen bzw. Ad hoc-Begriffe und Ziel-Begriffe
4.2.3.2. Attributstruktur
4.2.4. Einflüsse des Kontextes
4.3. Wirkungen der Typikalität
4.3.1. Typikalität und Verarbeitungsprozesse
4.3.2. Typikalität und Risikoempfinden
4.3.3. Typikalität und Produktbeurteilung
4.4. Messung der Typikalität
4.4.1. Direkte Urteilsmethoden
4.4.2. Produktionsmethoden
5. IMPLIKATIONEN FÜR DAS MARKETING
6. ZUSAMMENFASSUNG
Literaturverzeichnis
Ehrenwörtliche Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Problemstellung, Zielstellung und Gang der Untersuchung
Seit den 1960er Jahren sind Deutschland und andere hoch entwickelte Gesellschaften durch einen tiefgreifenden Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft geprägt. Die heutige domi-nierende Stellung des Tertiären Sektors lässt sich an Merkmalen wie der Bruttowertschöp-fung und der Beschäftigung ableiten, aber auch aus der Tatsache, dass Dienstleistungen nicht mehr nur von klassischen Dienstleistungsunternehmen sondern zunehmend auch von Sach-güterunternehmen angeboten werden. So existieren zwar einige wenige Absatzleistungen, die ausschließlich aus Dienstleistungen bestehen (z.B. ärztliche Beratung); es gibt allerdings keine Sachleistung, die ohne jeglichen, wenn auch mitunter geringen Dienstleistungsanteil abgesetzt werden kann (z.B. erklärungsbedürftige Gebrauchsgüter).
Design und Werbung entscheiden in der heutigen, schnelllebigen Welt mehr als je zuvor, ob und wie sich ein Produkt oder eine Dienstleistung im Markt etablieren kann. Doch was entscheidet letztendlich über Erfolg oder Misserfolg? Welche kognitiven Prozesse laufen im Konsumenten ab, wenn es um die Frage geht, ein typisches oder untypisches Produkt zu kaufen bzw. eine vertraute oder eine neuartige Dienstleistung in Anspruch zu nehmen? Die kognitive Psychologie bietet hierzu einige interessante Ansätze, die im Zuge dieser Arbeit diskutiert werden sollen. Phänomene wie „Prototyp“ und „Typikalität“ stehen dabei im Mittelpunkt der Betrachtung. Sie wurden aus der psychologischen Literatur zur Kategorisie-rung übernommen und fanden in den letzten Jahren in verschiedenen Untersuchungen im Marketingbereich Anwendung. Demnach sind einzelne Beispiele unterschiedlich typisch für eine Kategorie. Typikalität ist demzufolge der Grad der Repräsentativität bzw. Kategoriezu-gehörigkeit. Allerdings konzentrieren sich die empirischen Studien bis heute fast ausschließ-lich auf Allgemeinbegriffe für Klassen von konkreten, sinnlich wahrnehmbaren Objekten oder Sachverhalten.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu diskutieren, ob und inwieweit sich das Typikalitätsphänomen, insbesondere seine Determinanten, die Wirkungen sowie dessen Messung, auf Dienstleis-tungen übertragen lässt.
Kapitel 2 soll zunächst die Relevanz der Dienstleistungstypikalität für das Marketing aufzeigen. Ausgehend von der Dienstleistungsdefinition und der sich daraus ergebenden Besonderheiten beim Absatz, wird anschließend der Begriff der Typikalität konkretisiert und sein Einfluss auf das Konsumentenverhalten verdeutlicht. Im Anschluss daran gibt Kapitel 3 einen Überblick über die wissensbasierte Informationsverarbeitung mit dem Ziel, zu verdeutlichen, wo sich die Typikalität in diesem Kontext einordnen lässt. Von den Prinzipien der menschlichen Informationsverarbeitung und dem Aufbau des Gedächtnisses ausgehend, werden verschiedene Ansätze der Wissensrepräsentation erläutert. Dabei stehen Schemata und Skripte als fundamentale Bestandteile des Gedächtnisses sowie deren Einfluss auf die Informationsverarbeitung im Mittelpunkt der Betrachtung. Daraufhin wird auf den Wahrnehmungsprozess und den mit ihm verbundenen Prozess der Kategorisierung eingegangen, indem die Typikalität eine bedeutende Stellung einnimmt. Das vierte Kapitel stellt den Schwerpunkt der Arbeit dar. Zunächst wird ein Überblick über bisherige Forschungen zum Typikalitätsphänomen gegeben. Nachfolgend werden verschiedene Einflussfaktoren der Typikalität herausgestellt, allgemeine und auf das Marketing bezogene Wirkungen beschrieben sowie verschiedene Methoden zur Messung der Typikalität vorgestellt. Dabei wird jeweils ein Überblick über Forschungsergebnisse der vorliegenden Literatur gegeben und im Anschluss daran diskutiert, inwieweit sich diese Darstellungen auf Dienstleistungen übertragen lassen. Das 5. Kapitel beschäftigt sich schließlich mit der praktischen Anwendbarkeit und Nutzbarkeit des Wissens über Typikalität für das Marketing und soll eine Auswahl von Aktionsmöglichkeiten aufzeigen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und Erkenntnisse ab (6. Kapitel).
2. Relevanz der Dienstleistungstypikalität für das Marketing
2.1. Der Begriff der Dienstleistung
Der Dienstleistungssektor stellt sich als außerordentlich heterogen dar. So sind unter anderem Banken, Touristik, Beratung, EDV, Telekommunikation und Transportleistungen unter dem Dienstleistungsbegriff subsumiert. Daraus ergeben sich Schwierigkeiten beim Aufstellen allgemeiner Aussagen über Dienstleistungen. So ist es bisher nicht gelungen, zu einer einheitlichen Definition für den Begriff der Dienstleistung zu gelangen. Allen Versuchen, die Dienstleistung zu definieren, liegt die Abgrenzung von Dienstleistungen gegenüber Sachgütern zugrunde. Die in der Literatur vorzufindenden Definitionsansätze lassen sich in drei Gruppen unterteilen.
Der enumerative Ansatz versucht den Dienstleistungsbegriff über die Aufzählung von Beispielen einzugrenzen. Problematisch dabei ist, dass im Einzelfall keine konkrete Richt-linie vorliegt, um zu entscheiden, ob es sich um eine Dienstleistung handelt oder nicht (Oppermann 1998, S. 20).
Ein weiterer Definitionsansatz ist der der Negativdefinition zu Sachgütern, wonach all jene Produkte Dienstleistungen sind, die keine Sachleistungen darstellen. Auch dieser Ansatz bleibt unbefriedigend, da nicht herausgestellt wird, durch welche operationalisierbaren Attribute sich Dienstleistungen letztlich auszeichnen.
Der zweckmäßigste Ansatz definiert den Dienstleistungsbegriff explizit über konstitutive Merkmale. In der Literatur zur Definition über konstitutive Merkmale ist eine Dreiteilung des Dienstleistungsbegriffes in Dienstleistungspotenzial, Dienstleistungsprozess und Dienstleis-tungsergebnis auszumachen. Als wesentliches Merkmal von Dienstleistungen bezüglich ihres Potenzials wird die Immaterialität des Angebotes angesehen. Da der Dienstleistungsprozess die Nachfrage nach einer bestimmten Leistung voraussetzt, kann nur das Dienstleistungs-potenzial, welches sich aus Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit zusammensetzt, angeboten werden. Der Dienstleistungsprozess ist vor allem durch die Notwendigkeit der Einbringung eines externen Faktors durch den Nachfrager gekennzeichnet, um die Dienst-leistung erstellen zu können. Als externer Faktor kommen Lebewesen (Nachfrager), Objekte des Nachfragers (Auto zur Reparatur) sowie Nominalgüter wie Informationen (bei Rechtsbe-ratung) oder Geld (Anlageberatung und Wertpapierverkauf) in Frage. Entscheidend für eine Dienstleistung ist auch der synchrone Kontakt der Marktpartner bzw. von deren Objekten, also die Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsumtion der Leistung (sog. Uno-actu-Prinzip). Das bedeutet ebenfalls, dass Dienstleistungen nicht auf Vorrat produziert (Nicht-lagerfähigkeit) und nicht an einem anderen Ort als dem ihrer Erstellung konsumiert werden können (Nichttransportfähigkeit). Die ergebnisorientierte Sichtweise sieht als Dienstleistung das Ergebnis eines Prozesses an, welches immer immaterieller Natur ist.
Zusammenfassend kann der Begriff der Dienstleistung in Anlehnung an Meffert und Bruhn (2003, S. 30) wie folgt definiert werden:
„Dienstleistungen sind selbständige, marktfähige Leistungen, die mit der Bereitstellung (zum Beispiel Versicherungsleistungen) und/ oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten (zum Beispiel Friseurleistung) verbunden sind (Potenzialorientierung). Interne (zum Beispiel Geschäftsräume, Personal, Ausstattung) und externe Faktoren (also solche, die nicht im Einflussbereich des Dienstleisters liegen) werden im Rahmen des Erstellungsprozesses kombiniert (Prozessorientierung). Die Faktorenkombination des Dienstleistungsanbieters wird mit dem Ziel eingesetzt, an den externen Faktoren, an Menschen (zum Beispiel Kunden) oder deren Objekten (zum Beispiel Auto des Kunden) nutzenstiftende Wirkungen (zum Beispiel Inspektion beim Auto) zu erzielen (Ergebnisorientierung).“
2.2. Besonderheiten beim Absatz von Dienstleistungen
Ausgehend von den konstitutiven Merkmalen von Dienstleistungen lassen sich grundsätz-liche Besonderheiten des Dienstleistungsmarketing ableiten, die auf der Immaterialität des Leistungsangebotes, der Integration des externen Faktors sowie der Immaterialität des Dienstleistungsergebnisses beruhen. Insgesamt gesehen zeichnen sich Dienstleistungen durch große Unsicherheiten und folglich durch ein hohes Risikoempfinden seitens der Nachfrager aus. Dies soll im Folgenden wieder anhand der drei Dimensionen Dienstleistungspotenzial, Dienstleistungsprozess und Dienstleistungsergebnis verdeutlicht werden.
Dienstleistungen können nur als Leistungsversprechen angeboten werden, so dass der Abnehmer zum Zeitpunkt des Angebotes das Problem hat, die Nutzenstiftung antizipieren und die Qualität der Dienstleistung beurteilen zu können. Dienstleistungen sind bezüglich der Immaterialität des Leistungsangebotes durch Informationsarmut gekennzeichnet, das heißt, sie vermitteln weniger Informationen als Sachleistungen. Infolgedessen werden von den Dienstleistungsinteressenten an Stelle des eigentlichen Produkts oft Surrogat- und Schlüssel-informationen herangezogen, um ihre Vorstellung vom Dienstleistungsangebot zu konkreti-sieren (Oppermann 1998, S. 53). Des Weiteren zeichnen sich Dienstleistungen durch Informationsasymmetrie zwischen Anbieter und Nachfrager aus, denn zwischen ihnen liegt eine ungleiche Verteilung der verfügbaren Informationen vor. Während der Dienstleister vollständige Kenntnis über das eigene Leistungspotenzial und sein Know-how hat, ist der potentielle Abnehmer hierüber nur unzureichend informiert und hat somit keine Sicherheit über die Relevanz, Vollständigkeit und Wahrheit der erhaltenen Informationen (Oppermann 1998, S. 54). Auch hierdurch wird die Einschätzung der letztendlichen Nutzenstiftung der Dienstleistung eines bestimmten Anbieters für den Nachfrager erschwert. Oftmals kann der Abnehmer nicht einmal in der Nachkaufphase zu einem Urteil über die Qualität gelangen, da ihn häufig erst sein mangelndes Know-how dazu veranlasst, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen (z.B. Werkstattbesuch, Beratung eines Arztes). Demzufolge erweist sich auch die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Dienstleistungsangebote als schwierig. Somit lässt sich festhalten, dass die Kaufentscheidung bei Dienstleistungen stets unter Qualitätsunsicherheit und Ungewissheit hinsichtlich der Nutzenstiftung getroffen wird. Das wahrgenommene Risiko beim Dienstleistungskauf wird demnach als relativ hoch eingeschätzt. Meffert und Bruhn (2003, S. 80 f.) sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem hohen Anteil an Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften, die einer Dienstleistung eigen sind, im Gegensatz zu den Sucheigenschaften, die bei Sachgütern überwiegen (Ansatz des informationsökono-mischen Dreiecks; siehe auch Nelson 1970, S. 312). Für Dienstleistungen im Restaurant, im Hotel oder beim Friseur wird angenommen, dass die Kunden in der Lage sind, die Leistun-gen nach der Nutzung zu beurteilen, da sie einen hohen Anteil an Erfahrungseigenschaften besitzen, wohingegen sie dazu beim Arzt oder Automechaniker aufgrund des hohen Anteils an Vertrauenseigenschaften oft nicht fähig sind (Nerdinger 1994, S. 48; Ostrom/ Iacobucci 1995, S. 19 f.).
Aus der Integration des externen Faktors, als zweites Merkmal von Dienstleistungen, ergeben sich ebenfalls einige Besonderheiten im Dienstleistungsprozess. So trägt die Interaktions-bereitschaft des Nachfragers entscheidend zur Qualität und damit zur Nutzenstiftung einer Dienstleistung bei (z.B. kann ein Berater nur so gut sein, wie die Informationen, die ihm durch den Kunden gegeben werden). Hierbei kann es jedoch aufgrund individueller Schwan-kungen seitens der Nachfrager zu Inkonstanzen in der Dienstleistungsqualität kommen. Somit ergibt sich aus der Integration des externen Faktors, dass der Nachfrager selbst die Qualität der Dienstleistung mitbestimmt und so eine Teilverantwortung für das Dienstleis-tungsergebnis trägt.
Schließlich ergeben sich auch aus der Immaterialität des Dienstleistungsergebnisses Konsequenzen, die denen ähneln, die schon anfangs aus dem immateriellen Dienstleistungs-angebot resultierten. Die Bewertung der Qualität und somit auch der Nutzenstiftung des Dienstleistungsergebnisses erweist sich aufgrund der Immaterialität oftmals auch in der Nachkaufphase als schwierig (z.B. Arztleistung).
2.3. Der Begriff der Typikalität
Es ist im Allgemeinen nicht so einfach, Begriffe zu definieren und voneinander abzugrenzen, wie das in der klassischen Begriffstheorie den Eindruck macht. Bspw. kann bereits die Beantwortung von Alltagsfragen wie „Zählt Kürbis zu Obst oder zu Gemüse?“ oder die Frage, worin sich eine Tasse genau von einem Becher oder von einer Schüssel unterscheiden lässt, problematisch erscheinen. Dass die Vertreter des logischen Ansatzes dennoch behaup-tet haben, es gäbe exakt festgelegte Merkmalskataloge und klar definierte Grenzen, wird unter anderem damit erklärt, dass sie nur einfache, künstliche Begriffe mit wenigen, diskreten Merkmalen in ihren Laborversuchen verwendet haben (Rosch 1975b, S. 193).
Ende der 60er Jahre vollzog sich innerhalb der Begriffsbildungsforschung ein Paradigmen-wechsel, in dessen Verlauf das sog. klassische Paradigma der Begriffsbildung, welches davon ausging, dass alle Begriffe in gleicher Weise typische Exemplare von Klassen sind, es also keine Exemplare gäbe, die typischer seien als andere, durch das von Eleanor Rosch eingeführte Prototypen-Paradigma verdrängt wurde. Sie experimentierte mit alltagsnahen Begriffen und kam zu gänzlichen neuen Ergebnissen. Begriffsexemplare sind nicht gleichbe-rechtigt. Sie variieren hinsichtlich ihrer Repräsentativität. Es gibt typische und weniger typische Kategorienexemplare. Die Zugehörigkeit von Exemplaren zu einer Kategorie wird also als abgestuft wahrgenommen. Besonders typische, hervorstechende Vertreter sind die Prototypen. Sie sind die Mitglieder einer Kategorie, welche die meisten Gemeinsamkeiten mit allen anderen Begriffsinstanzen haben und deren zentrale Merkmale summarisch reprä-sentieren. An ihnen orientiert sich die Klassenbildung im Gedächtnis (Rosch 1975b, S. 193).
Die Abgestuftheit der Begriffszugehörigkeit ergibt sich durch die unterschiedliche Ähnlich-keit konkreter Exemplare zu diesem abstrakten Prototyp. Folglich erstreckt sich die Reprä-sentation einer Kategorie von den typischsten Elementen über die atypischen Elemente bis hin zu den Nicht-Elementen, die den wahren Elementen der Kategorie am unähnlichsten sind (Barsalou 1985, S. 629). Der Begriff Gradientenstruktur bezieht sich auf das Verhalten, wie die Menschen die Exemplare einer Kategorie ihrer Typikalität gemäß ordnen, wie sie eine Rangfolge innerhalb einer Kategorie bilden.
Wir haben hier demgemäß zwischen zwei Begriffen zu unterscheiden: (Proto-)Typikalität und Prototyp. Während die Typikalität als deskriptives Prinzip verstanden wird, das sich auf alle Arten von Kategorien übertragen lässt, wird der Prototyp als psychologisch reales Element der kognitiven Verarbeitung von Kategorien aufgefasst.
Unter Typikalität wird demzufolge verstanden, dass die einzelnen Beispiele als unterschied-lich typisch für einen Begriff erscheinen. Das Phänomen der Typikalität ist fest in unseren Urteilen und Reaktionen verankert, worauf im Kapitel 2.4. eingegangen werden soll. Bspw. stimmen die meisten Menschen darin überein, dass eine Dogge ein typischerer Hund ist als ein Pekinese, ein Hammer ein typischeres Werkzeug als eine Drahtbürste oder ein Stuhl ein typischeres Möbelstück als eine Lampe (Hoffmann/ Ziessler 1982, S. 48).
In diesem Zusammenhang sei auf den Begriff der Schemakongruenz hingewiesen, welcher von Meyer-Levy/ Tybout (1989) synonym für Typikalität verwendet wird. Sie untersuchten, wie sich das Kongruenzniveau zwischen Produkten und ihren assoziierten Produktkategorie-schemata auf die Verarbeitung und Beurteilung der Produkte durch den Konsumenten aus-wirkt. Dabei lassen sich zwei Extremfälle herausstellen. Einerseits bietet sich der Fall der kompletten Übereinstimmung (‚match’) zwischen einem Produkt und einem aktivierten Produktkategorieschema. Demgegenüber steht eine komplette Inkongruenz (‚mismatch’) zwischen mehreren Eigenschaften eines Produkts und einem aktivierten Kategorieschema. In Wirklichkeit liegt die (In)Kongruenz zwischen einem Produkt und seinem assoziierten Produktkategorieschema jedoch zwischen den beiden Extremfällen: perfekte Übereinstim-mung und Unstimmigkeit.
2.4. Typikalität als Einflussgröße des Konsumentenverhaltens
Die wachsende Bedeutung von generischen Produkten (no name), Handelsmarken (private labels) und „me-too“-Produkten könnte ein Faktor sein, der das derzeitige Interesse für den Einfluss der Produkttypikalität auf das Konsumentenverhalten geweckt hat. Ganz allgemein betrachtet, werden typischere Exemplare einer Kategorie von Kindern früher gelernt als atypische Exemplare, schneller klassifiziert und ins Gedächtnis gerufen und sogar als Vergleichsmaßstab für andere Produkte genutzt. Des Weiteren werden typischere Produkte von Konsumenten eher bevorzugt (Ward/ Loken 1988, S. 55).
Vor allem der letztgenannte Aspekt steht im Mittelpunkt vieler Experimente und Untersu-chungen, also der Zusammenhang zwischen Typikalität und Produktbeurteilung bzw. Einstellung. Veryzer und Hutchinson (1998, S. 376) schreiben dazu, dass typischere Produk-te von Konsumenten eher bevorzugt werden, weil sie gewohnter und geläufiger sind. Mandler (1982) stellte zu diesem Aspekt die Theorie auf, dass der Grad der Übereinstim-mung zwischen einem Produkt und einem allgemeineren Produktschema die Informations-verarbeitung und dadurch ebenso die Produktbeurteilung beeinflusst. Mäßige Inkongruenz zwischen Produkten und ihrem assoziierten Kategorieschema stimulieren danach eine Auseinandersetzung, die zu einer vorteilhafteren Beurteilung führt als Produkte, die entweder kongruent oder sehr inkongruent mit dem Kategorieschema sind. Menschen mögen Dinge, die mit ihren Erwartungen übereinstimmen und Vorhersagbarkeit erlauben und somit das empfundene Risiko minimieren (siehe Meyers-Levy/ Tybout 1989, S. 40).
Allerdings besteht nicht immer ein positiver Zusammenhang zwischen Typikalität und Einstellung (Loken/ Ward 1990, S. 124). Konsumenten suchen nach Abwechslung, Prestige sowie Seltenem und Andersartigem, d.h. sie bevorzugen in diesem Fall Produkte, die untypisch sind. Auf diese unterschiedlichen Ansätze zum Zusammenhang zwischen Typika-lität und Einstellung soll in Kapitel 4.3.3. genauer eingegangen werden.
Häufig wird in der Literatur zur Kategorisierung auch auf den Aspekt des Bewusstseins für Produkte („awareness set“) eingegangen, der ebenfalls in positiver Beziehung mit der Typikalität steht. So wurde herausgefunden, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Reaktionszeit für die Zuordnung von Objekten zu Kategorien für typischere Mitglieder einer Kategorie kürzer sind als für Mitglieder, die weniger repräsentativ sind. Diese Maße sind Indizes für das Produktbewusstsein und sollten mit der Leichtigkeit zusammenhängen, mit der ein Produkt aufgerufen werden kann, wenn der Bedarf nach einer bestimmten Produkt-klasse aufkommt. Das Bewusstsein des Konsumenten für ein Produkt oder seine Fähigkeit, dieses ins Gedächtnis zu rufen, wird als zentrale Determinante für die Auswahl eines Produktes angesehen und spielt daher eine entscheidende Rolle im Kontext des Konsumen-tenverhaltens (Nedungadi/ Hutchinson 1985, S. 498). Die Messung der Typikalität könnte Marketingfachleuten verstehen helfen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass ein Produkt in das ‚evoked set’ des Konsumenten gelangt. Unter dem ‚evoked set’ versteht man die Menge an Marken, die einem Verbraucher im Moment der Kaufentscheidung bewusst sind und für ihn als Kaufalternativen in Frage kommen (Nedungadi/ Hutchinson 1985, S. 498; Ward/ Loken 1986, S. 126). Produkte, die sich nicht darin befinden, haben keine Chance, planmäßig gekauft zu werden. Daher ist es für ein Unternehmen von Bedeutung, zu wissen, welche Attribute die Typikalität eines Produktes am meisten beeinflussen, um dem-entsprechend Produkte so zu gestalten und zu positionieren, dass sie schnell als Kategorie-mitglied ins Gedächtnis der Konsumenten gerufen werden (retrieval) und von dort aus ins ‚evoked set’ des Konsumenten gelangen können (Nedungadi/ Hutchinson 1985, S. 499).
Typikalität hat demzufolge eine große Relevanz für das Konsumentenverhalten. So hat der Grad der Typikalität eines Produktes Einfluss auf die Produktbeurteilung und darauf, wie schnell das Produkt und Informationen darüber in einer bestimmten Situation ins Gedächtnis des Konsumenten gerufen werden können und damit letztlich auch auf die Kaufentscheidung. Darüber hinaus erlauben typischere Produkte Vorausschaubarkeit und reduzieren das empfundene Risiko, welches gerade bei Dienstleistungen immens ist. Auf die verschiedenen Wirkungen von Typikalität wird in Kapitel 4.3. noch ausführlicher eingegangen.
3. Typikalität im Kontext der Kognitionspsychologie
Nachfolgend soll der Begriff der Typikalität in den Kontext der Wissenspsychologie eingeordnet werden. Zunächst werden dafür kognitionstheoretische Grundlagen menschlicher Informationsverarbeitung dargelegt und das Gedächtnis kurz dargestellt. Darauf aufbauend wird der Frage nachgegangen, welche Struktur dem Wissen unterliegt, wobei vor allem Schemata, als fundamentale Bestandteile des Gedächtnisses, im Mittelpunkt der Betrachtung stehen sollen. Anschließend wird dann auf den Wahrnehmungsprozess und den mit ihm verbundenen Prozess der Kategorisierung eingegangen, wobei die Typikalität eine bedeutende Stellung einnimmt. Typikalität ist ein wesentliches Charakteristikum der internen Struktur natürlicher Kategorien.
3.1. Informationsverarbeitung und Gedächtnis
3.1.1. Prinzipien menschlicher Informationsverarbeitung
3.1.1.1. Modelle der Informationsverarbeitung
Permanent nehmen wir Informationen auf, die unser Handeln in vielfältiger Form beein-flussen. Innere Vorgänge wie Aufmerksamkeit, Erinnern, Verstehen und Problemlösen, werden zunehmend als Aspekte der Informationsaufnahme und -verarbeitung, als Gegen-stand der Kognitionspsychologie abgehandelt. Kognitionspsychologie ist die Wissenschaft, die sich mit der menschlichen Informationsverarbeitung befasst. Dementsprechend stehen innere, gedankliche Zustände (kognitive Wissenseinheiten und -strukturen), Prozesse der Informationsverarbeitung wie Enkodierung, Speicherung, Informationsabruf sowie die Wissensbestände im Fokus des Kognitivismus, die uns u. a. in die Lage versetzen, Schluss-folgerungen zu ziehen, Sprachen zu verstehen und Probleme zu lösen (Binsack 2003, S.36; Wessels 1994, S.45).
Kognitionen lassen sich laut Trommsdorff (1998, S. 79) definieren als „[…] eigenständig bewusst zu machende Wissenseinheiten, d.h. als subjektives Wissen, das bei Bedarf zur Verfügung steht, sei es intern als gespeicherte Information, die durch Erinnern (Abrufen) verfügbar ist, sei es als externe Information, die durch Wahrnehmen (Aufnehmen) verfügbar wird“. In der gegenwärtigen Theorie werden kognitive Vorgänge im Menschen in Analogie zur elektronischen Informationsverarbeitung als Vorgang betrachtet, der Informationsaufnah-me, -verarbeitung und -speicherung umfasst. Wahrnehmen kann als Informationsaufnahme verstanden werden; Denken, Lernen und Problemlösen als Informationsverarbeitung; das Gedächtnis als Informationsspeicher; und das motorische Verhalten entspricht der Informa-tionsausgabe (Pflüger 1992, S. 1). Wessels (1994, S. 39) verdeutlicht dies am Beispiel des Lesens: Wir nehmen beim Lesen Buchstaben als visuelle Informationen auf, die wir dann nach ihrer Bedeutung enkodieren und anschließend abspeichern.
Die Kognitionsforschung hat Modelle der Informationsverarbeitung entwickelt, wobei die bekanntesten das Drei-Speicher-Modell nach Atkinson und Shiffrin (1968) sowie das Modell der Verarbeitungsebenen (Grad der Elaboriertheit) nach Craik und Lockhart (1972) sind, auf die an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.
Das Drei-Speicher-Modell geht von drei Speicherformen aus, in denen die gedankliche Verarbeitung von Reizen erfolgt: Sensorischer Speicher (Ultrakurzzeitspeicher), Kurzzeit-speicher, Langzeitspeicher (Kroeber-Riel/ Weinberg 2003, S. 225 ff.). Zunächst werden die auf das Individuum einwirkenden Reize, oftmals unbewusst, von den Sinnesorganen aufge-griffen und in den sensorischen Speicher geleitet, wo sie in unverarbeiteter sensorischer Form (z.B. visuelle und auditive Reize wie Form, Helligkeit, Lautstärke) abgelegt werden (Binsack 2003, S. 38; Kroeber-Riel/ Weinberg 2003, S. 226 f.). In Abhängigkeit von der Stärke der Aufmerksamkeit wird ein kleiner Teil dieser Sinneseindrücke für die weitere Verarbeitung in den Kurzzeitspeicher, die zentrale Verarbeitungseinheit, übernommen. Die zeitliche Kapazität des Kurzzeitspeichers ist auf wenige Sekunden begrenzt, und auch die mengenmäßige Kapazität ist gering (Trommsdorff 1998, S. 263). Dort werden die Reize zunächst entschlüsselt (Kroeber-Riel/ Weinberg 2003, S. 271). Zur Verarbeitung werden auch die intern im Langzeitgedächtnis gespeicherten Informationen benötigt, z.B. Erfahrun-gen, gelernte Argumente, Normen und Bewertungskriterien, die dazu ebenfalls in den zentralen Arbeitsspeicher übernommen werden müssen (Kroeber-Riel/ Weinberg 2003, S. 244; Trommsdorff 1998, S. 261 f.). Abschließend wird die Information systematisch in den Langzeitspeicher integriert und dort langfristig abgespeichert. Die Kapazität des Langzeitgedächtnisses ist nahezu unbegrenzt, es umfasst das gesamte individuelle Wissen.
Der Informationsverarbeitungsprozess innerhalb der kognitiven Psychologie wird im Wechselspiel mit dem gespeicherten Wissen betrachtet. Im Sinne des S-O-R-Paradigmas besteht Lernen aus eingehenden Informationen (S), dem Prozess der Interpretation und Speicherung (O) und dem veränderten (neuen) Wissen (R) als Resultat der Informations-verarbeitung. Die vorhandene Wissensstruktur beeinflusst wesentlich die Aufnahme, selektive Wahrnehmung, Interpretation und Speicherung der neuen Informationen (Binsack 2003, S. 36).
Das Drei-Speicher-Modell konkurriert mit dem Modell der Verarbeitungsstufen bzw. der Verarbeitungstiefe von Craig & Lockhart, das statt eines Durchlaufens von drei Speichern davon ausgeht, dass die Informationsverarbeitung in einer Reihe von Stufen erfolgt, wobei das Ausmaß an kognitiver oder semantischer Analyse in jeder Ebene zunimmt. Die flachen Level stehen dabei für eine Analyse der physikalischen oder sensorischen Charakteristika, wie bspw. Helligkeit oder Abstand zum Stimulus. Die tieferen Verarbeitungsstufen beinhalten die Analyse der Bedeutung, wofür der Mensch die Information der Umwelt mit anderen Informationen aus seinem Gedächtnis (Bilder, Erkenntnisse, Erfahrungen etc.) verknüpfen muss. D.h. die Stufen variieren mit der Verarbeitungstiefe, wobei eine höhere Tiefe mit einem größeren Ausmaß an kognitiven Aktivitäten bei der Informationsverarbei-tung einhergeht (Wessels 1994, S. 144). Entscheidend ist demnach nicht die Dauer des Memorierens, also des Einprägens der Information, sondern die Tiefe der Informationsver-arbeitung. Je intensiver und bedeutungshaltiger die Memorierung geschieht, desto besser ist die Gedächtnisleistung in Bezug auf diese Information, weil jede Informationsverarbeitung mehr oder weniger tiefe Gedächtnisspuren verursacht (Anderson 1996, S. 171). Dies wiederum beweist jedoch, dass Informationen nicht unbedingt der Vermittlung des Kurzzeit-gedächtnisses bedürfen, um ins Langzeitgedächtnis zu gelangen, und somit verliert die Theorie des Kurzzeitgedächtnisses ihre Gültigkeit. Die Behaltensleistung ist nicht abhängig vom Speicherort sondern von der Art des Informationsverarbeitungsprozesses. Doch auch das Modell der Verarbeitungsstufen wurde kritisiert. Insgesamt betrachtet, ist die Annahme der festen Folge von Verarbeitungsstufen und -tiefen als problematisch anzusehen.
Schließlich modifizierten Craik und Tulving (1975) das Modell dahingehend, dass sie konstatierten, die Erinnerungsleistung wäre nicht von der Verarbeitungstiefe, sondern vom Grad der Elaboriertheit der Enkodierung abhängig. Dieser wird sowohl durch das Ausmaß, in dem Begriffe mit anderen verknüpft oder organisiert werden, als auch durch den Grad der Auseinandersetzung mit einem einzelnen Begriff bestimmt. Möchte man sich z.B. zwei Begriffe merken, ist es sinnvoll, verschiedene Assoziationen z.B. mittels Vorstellungsbildern zwischen beiden zu erzeugen. Sie verwarfen die Hypothese der fixen Reihenfolge der Verarbeitungsstufen (Wessels 1994, S. 152). Der Grundgedanke des vorhergehenden Modells blieb jedoch bestehen, wonach eine tiefgehende bzw. elaborierte Informationsver-arbeitung die Erinnerungsleistung maßgeblich determiniert.
3.1.1.2. Prinzipien der menschlichen Informationsverarbeitung
Vor allem zwei Verarbeitungsgrundsätze zeichnen die Informationsverarbeitung aus: zum einen die Informationsverarbeitung unter limitierter kognitiver Kapazität und zum anderen die Tendenz zur Minimierung des kognitiven Aufwandes (Binsack 2003, S. 38).
Das zur Verfügung stehende Reizangebot überschreitet generell den Bedarf bzw. die Verarbeitungskapazität des Individuums. Der Grundsatz der begrenzten kognitiven Kapazität besagt demnach, dass wir nicht unbegrenzt viele Informationen aufnehmen und gleichzeitig verarbeiten können, und somit zur Selektion (Herausfiltern) der subjektiv wichtigen Informationen gezwungen sind (Trommsdorff 1998, S. 239; Binsack 2003, S. 38). Ebenso können aufgrund der übermäßigen Fülle an aufgenommenen Informationen nicht alle langfristig im Gedächtnis gespeichert werden, weshalb abermals eine Entscheidung darüber getroffen werden muss, welche der aufgenommenen Reize in den Arbeitsspeicher übernom-men werden, dessen zeitliche Kapazität nur wenige Sekunden beträgt und dessen mengen-mäßige Kapazität nur die Verarbeitung von ca. sieben Informationseinheiten gleichzeitig ermöglicht. Hierbei spielen u. a. Rückkopplungseffekte zwischen bereits gespeicherten Wissensstrukturen und neuen Informationen eine Rolle, die zu gezielter Aufmerksamkeit führen (Trommsdorff 1998, S. 244).
Damit in Verbindung stehen die selektive Ressourcenallokation und die Tendenz zur Minimierung des kognitiven Aufwandes. In Anbetracht seiner begrenzten kognitiven Kapazitäten ist der Mensch gewillt, eine übermäßige Inanspruchnahme der Kapazitäten zu vermeiden und mit seinen Ressourcen zu wirtschaften. Der kognitive Aufwand stellt die Menge aller kognitiven Ressourcen (Prozess- und Speicherkapazitäten) dar, die für die Bearbeitung einer kognitiven Aufgabe erforderlich sind (Binsack 2003, S. 41). Auf diese Weise können mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt werden, sofern alle zusammengenom-men nicht mehr Verarbeitungsfähigkeiten in Anspruch nehmen als zur Verfügung stehen (Wessels 1994, S. 97). Wie hoch der Aufwand zur Informationsverarbeitung tatsächlich ist, wird durch die Aktiviertheit und das Involvement eines Individuums beeinflusst. Als Aktiviertheit wird die Stärke des Erregungszustandes des Zentralnervensystems bezeichnet. Unter Involvement versteht man „[…] die auf Informationserwerb und -verarbeitung gerichtete Aktiviertheit bzw. die Motivstärke zu objektgerichteten (Informations-)Prozessen […]“ (Trommsdorff 1998, S. 42). Der kognitive Aufwand ist demnach umso größer, je höher die Aktiviertheit und das Involvement sind. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass der Mensch prinzipiell eine Minimierung seines kognitiven Aufwandes bezweckt und aus diesem Grund zu einer oberflächlichen Informationsverarbeitung tendiert (Binsack 2003, S. 41). Im Informationsverarbeitungsprozess fällt es somit auch einfacher, auf bestehendes Wissen zurückzugreifen, als neue Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten (Binsack 2003, S. 42). Die Kognitionen, die mit der neuen Information in Verbindung gebracht werden, bewirken die Reizinterpretation, ohne dass jeweils eine gänzlich neue, umfangreiche Informationsverarbeitung stattfinden muss (Trommsdorff 1998, S. 264).
3.1.1.3. Formen der Informationsverarbeitung
Zum einen lassen sich Verarbeitungsprozesse dahingehend differenzieren, ob sie automatisch oder strategisch erfolgen. Automatische Prozesse laufen im Unterbewusstsein ab und sind nicht absichtlich beeinflussbar. Da sie erlernt sind, laufen sie immer wieder in routinierter Weise ab und erfordern keine (bzw. wenig) Aufmerksamkeit sowie Verarbeitungskapazität (Anderson 1996, S. 90; Binsack 2003, S. 42; Wessels 1994, S. 104 f.). Hingegen sind strategische oder, wie Anderson (1996, S. 90) sie bezeichnet, kontrollierte Prozesse bewusst ablaufende Prozesse, die kognitive Kontrolle erfordern und somit Aufmerksamkeit beanspruchen. Sie lassen sich gezielt beeinflussen (Anderson 1994, S. 90; Binsack 2003, S. 42). Prozesse des Denkens und Problemlösens fallen unter diese Definition. Beide Prozessformen stehen bei der Informationsverarbeitung in Verbindung miteinander. So geben automatische Prozesse vor, welche Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden. Wie dann mit ihnen verfahren wird, geht von den strategischen Prozessen aus (Binsack 2003, S. 43).
Andererseits lassen sich Verarbeitungsprozesse auch in datengesteuerte (stimulus-based) und konzeptgesteuerte (memory-based) Prozesse unterteilen. Datengesteuerte (auch „bottom-up“ genannt) Verarbeitung nennt man die Art der Informationsverarbeitung, die durch die herein-kommenden sensorischen Daten, also externe Stimuli, veranlasst und geleitet wird (Wessels 1994, S. 70; Binsack 2003, S. 43). Die Schematheorie fügte der Informationsverarbeitungs-theorie gänzlich neue Erkenntnisse hinzu, die davon ausgehen, dass die Informationen teilweise „top-down“ verlaufen. Bei dieser konzeptgesteuerten (schemagesteuerten) Verarbeitung beruht die Informationsverarbeitung demnach auf bereits vorhandenem Wissen, Erfahrungen und Vorstellungen, die unsere Erwartungen lenken (Wessels 1994, S. 70; Binsack 2003, S. 43). Im Hinblick auf die Produktbeurteilung kann einerseits Attribut für Attribut eines Produktes einzeln aufgenommen und verarbeitet, also datengesteuert evaluiert werden. Andererseits können Erwartungen und bestehende Schemata das Urteil bestimmen. Somit erfolgt die Beurteilung konzeptgesteuert. In der Regel interagieren beide Formen der Steuerung jedoch. Das Mischverhältnis ist unter anderem auch vom Konstrukt der Schema-kongruenz abhängig, das an späterer Stelle noch detailliert behandelt wird (Binsack 2003, S. 43).
3.1.2. Prozedurales vs. Deklaratives Gedächtnis
Gemeinhin wird das Gedächtnis definiert als die geistige Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern
und später zu reproduzieren oder wieder zu erkennen. In der Kognitionspsychologie versteht
man das Gedächtnis als ein aktiv wahrnehmendes kognitives System, das Informationen
aufnimmt, enkodiert, modifiziert, speichert und wieder abruft. Es ist somit als Ort des gespeicherten Wissens zu verstehen.
Das Langzeitgedächtnis speichert alle von außen eintreffenden und intern entstandenen Informationen, wie Gedanken, Werte und Meinungen. Je nach Typ der Informationen lässt sich das Langzeitgedächtnis in deklaratives und prozedurales Gedächtnis einteilen. Das deklarative Gedächtnis umfasst Wissen über Begriffe und ihre Beziehungen untereinander, Zustände sowie über Situationen und Ereignisse. Es wird auch Faktenwissen genannt. Deklaratives Wissen ist prinzipiell explizit, d.h. bewusst zugänglich. Somit können wir seine Inhalte sprachlich wiedergeben (Kroeber-Riel/ Weinberg 2003, S. 229 ff.; Trommsdorff 1998, S. 80). Es lässt sich wiederum in die beiden Teilsysteme des semantischen und episodischen Gedächtnisses gliedern. Das semantische Gedächtnis ist für die Speicherung grundlegender Bedeutungen von Wörtern und Begriffen zuständig. Es umfasst allgemeines, nicht autobiographisches, („Welt“-)Wissen über Objekte, Lebewesen und Ereignisse. Es beinhaltet das Faktenwissen, Interpretationsregeln und analytische Problemlösungsmuster (Trommsdorff 1998, S. 80 f.). Die Struktur des semantischen Wissens kann in einfache, wie z.B. Objektkonzepte (Stuhl, Baum), und komplexe Organisation unterteilt werden. Letztere beinhaltet relationale Konzepte und Wissensstrukturen, wie Skripte und Schemata, die im Kapitel 3.2.3. behandelt werden. Das episodische Gedächtnis dagegen speichert autobio-graphische Ereignisse, d.h. persönliche Erfahrungen (und Erinnerungen), die sich durch Ort- und Zeitbezug auszeichnen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Typikalität" bei Dienstleistungen?
Typikalität ist der Grad der Repräsentativität eines Exemplars für eine Kategorie, also wie "typisch" eine Dienstleistung (z.B. ein Bankbesuch) für ihre Gattung empfunden wird.
Was ist ein "Prototyp" im Marketing?
Ein Prototyp ist das ideale oder am stärksten mit Attributen der Kategorie ausgestattete Beispiel, an dem Konsumenten neue Dienstleistungen messen.
Wie beeinflusst Typikalität das Risikoempfinden?
Typische Dienstleistungen werden oft als weniger risikoreich wahrgenommen, da sie vertrauten Schemata und Skripten im Gedächtnis entsprechen.
Was sind "Schemata" und "Skripte" in der Kognitionspsychologie?
Schemata sind Wissensstrukturen über Objekte; Skripte sind zeitliche Abläufe von Ereignissen (z.B. der Ablauf eines Restaurantbesuchs), die die Informationsverarbeitung steuern.
Warum ist die Immaterialität von Dienstleistungen ein Problem für die Typikalität?
Da Dienstleistungen immateriell sind, fehlen oft sinnlich wahrnehmbare Merkmale, was die Kategorisierung und den Vergleich für den Konsumenten erschwert.
- Quote paper
- Dipl.-Kfr. Kerstin Rall (Author), 2004, Typikalität von Dienstleistungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54852