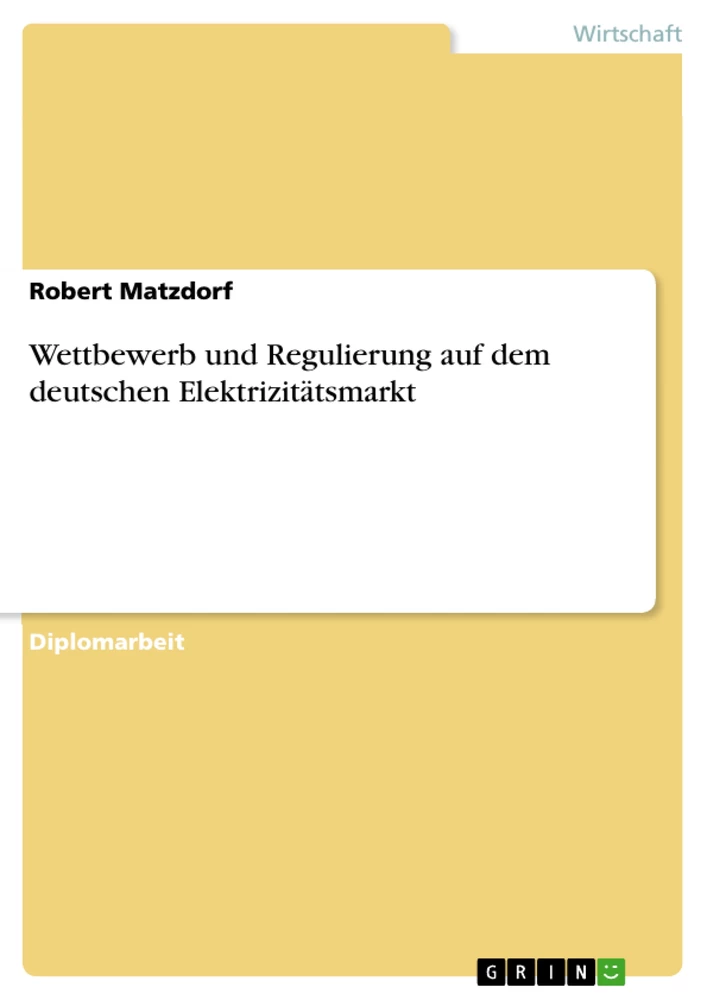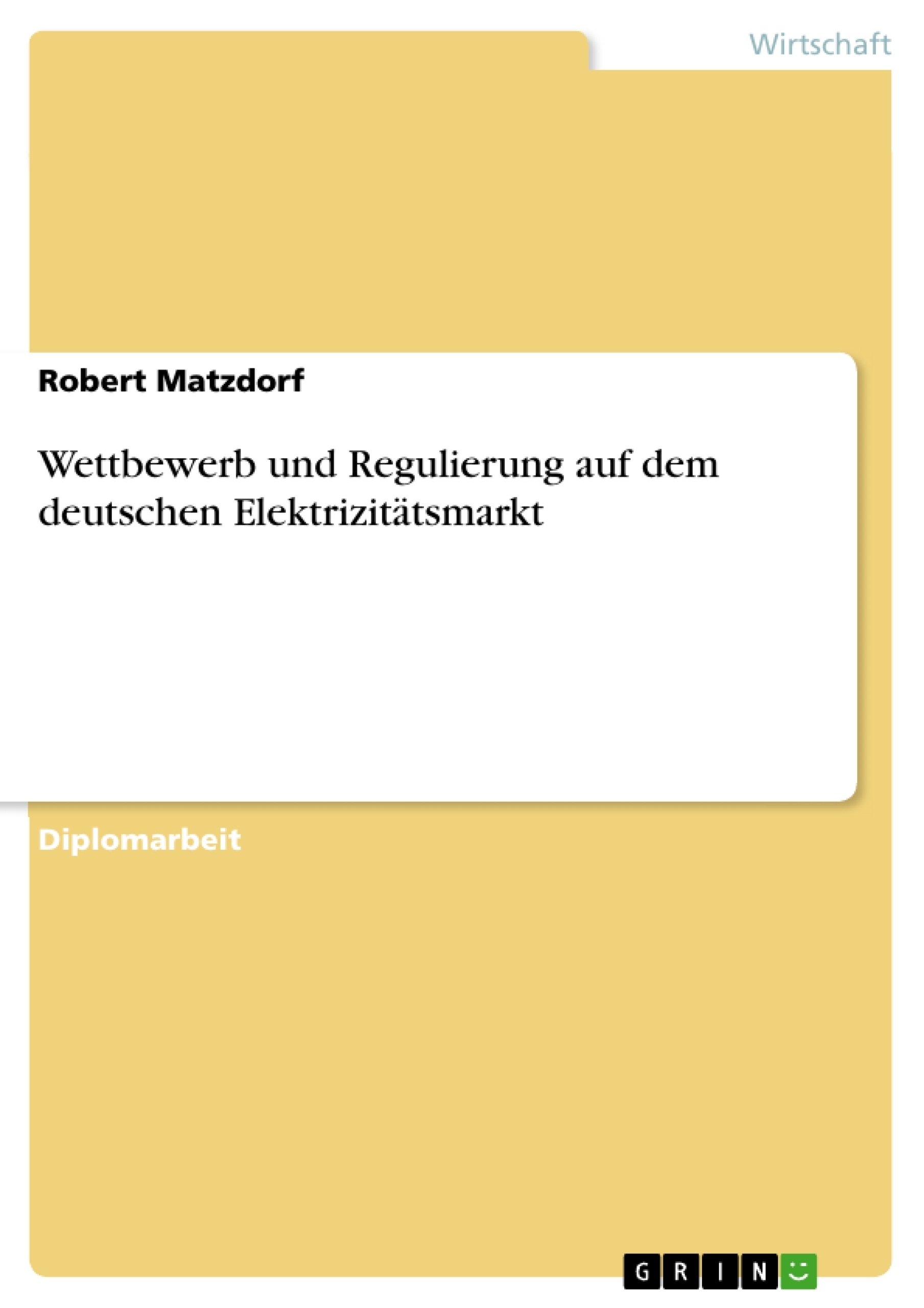Im Juli diesen Jahres war es endlich soweit. Mehr als zwölf Monate nach dem von der Europäischen Union geforderten Termin trat das neue deutsche Energiewirtschaftsgesetz in Kraft und setzte somit die EU-Richtlinie um, mit der die Liberalisierung des Binnenmarktes für Elektrizität und Gas beschleunigt werden soll. Damit reagierte man auf die Defizite bei der Umsetzung der bereits 1996 erlassenen Richtlinie zur Förderung von mehr Wettbewerb im Elektrizitätsbinnenmarkt. Trotz der Öffnung des deutschen Strommarktes 1998 musste die Monopolkommission in ihrem 15. Hauptgutachten im Sommer 2004 feststellen, dass sich im deutschen Elektrizitätssektor ein wettbewerbsloses Oligopol aus Verbundunternehmen herausgebildet hatte, das den deutschen Markt gegenüber Dritten abschottete. Darüber hinaus wurde bemängelt, dass die Netzzugangsentgelte der aus horizontalen und vertikalen Unternehmenszusammenschlüssen bestehenden Verbundwirtschaft im europäischen Vergleich zu hoch sind und dass dieses Problem durch das Kartellamt nicht in den Griff zu bekommen ist.1Dies ist insbesondere deshalb bedenklich, weil eine preisgünstige Stromversorgung ein wichtiger Standortfaktor für Energieintensive Industrien ist und somit im Wettbewerb mit anderen Ländern steht. Gerade gegenüber Billigstromländern wie beispielsweise Großbritannien, Schweden oder Polen hat Deutschland besonders schlechte Aussichten, in diesem Wettbewerb zu bestehen, da der Industriestrompreis hierzulande teilweise mehr als 50% über dem Niveau der anderen Staaten liegt. Daneben wirkt sich das überhöhte deutsche Strompreisniveau negativ auf die Kaufkraft der privaten Haushalte und damit auch auf die Binnennachfrage und das Wirtschaftswachstum aus. Ziel dieser Diplomarbeit ist es, den von regulativen Eingriffen geprägten Liberalisierungsverlauf und den damit einher gehenden Ordnungsrahmen der deutschen Elektrizitätswirtschaft zu analysieren, um anschließend einen Ausblick auf die mögliche zukünftige Entwicklung zu geben. Problematisch hierbei ist die Tatsache, dass sich der gesamte Stromsektor momentan im Umbruch befindet, da das neue Energiewirtschaftsrecht der Elektrizitätswirtschaft zahlreiche Fristen gewährt, um den gesetzlichen Vorgaben nachzukommen. Währenddessen ist die zuständige Regulierungsbehörde damit beauftragt, ein neues Regulierungsverfahren für den Netzbereich zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Besonderheiten und Rahmenbedingungen der Elektrizitätswirtschaft
- 2.1 Ursachen staatlicher Regulierung in der Elektrizitätswirtschaft
- 2.1.1 Das natürliche Monopol im Elektrizitätssektor
- 2.1.2 Externe Effekte
- 2.2 Besonderheiten des Elektrizitätssektors
- 2.3 Strompreise und Energiemix in Deutschland
- 2.4 Deutschland vor der Liberalisierung
- 3. Der Begin der Liberalisierung auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt
- 3.1 Die Binnenmarktrichtlinie Elektrizität
- 3.2 Das Energiewirtschaftsgesetz von 1998
- 3.2.1 Durchleitung und Netzzugang
- 3.2.2 Unbundling
- 3.2.3 Politische Sonderlasten
- 4. Die Reform des Ordnungsrahmens für die Elektrizitätswirtschaft 2005
- 4.1 Überblick über die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland
- 4.2 Unbundling im deutschen Energiewirtschaftsrecht
- 4.2.1 Rechtliche Entflechtung
- 4.2.2 Operationelle Entflechtung
- 4.2.3 Informationelle Entflechtung
- 4.2.4 Buchhalterische Entflechtung
- 4.3 Regulierung des Netzbetriebs in Deutschland
- 4.3.1 Aufgaben der Netzbetreiber
- 4.3.2 Netzanschluss
- 4.3.3 Netzzugang
- 4.3.4 Entgeltregulierungskonzepte des EnWG
- 4.3.5 Befugnisse der Regulierungsbehörde, Sanktionen
- 5. Instrumente zur Anreizregulierung
- 5.1 Yardstick Competition
- 5.2 Price-Cap-Regulierung
- 5.3 Revenue-Cap-Regulierung
- 5.4 Bewertung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Besonderheiten und Rahmenbedingungen der Elektrizitätswirtschaft, der Liberalisierung des deutschen Elektrizitätsmarktes und der Regulierung der Netzbetreiber. Der Fokus liegt auf der Analyse der Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Liberalisierung ergeben.
- Das natürliche Monopol im Elektrizitätssektor und die Rolle staatlicher Regulierung
- Die Entwicklung des deutschen Elektrizitätsmarktes im Kontext der Liberalisierung
- Die Regulierung des Netzbetriebs in Deutschland und die verschiedenen Entflechtungsmodelle
- Die Anwendung von Anreizregulierungsinstrumenten zur Steuerung des Wettbewerbs
- Die Auswirkungen der Regulierung auf den Strompreis und den Energiemix
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung - Dieses Kapitel liefert eine kurze Einleitung in die Thematik der Elektrizitätswirtschaft und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der Energiewende und der europäischen Integration.
- Kapitel 2: Besonderheiten und Rahmenbedingungen der Elektrizitätswirtschaft - Dieses Kapitel behandelt die besonderen Eigenschaften der Elektrizitätswirtschaft, die zu staatlicher Regulierung führen. Dazu gehören das natürliche Monopol, externe Effekte und die besonderen Eigenschaften des Elektrizitätssektors. Des Weiteren werden der Strompreis und der Energiemix in Deutschland analysiert. Abschließend wird die Situation des Elektrizitätsmarktes in Deutschland vor der Liberalisierung beschrieben.
- Kapitel 3: Der Begin der Liberalisierung auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt - Dieses Kapitel beleuchtet die entscheidenden Meilensteine der Liberalisierung des deutschen Elektrizitätsmarktes, insbesondere die Binnenmarktrichtlinie Elektrizität und das Energiewirtschaftsgesetz von 1998. Es werden wichtige Regulierungsmaßnahmen wie die Durchleitung und der Netzzugang sowie das Unbundling erläutert.
- Kapitel 4: Die Reform des Ordnungsrahmens für die Elektrizitätswirtschaft 2005 - Dieses Kapitel widmet sich der Reform des Ordnungsrahmens für die Elektrizitätswirtschaft im Jahr 2005. Es beschreibt die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland und analysiert das Unbundling im deutschen Energiewirtschaftsrecht. Darüber hinaus werden die Regulierung des Netzbetriebs, die Aufgaben der Netzbetreiber sowie die verschiedenen Entgeltregulierungskonzepte des EnWG behandelt.
- Kapitel 5: Instrumente zur Anreizregulierung - Dieses Kapitel stellt verschiedene Instrumente der Anreizregulierung vor, die zur Förderung des Wettbewerbs eingesetzt werden können. Es erläutert die Methoden der Yardstick Competition, der Price-Cap-Regulierung und der Revenue-Cap-Regulierung und bewertet die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Ansätze.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern der Elektrizitätswirtschaft, Regulierung, Liberalisierung, Wettbewerb, Netzbetrieb, Anreizregulierung, Unbundling, Energiewirtschaft, Energiewende und Energiemix.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Elektrizitätsmarkt ein "natürliches Monopol"?
Der Netzbetrieb gilt als natürliches Monopol, da es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, parallele Stromnetze aufzubauen. Daher muss der Zugang zu diesen Netzen staatlich reguliert werden.
Was bedeutet "Unbundling" in der Energiewirtschaft?
Unbundling bezeichnet die rechtliche, operationelle und buchhalterische Entflechtung von Netzbetrieb und Stromvertrieb, um Wettbewerbsverzerrungen durch vertikal integrierte Energiekonzerne zu verhindern.
Was änderte das Energiewirtschaftsgesetz von 2005?
Das Gesetz setzte EU-Richtlinien zur Beschleunigung der Liberalisierung um, stärkte die Regulierungsbehörde und führte neue Regeln für den Netzzugang und die Entgeltregulierung ein.
Was ist Anreizregulierung (z.B. Price-Cap)?
Anreizregulierung soll Netzbetreiber motivieren, effizienter zu arbeiten. Bei der Price-Cap-Regulierung werden Obergrenzen für Preise festgelegt, sodass Kosteneinsparungen dem Unternehmen als Gewinn verbleiben.
Wie wirkt sich die Regulierung auf den Industriestandort Deutschland aus?
Da Strompreise ein wichtiger Standortfaktor sind, zielt die Regulierung darauf ab, überhöhte Netzentgelte zu senken, um die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien zu sichern.
- Citation du texte
- Robert Matzdorf (Auteur), 2005, Wettbewerb und Regulierung auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54947