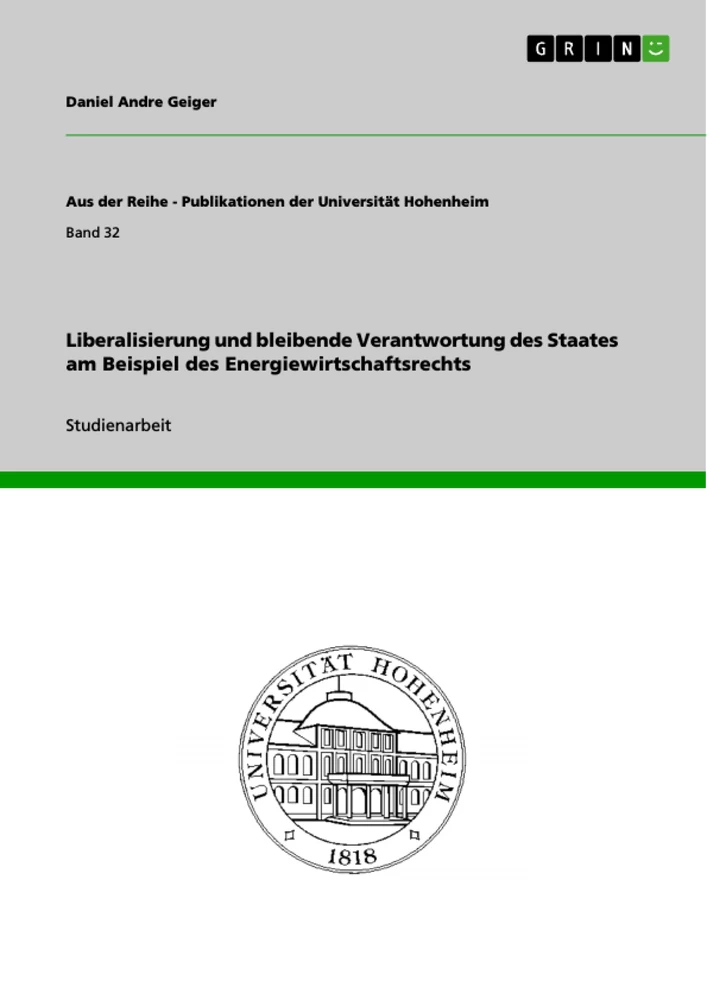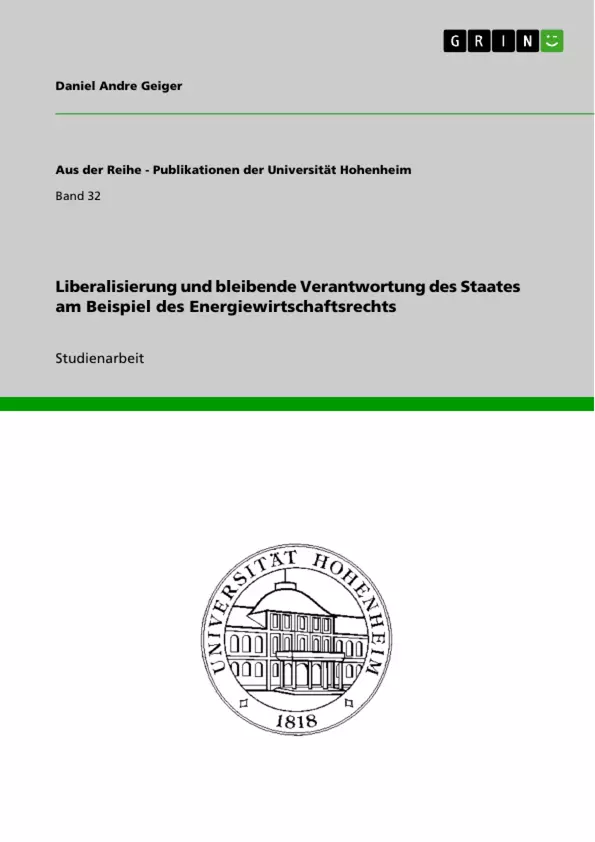Seit zwei Jahrzehnten unterliegen die Marktordnungen von Netzindustrien, Telekommunikation, Elektrizität, Bahn, Post, Wasser und Gas, weltweit tiefgreifenden Veränderungen. Immer häufiger werden ehemals staatliche Monopole aufgelöst und der Markt für Wettbewerber geöffnet. Dies gilt auch für die Elektrizitätsversorgung. Hatte noch bis in die 80er Jahre hinein die Versorgungssicherheit als energiepolitische Zielsetzung dominiert, lösten die Globalisierung der Produktmärkte, neue Entwicklungen in der Informationstechnologie sowie neue Erkenntnisse in der Wirtschaftswissenschaft einen Politikwechsel aus: Effizienzüberlegungen stehen seither mehr und mehr im Mittelpunkt. Rechtlich ging in Deutschland, wie in den meisten europäischen Ländern, der Impuls zur Liberalisierung vom Europarecht aus. Ohne Vorgaben aus Brüssel hätten die nationalen Gesetzgeber kaum je die Kraft zu grundlegenden Reformen gefunden.
In der vorliegenden Seminararbeit werde ich mich auf die Liberalisierung im Bereich der Stromversorgung konzentrieren. Die Liberalisierung in der Stromwirtschaft ist beispielhaft für die Liberalisierung in der Gaswirtschaft, in welcher die Liberalisierung beinahe zeitgleich erfolgte. Zunächst werde ich die frühere monopolistische Organisation der Stromversorgung beschreiben, Gründe für die Liberalisierung nennen und danach die bisherige Liberalisierung und deren Ergebnisse beschreiben. Da die Stromversorgung wegen der zahlreich berührten öffentlichen Interessen im Bereich des Sozialstaats und des Umweltschutzes besondere Anforderungen an die Ausgestaltung der Liberalisierung4 stellt, werde ich anschliessend fragen, woraus sich die bleibende Verantwortung des Staates ergibt und aufzeigen wie der Staat diese Verantwortung wahrnimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Einführende Definition und Überblick über die Liberalisierung der vergangenen Jahre
- Begriff der Liberalisierung
- Energiewirtschaftsgesetz von 1935 – Organisation der deutschen Energieversorgung bis 1998
- Gründe für die frühere, monopolistische Organisation der Elektrizitätsversorgung und die Liberalisierung der vergangenen Jahre
- Bisherige Liberalisierungsschritte
- Primärrechtliche Vorgaben
- Sekundärrechtliche Gestaltung des Energiebinnenmarktes
- Preistransparenzrichtlinie vom 29. Juni 1990 und Transitrichtlinie vom 29. Oktober 1990
- Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie vom 19. Dezember 1996
- Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie vom 26. Juni 2003
- Folgen der Liberalisierung
- Bleibende Verantwortung des Staates anhand der Zielsetzungen von § 1 I EnWG
- Verantwortung des Staates
- Versorgungssicherheit
- Versorgungssicherheit als Ausprägung verschiedener Grundrechte und Ergebnis des Sozialstaatsprinzips
- Gefährdung der Versorgungssicherheit durch die Liberalisierung
- Versorgungssicherheit im EnWG
- Preisgünstigkeit und Effizienz
- Preisgünstige Energieversorgung und Wettbewerb
- Verantwortung des Staates für eine preisgünstige und effiziente Energieversorgung
- Durchleitung und Art. 14 GG
- Konkrete Regelungen zur Preisgünstigkeit und zum Wettbewerb
- Anwendbarkeit des GWB
- Umweltschutz
- Verantwortung des Staates für den Schutz der Umwelt
- Umweltschutz im EnWG
- Verbraucherfreundlichkeit
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Liberalisierung der deutschen Stromversorgung im Kontext des Energiewirtschaftsrechts. Ziel ist es, die Entwicklung von der monopolistischen Organisation zur wettbewerbsorientierten Struktur darzustellen und die bleibende Verantwortung des Staates im Hinblick auf Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, Effizienz und Umweltschutz zu analysieren.
- Entwicklung der Stromversorgung in Deutschland von der Monopolstellung bis zur Liberalisierung
- Einfluss des europäischen Rechts auf die Liberalisierung des Energiemarktes
- Analyse der Zielsetzungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)
- Die Rolle des Staates in der Regulierung des liberalisierten Energiemarktes
- Spannungsfeld zwischen Liberalisierung und staatlicher Verantwortung im Bereich der Daseinsvorsorge
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den weltweiten Trend zur Liberalisierung von Netzindustrien, einschließlich der Elektrizitätsversorgung. Sie hebt den Wandel von der Versorgungssicherheit als dominierendem energiepolitischen Ziel hin zu Effizienzüberlegungen hervor und betont den Einfluss des europäischen Rechts auf diesen Prozess. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Liberalisierung der Stromversorgung als Beispiel für die Gaswirtschaft und untersucht die frühere Organisation, die Gründe der Liberalisierung, deren Ergebnisse sowie die bleibende Verantwortung des Staates.
Einführende Definition und Überblick über die Liberalisierung der vergangenen Jahre: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Liberalisierung im Kontext der wettbewerblichen Öffnung vormals monopolisierter Wirtschaftsbereiche und differenziert ihn von Deregulierung. Es beschreibt die Organisation der deutschen Energieversorgung bis 1998 anhand des Energiewirtschaftsgesetzes von 1935, das ein System mit hoher Verflechtung zwischen staatlicher und privater Ebene hervorbrachte. Die kartellrechtliche Ausnahme für die leitungsgebundene Stromversorgung wird erläutert, ebenso wie die staatliche Investitionskontrolle und die Tarifordnung für Elektrizität. Das Kapitel beleuchtet die Gründe für die frühere monopolistische Organisation und die Liberalisierungsschritte, einschließlich der relevanten Richtlinien der EU.
Bleibende Verantwortung des Staates anhand der Zielsetzungen von § 1 I EnWG: Dieses Kapitel analysiert die fortbestehende Verantwortung des Staates in der liberalisierten Stromwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Zielsetzungen von §1 I EnWG. Es untersucht die Versorgungssicherheit als Ausprägung verschiedener Grundrechte und das Ergebnis des Sozialstaatsprinzips, und diskutiert deren Gefährdung durch die Liberalisierung sowie deren Berücksichtigung im EnWG. Weiterhin befasst sich das Kapitel mit den Aspekten der Preisgünstigkeit, Effizienz und des Umweltschutzes, einschließlich der Verantwortung des Staates in diesen Bereichen, sowie der Anwendbarkeit des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).
Schlüsselwörter
Liberalisierung, Energiewirtschaftsrecht, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Stromversorgung, Monopol, Wettbewerb, Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, Effizienz, Umweltschutz, Staatliche Verantwortung, Regulierung, Deregulierung, Europäische Richtlinien, Sozialstaatsprinzip, Grundrechte, GWB.
FAQ: Seminararbeit zur Liberalisierung der deutschen Stromversorgung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Liberalisierung der deutschen Stromversorgung im Kontext des Energiewirtschaftsrechts. Sie analysiert die Entwicklung von der monopolistischen Organisation zur wettbewerbsorientierten Struktur und die bleibende Verantwortung des Staates für Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, Effizienz und Umweltschutz.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Stromversorgung in Deutschland von der Monopolstellung bis zur Liberalisierung, den Einfluss des europäischen Rechts, die Zielsetzungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), die Rolle des Staates in der Regulierung des liberalisierten Energiemarktes und das Spannungsfeld zwischen Liberalisierung und staatlicher Verantwortung im Bereich der Daseinsvorsorge.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und zum Überblick über die Liberalisierung, ein Kapitel zur bleibenden staatlichen Verantwortung im Hinblick auf die Zielsetzungen von § 1 I EnWG, ein Resümee und ein Literaturverzeichnis. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird unter „Liberalisierung“ im Kontext der Seminararbeit verstanden?
Die Arbeit definiert Liberalisierung im Kontext der wettbewerblichen Öffnung vormals monopolisierter Wirtschaftsbereiche und differenziert sie von Deregulierung. Sie beschreibt die Entwicklung der deutschen Energieversorgung von einer monopolistischen Struktur, wie sie bis 1998 durch das Energiewirtschaftsgesetz von 1935 geprägt war, hin zu einem wettbewerbsorientierten Markt.
Welche Rolle spielt der Staat nach der Liberalisierung der Stromversorgung?
Die Seminararbeit analysiert die fortbestehende Verantwortung des Staates, insbesondere im Hinblick auf die Zielsetzungen von § 1 I EnWG (Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, Effizienz und Umweltschutz). Sie untersucht, wie diese Ziele im liberalisierten Markt sichergestellt werden sollen und welche Regulierungsmechanismen der Staat einsetzt.
Welche Bedeutung hat das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)?
Das EnWG steht im Mittelpunkt der Analyse. Die Arbeit untersucht die Zielsetzungen des Gesetzes und analysiert, wie diese im Kontext der Liberalisierung umgesetzt und durch staatliche Regulierung abgesichert werden sollen.
Welchen Einfluss hat das europäische Recht auf die Liberalisierung?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss des europäischen Rechts auf die Liberalisierung des Energiemarktes, einschließlich der relevanten EU-Richtlinien und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Stromversorgung.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Seminararbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Liberalisierung, Energiewirtschaftsrecht, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Stromversorgung, Monopol, Wettbewerb, Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, Effizienz, Umweltschutz, Staatliche Verantwortung, Regulierung, Deregulierung, Europäische Richtlinien, Sozialstaatsprinzip, Grundrechte und GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen).
Wie wird die Versorgungssicherheit im Kontext der Liberalisierung betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Versorgungssicherheit als Ausprägung verschiedener Grundrechte und Ergebnis des Sozialstaatsprinzips. Sie diskutiert die Gefährdung der Versorgungssicherheit durch die Liberalisierung und deren Berücksichtigung im EnWG.
- Quote paper
- Daniel Andre Geiger (Author), 2006, Liberalisierung und bleibende Verantwortung des Staates am Beispiel des Energiewirtschaftsrechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54972