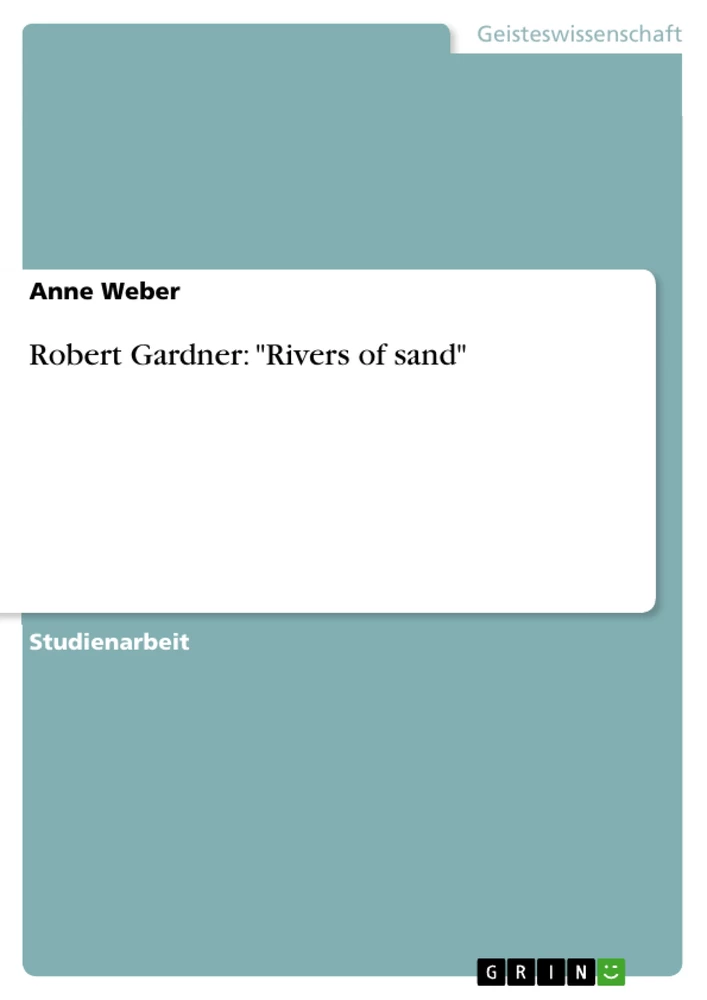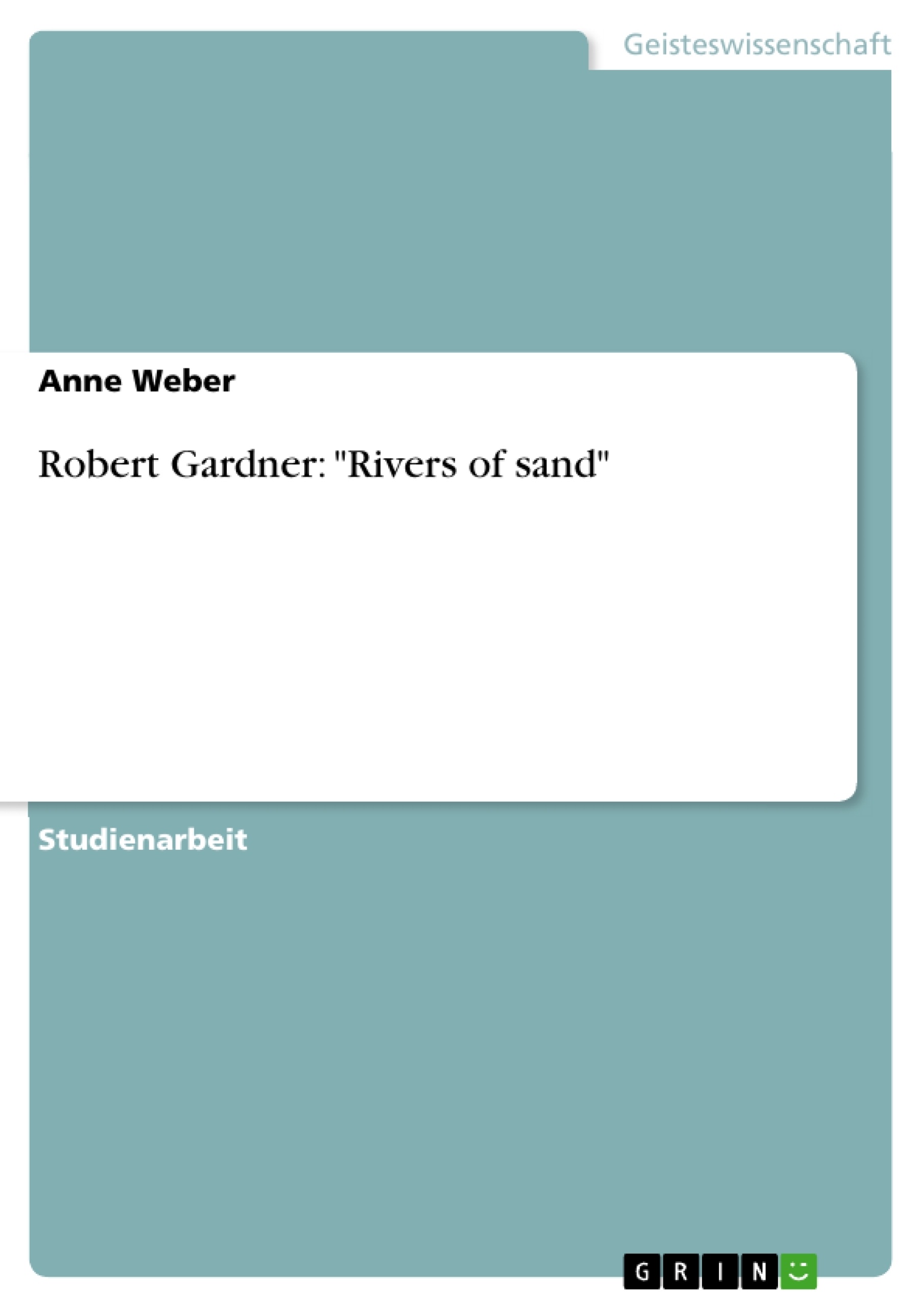Robert Gardner, der 1925 in Massachusetts geboren wurde, interessierte sich bereits in frühester Kindheit für damalige Filme, wie etwa die von Charlie Chaplin. Zunächst fasziniert von der 16mm-Kamera seines Vaters, bekam er irgendwann eine eigene Kamera, und es begann für ihn die Überlegung, was es denn mit dieser einzufangen galt. Da Gardner sich selbst ein Verständnis von Film und Filmemachen aneignen musste - es gab kaum derartige Ausbildungsmöglichkeiten - verschlang er zunächst die Filme, die in den damaligen Kinos gespielt wurden. Gardner sah das Filmemachen als eine Art Kunstform an und umso kunstvoller erschien es ihm, wenn es Filmemachern gelang, Emotionen und Stimmungen der realen Welt in Form eines Films zu konservieren. Diese reale Welt zu bewahren, liegt - so zitiert Gardner den englischen Dichter Philip Larkin - "aller Kunst zugrunde."
Es kristallisierte sich also schnell ein Interesse an nicht-fiktiven Filmen heraus. Gardner schreibt in dem Text "Der Impuls zu bewahren", dass er Filme, wie "The private life of a cat" - von Maya Derens - noch immer am meisten liebt, denn es gelang ihr in diesem Film, Aktualität statt Phantasie in den Vordergrund zu stellen, was Gardner nachhaltig beeindruckte. Er beschreibt Filme wie diesen als visuell eindrucksvoller und als sehr viel herzbewegender als fiktive und surrealistische Werke.
Mit Hilfe des Films bzw. der Kamera war es Gardner nun also möglich, seine eigenen Empfindungen, bezüglich eines Teils der äußeren realen Welt, wiederzugeben, wenn es auch ihm gelingen würde, sie mit der Kamera einzufangen.
Inhaltsverzeichnis
- Robert Gardner - Der Weg zum nicht-fiktiven Film
- Gardners Intention
- „Rivers of Sand“
- Das Leitmotiv des Films
- Die ersten Bilder
- Das Anfangbild wird relativiert
- Die Thematik des Schlagens
- Kritik an Gardners „Rivers of Sand“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Robert Gardners Film „Rivers of Sand“ und beleuchtet dessen filmische Gestaltung sowie die Intention des Filmemachers. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Hamar-Gesellschaft in Südwest-Äthiopien und der Frage, wie Gardner den Zuschauer zum Nachdenken über fremde Kulturen anregt. Die Arbeit untersucht zudem die ethischen und ästhetischen Aspekte von Gardners filmischem Ansatz.
- Darstellung der Hamar-Kultur
- Gardners filmische Methodik
- Das Leitmotiv des Films
- Die Rolle von Gewalt und Ritualen in der Hamar-Gesellschaft
- Die Bedeutung der moralischen Ebene im Film
Zusammenfassung der Kapitel
Robert Gardner - Der Weg zum nicht-fiktiven Film
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit Robert Gardners Biografie und seiner Entwicklung zum Filmemacher. Er beschreibt Gardners frühes Interesse an Film und seine Faszination für die nicht-fiktive Darstellung der realen Welt. Dabei wird Gardners Verständnis von Film als einer Kunstform hervorgehoben, die Emotionen und Stimmungen festhalten kann.
Gardners Intention
Dieser Abschnitt beleuchtet Gardners Intention bei der Gestaltung seiner Filme. Es wird deutlich, dass Gardner seine Filme bewusst so konzipiert, dass sie den Zuschauer zum Nachdenken anregen. Er möchte die menschliche Realität in all ihren Facetten zeigen und dabei eher Fragen aufwerfen als belehrend zu wirken.
„Rivers of Sand“
Die Kapitel über „Rivers of Sand“ untersuchen das Leitmotiv des Films, die ersten Bilder und das Anfangbild, das relativ gesetzt wird. Es wird die Thematik des Schlagens in der Hamar-Gesellschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen: Ethnografischer Film, Robert Gardner, „Rivers of Sand“, Hamar-Gesellschaft, visuelle Anthropologie, Ethik im Film, Kulturvergleich, Genderrollen, moralische Ebene, Filmsprache.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Robert Gardner?
Ein einflussreicher Filmemacher (1925–2014), der sich auf nicht-fiktive, ethnografische Filme spezialisierte und das Filmemachen als Kunstform betrachtete.
Worum geht es in dem Film „Rivers of Sand“?
Der Film porträtiert die Hamar-Gesellschaft in Äthiopien und thematisiert deren Rituale, Geschlechterrollen und den Umgang mit Gewalt.
Was war Gardners Intention beim Filmemachen?
Er wollte die reale Welt bewahren und Emotionen einfangen, um den Zuschauer eher zum Nachdenken anzuregen als ihn belehrend zu informieren.
Warum wird Gardner oft kritisiert?
Die Arbeit beleuchtet Kritik an seinem ästhetisierenden Ansatz, der manchmal die objektive ethnografische Dokumentation zugunsten einer künstlerischen Vision in den Hintergrund rückt.
Was ist das Leitmotiv von „Rivers of Sand“?
Das Leitmotiv ist die Darstellung der Hamar-Kultur, insbesondere die rituellen Aspekte und die harten sozialen Strukturen innerhalb der Gemeinschaft.
- Citation du texte
- Anne Weber (Auteur), 2006, Robert Gardner: "Rivers of sand", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54992