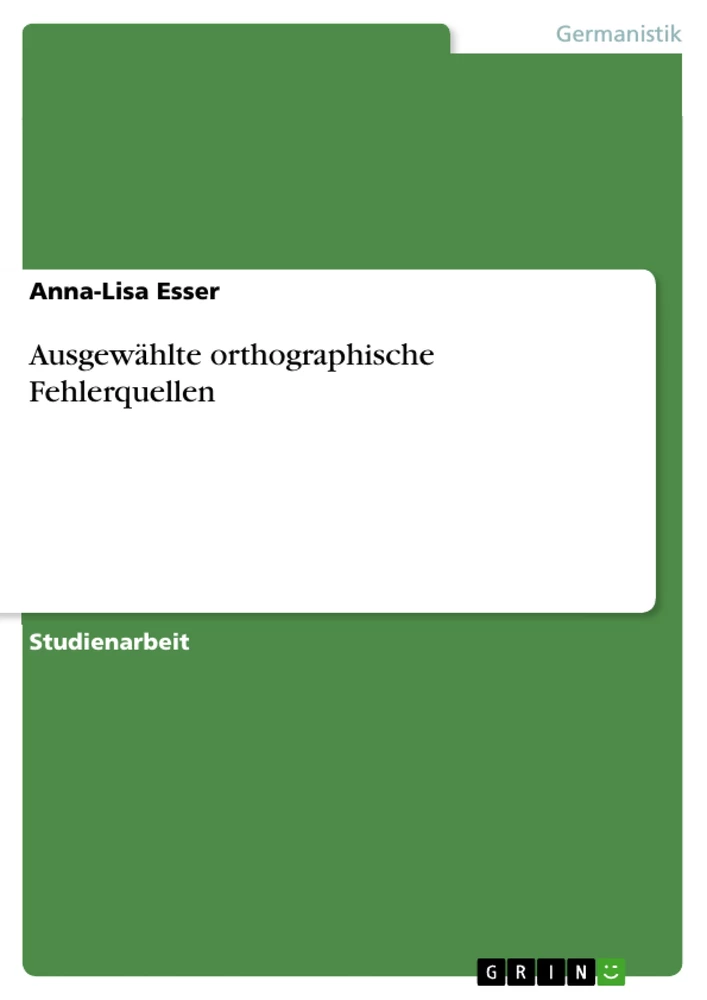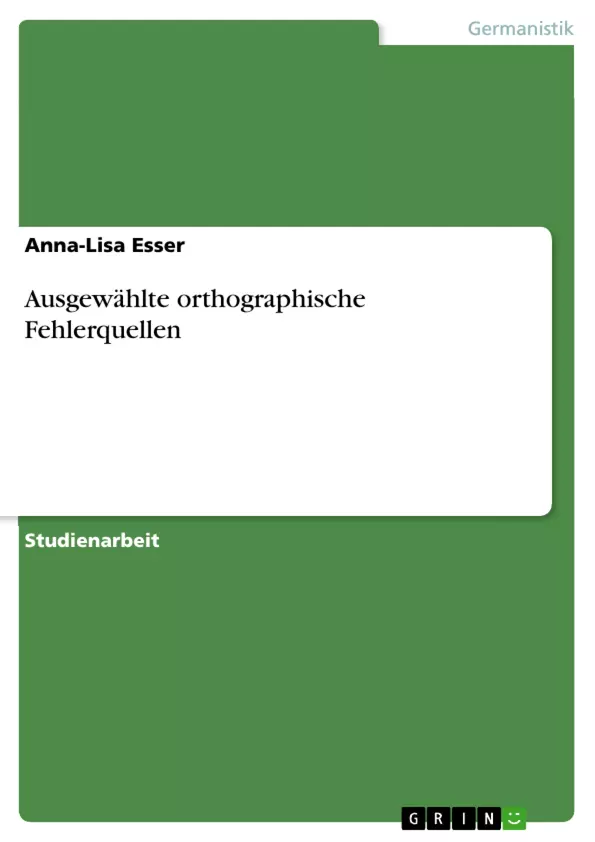Möchte man eine fremde Sprache lernen, so muss man sich nicht nur mit
Grammatik, deren Anwendung und der mündlichen Sprachproduktion
auseinandersetzen, auch und besonders das Zusammenspiel von Lauten und deren
Umsetzung in schriftliche Zeichen sind wesentliche Bestandteile des
Fremdsprachenlernens, da die Lautwahrnehmung das Schreiben beeinflusst und
diese wiederum das Sprechen durchdringt.
Leider kann der Satz „Sprich, wie du schreibst“ im Deutschen nicht ohne
Einschränkung angewendet werden, Laute und Buchstaben sind nicht zwangsläufig
identisch. Wie soll ein Deutschlerner am Anfang seines Lernprozesses
beispielsweise verstehen, dass „ich“ und „ach“ nicht beide gleich, das „ch“ nicht
immer wie [ç] ausgesprochen wird, wenn er sich nicht mit der Laut-Buchstaben-
Beziehung auseinandersetzt?
Wie soll ein Spanier verstehen, dass er das (erste) „e“ in dem Wort „beten“ länger
auszusprechen hat, jedoch so geschrieben wird, wie er es aussprechen würde, weil
es im Spanischen keinerlei Unterscheidung für die Länge der Vokale gibt, die Vokale
also immer gleich kurz ausgesprochen werden?
Diese Schwierigkeiten spanischsprachiger Lerner beim Erwerb der deutschen
Sprache sollen in der vorliegenden Seminararbeit untersucht werden. Anhand
ausgewählter Beispiele soll die Problematik der unterschiedlichen Verschriftlichung der
Laute veranschaulicht werden.
Zunächst soll ein Überblick über die verwendeten Begriffe „Phonetik“, „Phonologie“ und
„Orthographie“ gegeben werden. Anschließend werden die generellen Unterschiede des
deutschen und spanischen Phoneminventars kurz vorgestellt und die daraus
resultierenden möglichen Fehlerquellen in der Aussprache und der Schreibung
veranschaulicht werden.
Daran anknüpfend sollen anhand vier ausgewählter Beispiele die Komplexität und die
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Lauten in Buchstaben (und umgekehrt) bei der
Erlernung des Deutschen für spanischsprachige Lerner heraus gearbeitet werden. Schließlich soll in diesem Zusammenhang auch auf diese Problematik als Ergebnis
mangelnder Wertschätzung einer fundierten Ausspracheschulung im DaF-Unterricht
eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1. Phonetik
- 2.2. Phonologie
- 2.3. Orthographie
- 3. Unterschiede des Phoneminventars Deutsch-Spanisch
- 3.1. Vokale
- 3.2. Konsonanten
- 4. Einige besondere Schwierigkeiten von spanischsprachigen Deutschlernern
- 4.1. Die s-Schreibung
- 4.2. Die Vokale
- 4.3. Problematik der Phoneme /b/ und /v/
- 4.4. Die Auslautverhärtung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Schwierigkeiten spanischsprachiger Lerner beim Erwerb der deutschen Sprache, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedliche Verschriftlichung von Lauten. Die Arbeit beleuchtet die Problematik der Laut-Buchstaben-Beziehung im Deutschen im Vergleich zum Spanischen und veranschaulicht dies anhand ausgewählter Beispiele.
- Unterschiede im Phoneminventar von Deutsch und Spanisch
- Die Problematik der s-Schreibung im Deutschen für spanische Muttersprachler
- Schwierigkeiten bei der Unterscheidung und Umsetzung der Vokale
- Herausforderungen bei der Unterscheidung der Phoneme /b/ und /v/
- Die Auslautverhärtung als orthographische Herausforderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Schwierigkeiten beim Erlernen der deutschen Orthographie für spanischsprachige Lerner ein. Sie betont die Wichtigkeit des Zusammenspiels von Lauten und ihrer schriftlichen Umsetzung im Fremdsprachenlernen und hebt die Diskrepanz zwischen Aussprache und Schrift im Deutschen hervor. Die Arbeit kündigt die Untersuchung ausgewählter Beispiele an, um die Problematik der unterschiedlichen Verschriftlichung von Lauten zu veranschaulichen und fokussiert auf die Unterschiede im Phoneminventar und daraus resultierende Fehlerquellen.
2. Begriffserklärungen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe Phonetik, Phonologie und Orthographie. Es definiert die Phonetik als die Untersuchung der physikalischen und physiologischen Eigenschaften von Sprachlauten, unterteilt in artikulatorische, akustische und auditive Phonetik. Die Phonologie wird als der Bereich definiert, der sich mit der Funktion von Sprachlauten und ihrer bedeutungsunterscheidenden Funktion befasst. Schließlich wird die Orthographie als die Wiedergabe von Phonemen durch Buchstaben erklärt, wobei der phonologische Grundsatz und die historische Entwicklung der deutschen Rechtschreibung hervorgehoben werden.
3. Unterschiede des Phoneminventars Deutsch-Spanisch: Dieser Abschnitt beleuchtet die Unterschiede im Vokal- und Konsonanteninventar des Deutschen und des Spanischen. Es wird der unterschiedliche Vokalreichtum beider Sprachen herausgestellt, wobei das Spanische ein größeres Vokalaufkommen, das Deutsche einen größeren qualitativen Vokalreichtum aufweist. Der Abschnitt legt den Grundstein für das Verständnis der Schwierigkeiten, die spanischsprachige Lerner im weiteren Verlauf der Arbeit bei der Umsetzung der Laute in die deutsche Schrift begegnen.
Schlüsselwörter
Phonetik, Phonologie, Orthographie, Deutsch als Fremdsprache (DaF), spanischsprachige Deutschlerner, Phoneminventar, Laut-Buchstaben-Beziehung, Aussprache, Schreibung, Fehlerquellen, Vokale, Konsonanten, s-Schreibung, Auslautverhärtung, Interferenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Schwierigkeiten spanischsprachiger Lerner beim Erwerb der deutschen Orthographie
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Schwierigkeiten, denen spanischsprachige Lerner beim Erlernen der deutschen Orthographie begegnen. Sie konzentriert sich insbesondere auf die Unterschiede in der Laut-Buchstaben-Beziehung zwischen Deutsch und Spanisch und analysiert daraus resultierende Fehlerquellen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Unterschiede im Phoneminventar von Deutsch und Spanisch (Vokale und Konsonanten), die Problematik der s-Schreibung, Schwierigkeiten bei der Unterscheidung und Umsetzung der Vokale, Herausforderungen bei der Unterscheidung der Phoneme /b/ und /v/, und die Auslautverhärtung als orthographische Herausforderung. Zusätzlich werden die grundlegenden Begriffe Phonetik, Phonologie und Orthographie erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffserklärungen (Phonetik, Phonologie, Orthographie), Unterschiede des Phoneminventars Deutsch-Spanisch, Einige besondere Schwierigkeiten von spanischsprachigen Deutschlernern (s-Schreibung, Vokale, /b/ und /v/, Auslautverhärtung) und Fazit.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, betont die Wichtigkeit des Zusammenspiels von Lauten und ihrer schriftlichen Umsetzung und hebt die Diskrepanz zwischen Aussprache und Schrift im Deutschen hervor. Sie kündigt die Untersuchung ausgewählter Beispiele an, um die Problematik der unterschiedlichen Verschriftlichung von Lauten zu veranschaulichen.
Wie werden Phonetik, Phonologie und Orthographie definiert?
Phonetik wird als die Untersuchung der physikalischen und physiologischen Eigenschaften von Sprachlauten definiert. Phonologie befasst sich mit der Funktion von Sprachlauten und ihrer bedeutungsunterscheidenden Funktion. Orthographie beschreibt die Wiedergabe von Phonemen durch Buchstaben, wobei der phonologische Grundsatz und die historische Entwicklung der deutschen Rechtschreibung hervorgehoben werden.
Welche Unterschiede im Phoneminventar werden behandelt?
Der Abschnitt zu den Unterschieden im Phoneminventar beleuchtet den unterschiedlichen Vokal- und Konsonantenreichtum von Deutsch und Spanisch. Es wird herausgestellt, dass Spanisch zwar mehr Vokale hat, Deutsch aber einen größeren qualitativen Vokalreichtum aufweist. Diese Unterschiede bilden die Grundlage für das Verständnis der Schwierigkeiten spanischsprachiger Lerner.
Welche spezifischen Schwierigkeiten spanischsprachiger Lerner werden detailliert beschrieben?
Die Arbeit behandelt detailliert die Schwierigkeiten mit der s-Schreibung, der Unterscheidung und Umsetzung der Vokale, der Unterscheidung der Phoneme /b/ und /v/ und der Auslautverhärtung. Diese Punkte werden anhand von Beispielen veranschaulicht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen Phonetik, Phonologie, Orthographie, Deutsch als Fremdsprache (DaF), spanischsprachige Deutschlerner, Phoneminventar, Laut-Buchstaben-Beziehung, Aussprache, Schreibung, Fehlerquellen, Vokale, Konsonanten, s-Schreibung, Auslautverhärtung und Interferenz.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende und Lernende von Deutsch als Fremdsprache, insbesondere für diejenigen, die sich mit den Schwierigkeiten spanischsprachiger Lerner auseinandersetzen. Sie bietet Einblicke in die phonetischen und orthographischen Herausforderungen und kann zur Entwicklung von effektiveren Lehrmaterialien beitragen.
- Citation du texte
- Anna-Lisa Esser (Auteur), 2005, Ausgewählte orthographische Fehlerquellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55023