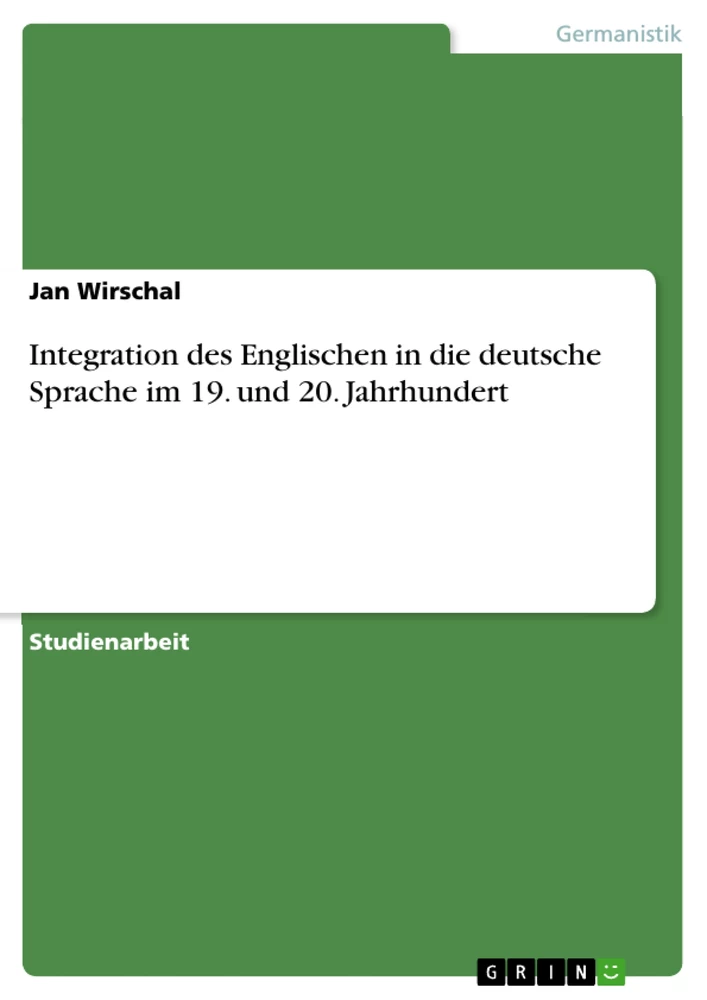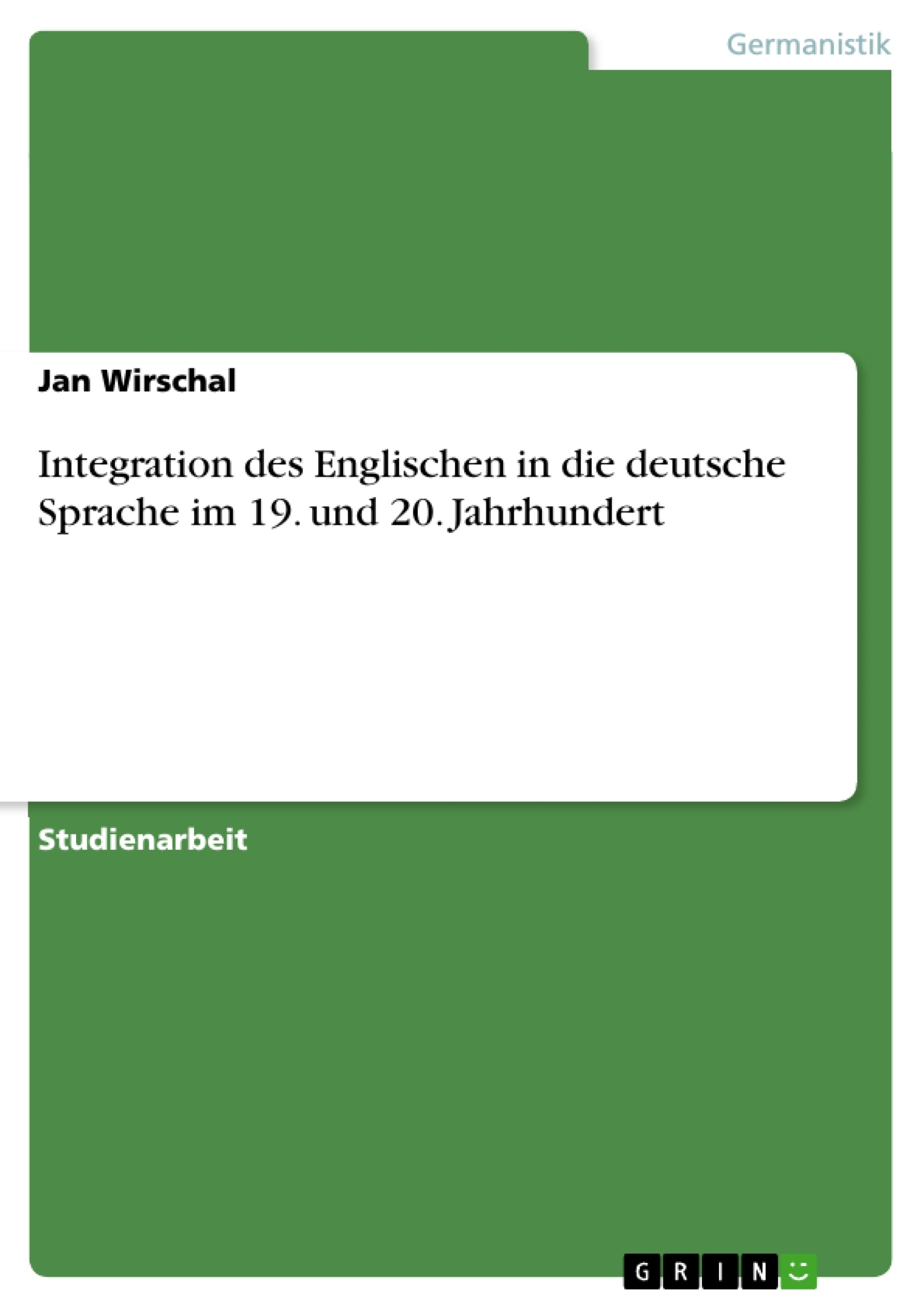1909 wetterte der Schulmeister und Sprachpurist Hermann Dunger gegen den wachsenden
englischen Einfluss: „Englisch ist jetzt fein, Englisch ist Trumpf! Für manchen jungen
Deutschen ist es das höchste Ziel seines Ehrgeizes, für einen Engländer gehalten zu werden.
Wie der Deutsche früher der Affe des Franzosen war, so äfft er jetzt den Engländer nach.“
Es wurde schon früh Kritik laut am fremdsprachlichen Einfluss. Eine wahre Entlehnungsflut
aber setzte erst in der Zeit nach 1945 ein, wobei der Deutsche jetzt zum „Affen des
Amerikaners“ wurde, wie Dunger es vielleicht ausgedrückt hätte.
Die englische Sprache ist heutzutage im Deutschen allgegenwärtig. Ein kurzer Blick in die
Zeitung genügt, um dieses Phänomen zu erkennen. Anglizismen, bzw. Amerikanismen, finden
sich in der Werbung, der Pressesprache, den Medien allgemein in großer Anzahl. Doch wie
viele Anglizismen tatsächlich in die Alltagssprache übergehen, ist schwer zu belegen. Fest steht,
dass seit dem 19. Jahrhundert der Einfluss des Englischen auf das Deutsche stetig zugenommen
hat.
Die Arbeit beschäftigt sich entsprechend des Seminarthemas mit der Integration des Englischen
in das Deutsche in den Bereichen Sprache, Kommunikation und Medien. Eine klare Einteilung
in diese Kategorien ist nicht immer möglich gewesen, da sie sich gegenseitig beeinflussen und
auch teilweise überlappen, daher ist die von mir gemachte Unterteilung nicht als strikte
Abgrenzung, sondern eher als Orientierung an diesen übergeordneten Themenschwerpunkten zu
betrachten. Da es sich um eine sprachliche Beeinflussung handelt, nimmt der Bereich Sprache
naturgemäß einen größeren Raum ein.
Beginnend mit den Gründen für die wachsende Bedeutung des Englischen im 19. und 20.
Jahrhundert und einer kurzen Beschreibung des Widerstands der Sprachpuristen, soll die Arbeit
einen Überblick über die beeinflussten Bereiche geben, die Art der Beeinflussung und
gegebenenfalls mögliche Motive für die Verwendung von Anglizismen aufzeigen. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der Zeit nach 1945 in Westdeutschland. Auf die Pressesprache habe
ich besonders Bezug genommen, da sie ein häufig verwendeter Forschungsgegenstand und am
ehesten objektiv zu erfassen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Einfluss des Englischen im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
- Sprachkritik im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
- Der Einfluss des Englischen nach 1945 (auf Westdeutschland)
- Anglizismen im Bereich Sprache
- Anglizismen in Fachsprachen
- Wissenschaft/ Forschung
- Sport
- Tourismus/ Flugverkehr
- Anglizismen in Fachsprachen
- Anglizismen in den Medien
- Werbung
- Pressesprache
- Anglizismen im Bereich Kommunikation
- Jugendsprache
- Fazit: Reden wir jetzt „Denglisch“?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration des Englischen in die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf die Zeit nach 1945 in Westdeutschland. Ziel ist es, einen Überblick über die Bereiche zu geben, die vom englischen Einfluss betroffen sind, die Art der Beeinflussung zu beschreiben und mögliche Motive für die Verwendung von Anglizismen aufzuzeigen.
- Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert.
- Die Reaktion von Sprachpuristen auf den wachsenden Einfluss des Englischen.
- Die Verbreitung von Anglizismen in verschiedenen Bereichen wie Sprache, Medien und Kommunikation.
- Der Unterschiedliche Einfluss von Britischem und Amerikanischem Englisch.
- Die Rolle der Medien (insbesondere die Presse) bei der Verbreitung von Anglizismen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der zunehmenden Integration des Englischen in die deutsche Sprache ein. Sie veranschaulicht die früh einsetzende Kritik von Sprachpuristen an diesem Einfluss, beginnend bereits im frühen 20. Jahrhundert mit Persönlichkeiten wie Hermann Dunger. Die Einleitung betont die Allgegenwärtigkeit des Englischen in der heutigen deutschen Sprache und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Bereiche Sprache, Kommunikation und Medien konzentriert. Die gegenseitige Beeinflussung dieser Bereiche wird hervorgehoben, und der Schwerpunkt der Arbeit auf die Zeit nach 1945 in Westdeutschland wird festgelegt. Die Auswahl der Pressesprache als Forschungsgegenstand aufgrund ihrer relativen Objektivität wird begründet.
Der Einfluss des Englischen im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel behandelt die Anfänge des verstärkten englischen Einflusses auf die deutsche Sprache, beginnend mit der industriellen Revolution. Es werden Beispiele für Anglizismen aus verschiedenen Bereichen wie Industrie, Handel, Verkehr und Politik genannt und die zunehmende Bedeutung des Englischen, insbesondere um 1900 in Berlin, erläutert. Die enge Verwandtschaft beider Sprachen wird als Schlüsselfaktor für die leichte Integration englischer Ausdrücke und Wörter hervorgehoben.
Sprachkritik im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Kritik von Sprachpuristen an dem zunehmenden Einfluss von Fremdwörtern, insbesondere des Englischen. Es werden Beispiele für den Widerstand gegen Anglizismen genannt, wie die Verordnungen von Generalpostmeister von Stephan und die Gründung des „Allgemeinen Deutschen Sprachvereins“ durch Hermann Riegel. Das Kapitel verdeutlicht, dass der Widerstand zunächst stärker auf Latinismen und Gallizismen gerichtet war, da die Anzahl der Anglizismen zu dieser Zeit noch vergleichsweise gering war. Es wird jedoch auch die vollständige Assimilation einiger englischer Wörter in die deutsche Sprache betont.
Der Einfluss des Englischen nach 1945 (auf Westdeutschland): Dieses Kapitel untersucht den starken Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland. Es beschreibt die „aktiv aufnehmende Sprachhaltung“ der Nachkriegsgeneration und die Verschiebung des Einflusses vom Britischen zum Amerikanischen Englisch. Die vielfältigen Gründe für diesen massiven Einfluss werden angesprochen.
Schlüsselwörter
Anglizismen, Amerikanismen, Sprachwandel, Sprachkritik, Sprachpurismus, Mediensprache, Pressesprache, Kommunikation, Jugendsprache, Industrielle Revolution, Westdeutschland, Britisches Englisch, Amerikanisches Englisch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Integration des Englischen in die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf die Zeit nach 1945 in Westdeutschland. Sie analysiert die Bereiche, die vom englischen Einfluss betroffen sind, beschreibt die Art der Beeinflussung und untersucht mögliche Motive für die Verwendung von Anglizismen.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache vom 19. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit (nach 1945), wobei der Schwerpunkt auf Westdeutschland liegt. Die Anfänge des verstärkten Einflusses im Kontext der industriellen Revolution werden ebenso beleuchtet wie die starke Zunahme nach dem Zweiten Weltkrieg.
Welche Bereiche werden untersucht?
Die Untersuchung umfasst den Einfluss des Englischen auf verschiedene Bereiche der deutschen Sprache und Kommunikation: Sprache im Allgemeinen (inklusive Fachsprachen wie Wissenschaft, Sport und Tourismus), Medien (Werbung und Pressesprache) und Jugendsprache. Die gegenseitige Beeinflussung dieser Bereiche wird hervorgehoben.
Welche Aspekte der Sprachkritik werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Reaktion von Sprachpuristen auf den wachsenden Einfluss des Englischen, beginnend bereits im frühen 20. Jahrhundert. Sie beschreibt den Widerstand gegen Anglizismen, beispielsweise durch Verordnungen und die Gründung von Sprachvereinen, und zeigt, dass dieser Widerstand zunächst stärker auf Latinismen und Gallizismen gerichtet war.
Wie wird der Einfluss des Britischen und Amerikanischen Englisch unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet den Einfluss des Britischen und Amerikanischen Englisch, insbesondere im Hinblick auf die Verschiebung des Einflusses nach 1945 zugunsten des Amerikanischen Englisch in Westdeutschland. Die Gründe für diese Verschiebung werden diskutiert.
Welche Rolle spielen die Medien?
Die Rolle der Medien, insbesondere der Presse, bei der Verbreitung von Anglizismen wird betont. Die Pressesprache wird als Forschungsgegenstand aufgrund ihrer relativen Objektivität ausgewählt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anglizismen, Amerikanismen, Sprachwandel, Sprachkritik, Sprachpurismus, Mediensprache, Pressesprache, Kommunikation, Jugendsprache, Industrielle Revolution, Westdeutschland, Britisches Englisch, Amerikanisches Englisch.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, dem Einfluss des Englischen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, der Sprachkritik dieser Zeit, dem Einfluss nach 1945 in Westdeutschland, Anglizismen in verschiedenen Bereichen (Sprache, Medien, Kommunikation) und einem Fazit.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit untersucht die Frage, ob die deutsche Sprache mittlerweile als "Denglisch" bezeichnet werden kann. Es fasst die Ergebnisse der Analyse des englischen Einflusses auf die deutsche Sprache zusammen und beantwortet die Forschungsfrage nach Umfang und Art der Beeinflussung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bieten eine Zusammenfassung der Arbeit. Für detaillierte Informationen wird auf den vollständigen Text verwiesen.
- Quote paper
- Jan Wirschal (Author), 2003, Integration des Englischen in die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55047