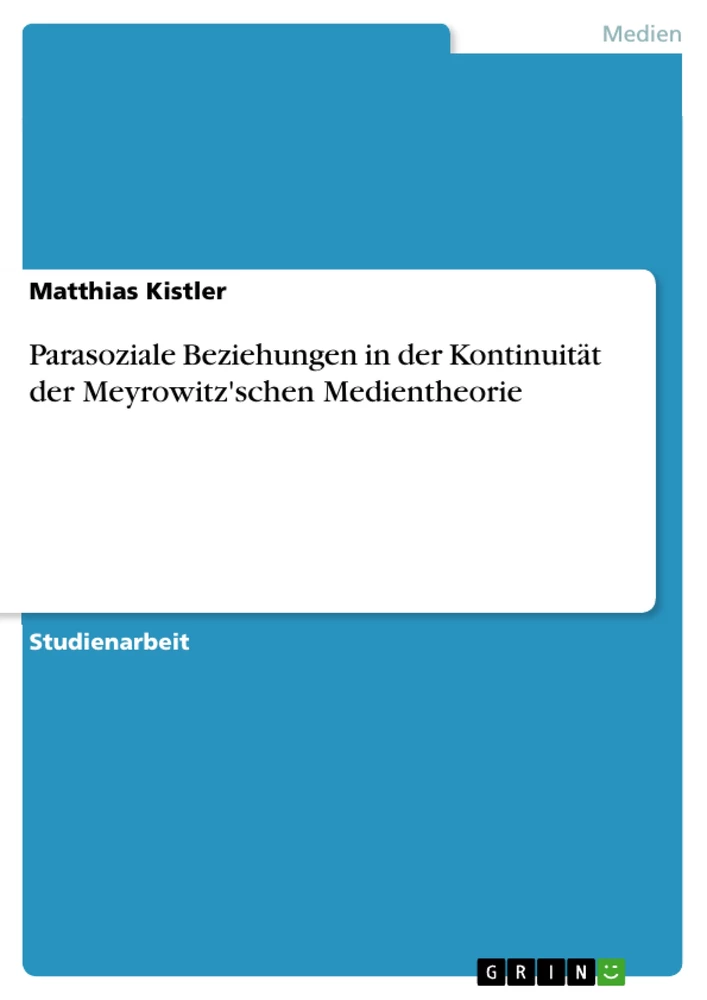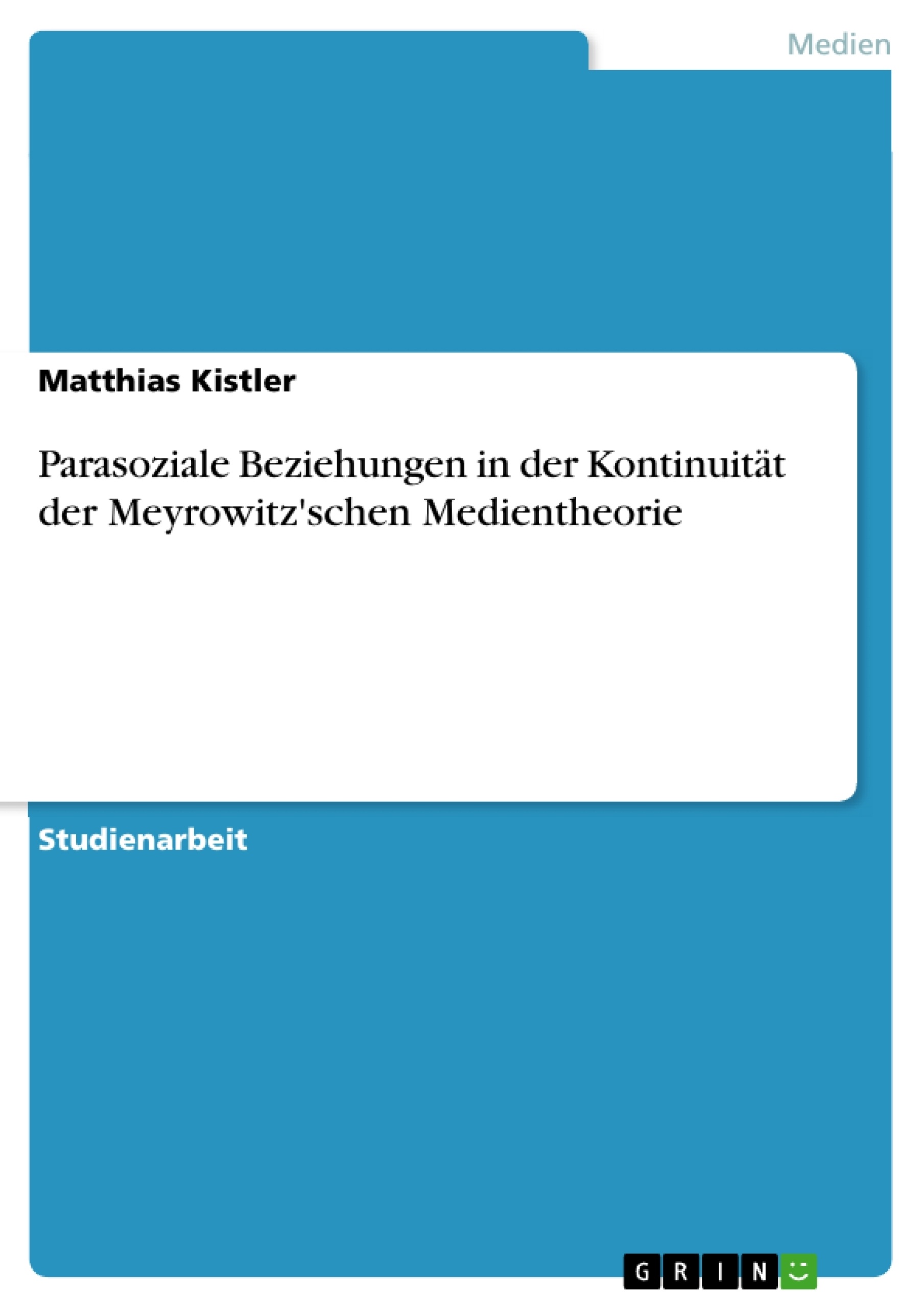Tom Cruise in Steven Spielbergs „Krieg der Welten“ , Tony Leung Chiu Wai in Wong Kar
Wais „2046“ oder doch lieber Christian Bale in Christopher Nolans „Batman Begins“? Auf
Grund der thematischen Unterschiede der Filme eine eher undenkbare Alternativenaufzählung
würde man denken. Doch ist es wirklich nur das Genre oder eine eventuelle Werbekampagne,
welche die Entscheidung maßgeblich beeinflusst oder steckt mehr dahinter? Individuelle
Gratifikationen etwa oder Sympathien den Schauspielern gegenüber?
Parasoziale Beziehungen liefern hier die Antwort. Wie können solche antiorthosoziale,
quasisozialen Beziehungen entstehen? Und welche Auswirkungen haben sie auf unsere
orthosozialen Beziehungen? Sind sie psychologische Extremfälle oder postmoderner
Bestandteil unseres Daseins? Auf diese und weitere Fragen wird im Nachfolgenden
eingegangen.
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der grundlegenden Wesensbestimmung
parasozialer Interaktion in Abgrenzung zu Interaktionen orthosozialen Charakters und die
daraus resultierende Entstehung parasozialer Beziehungen. Darüber hinaus wird im Hauptteil
der Arbeit die meyrowitz’sche Medientheorie wichtige Erkenntnisse zur Erklärung der
Entstehung parasozialer Beziehungen liefern, weshalb zuerst auf die Medientheorien
Meyrowitz’ und anschließend auf die jeweilige Bedeutung für die Entstehung parasozialer
Beziehungen eingegangen wird. Zur Verdeutlichung der auf parasoziale Interaktion
ausgerichteten Moderationsweise und Darstellung von Menschen im Fernsehen wird vor dem
am Schluss stehenden Fazit mit Beispielen aus dem Fernsehalltag eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Parasoziale Beziehungen
- 2.1. Parasoziale Interaktion
- 2.2. Unterschiede und Gemeinsamkeiten orthosozialer und parasozialer Interaktion
- 2.3. Rezipientengratifikationen durch parasoziale Beziehungen
- 2.4. Entstehung parasozialer Beziehungen
- 2.5. Extreme parasoziale Beziehungen – ein pathologisches Phänomen
- 3. Die meyrowitz'sche Medientheorie
- 3.1. Basisannahmen/Rahmenbedingungen
- 3.2. Öffentliche Bereiche vermischen sich
- 3.3. Öffentliches und privates Verhalten vermischen sich
- 3.4. Sozialer und physischer Ort werden getrennt
- 4. Parasoziale Beziehungen in der meyrowitz'schen Medientheorie
- 5. Beispiele prominenter parasozialer Interaktion
- 6. Fazit
- 7. Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht parasoziale Beziehungen im Kontext der Meyrowitz'schen Medientheorie. Ziel ist es, die Entstehung und die Charakteristika parasozialer Interaktionen zu beleuchten und deren Bedeutung im Medienkonsum zu erörtern. Die Arbeit analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu orthosozialen Beziehungen und untersucht, inwiefern die Meyrowitz'sche Theorie zur Erklärung der Entstehung parasozialer Beziehungen beitragen kann.
- Definition und Charakteristika parasozialer Interaktion
- Vergleich parasozialer und orthosozialer Interaktion
- Rezipientengratifikationen durch parasoziale Beziehungen
- Entstehung und Entwicklung parasozialer Beziehungen
- Anwendung der Meyrowitz'schen Medientheorie auf parasoziale Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der parasozialen Beziehungen ein und stellt die Forschungsfrage nach der Entstehung und den Auswirkungen dieser Beziehungen auf den Zuschauer. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit der Definition parasozialer Interaktion, dem Vergleich zu orthosozialen Beziehungen und der Anwendung der Meyrowitz'schen Medientheorie befasst. Die Einleitung erwähnt die Relevanz von individuellen Gratifikationen und Sympathien gegenüber Schauspielern als Einflussfaktoren auf die Medienwahl.
2. Parasoziale Beziehungen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Definition und Erläuterung von parasozialen Beziehungen. Es analysiert parasoziale Interaktion als eine Sonderform der Kommunikation, die sich durch den scheinbaren Face-to-Face-Kontakt mit Fernsehakteuren auszeichnet. Der Vergleich mit orthosozialer Interaktion unterstreicht die Unterschiede in Reziprozität und dem Aufwand für den Rezipienten. Der Abschnitt zu Rezipientengratifikationen beleuchtet den Nutzen, den Zuschauer aus parasozialen Beziehungen ziehen, wie etwa die Möglichkeit, neue Rollen auszuprobieren. Abschließend wird ein Modell zur Entstehung parasozialer Beziehungen vorgestellt, das die Entwicklung von der initialen Interaktion zur etablierten Beziehung beschreibt.
Schlüsselwörter
Parasoziale Beziehungen, orthosoziale Interaktion, Medientheorie Meyrowitz, Rezipientengratifikation, Medienkonsum, Fernsehrezeption, Kommunikation, Interaktion, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Parasoziale Beziehungen im Kontext der Meyrowitz'schen Medientheorie"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht parasoziale Beziehungen, insbesondere im Kontext der Meyrowitz'schen Medientheorie. Sie analysiert die Entstehung und Charakteristika parasozialer Interaktionen und deren Bedeutung im Medienkonsum.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Charakteristika parasozialer Interaktionen und erörtert deren Bedeutung im Medienkonsum. Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu orthosozialen Beziehungen und untersucht, inwiefern die Meyrowitz'sche Theorie zur Erklärung der Entstehung parasozialer Beziehungen beitragen kann.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Charakteristika parasozialer Interaktion, Vergleich parasozialer und orthosozialer Interaktion, Rezipientengratifikationen durch parasoziale Beziehungen, Entstehung und Entwicklung parasozialer Beziehungen und die Anwendung der Meyrowitz'schen Medientheorie auf parasoziale Beziehungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Parasoziale Beziehungen (mit Unterkapiteln zu Interaktion, Unterschieden zu orthosozialen Beziehungen, Rezipientengratifikationen und Entstehung), Die Meyrowitz'sche Medientheorie (mit Unterkapiteln zu Basisannahmen, Vermischung öffentlicher Bereiche, Vermischung von öffentlichem und privatem Verhalten und Trennung von sozialem und physischem Ort), Parasoziale Beziehungen in der Meyrowitz'schen Medientheorie, Beispiele prominenter parasozialer Interaktion, Fazit und Quellenangabe.
Was sind parasoziale Beziehungen?
Die Arbeit definiert parasoziale Beziehungen als eine Sonderform der Kommunikation, die sich durch einen scheinbaren Face-to-Face-Kontakt mit Medienakteuren auszeichnet, ähnlich einer Freundschaft, aber ohne reale Reziprozität.
Wie unterscheiden sich parasoziale und orthosoziale Beziehungen?
Die Arbeit vergleicht parasoziale und orthosoziale Beziehungen und hebt Unterschiede in der Reziprozität und dem Aufwand für den Rezipienten hervor. Orthosoziale Beziehungen sind reale, wechselseitige Beziehungen, während parasoziale Beziehungen einseitig sind und weniger Aufwand für den Rezipienten erfordern.
Welche Rolle spielen Rezipientengratifikationen?
Die Arbeit untersucht, welchen Nutzen Zuschauer aus parasozialen Beziehungen ziehen (Rezipientengratifikationen), z.B. die Möglichkeit, neue Rollen auszuprobieren oder emotionale Bedürfnisse zu befriedigen.
Wie entstehen parasoziale Beziehungen?
Die Arbeit präsentiert ein Modell zur Entstehung parasozialer Beziehungen, welches die Entwicklung von der initialen Interaktion bis zur etablierten Beziehung beschreibt. Einflussfaktoren wie Sympathien und individuelle Gratifikationen werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Rolle spielt die Meyrowitz'sche Medientheorie?
Die Arbeit analysiert, inwiefern die Meyrowitz'sche Medientheorie zur Erklärung der Entstehung und Charakteristika parasozialer Beziehungen beitragen kann. Sie konzentriert sich auf die von Meyrowitz beschriebenen Veränderungen der Öffentlichkeit und Privatheit durch Medien.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Parasoziale Beziehungen, orthosoziale Interaktion, Medientheorie Meyrowitz, Rezipientengratifikation, Medienkonsum, Fernsehrezeption, Kommunikation, Interaktion, Identität.
- Citar trabajo
- Matthias Kistler (Autor), 2005, Parasoziale Beziehungen in der Kontinuität der Meyrowitz'schen Medientheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55093