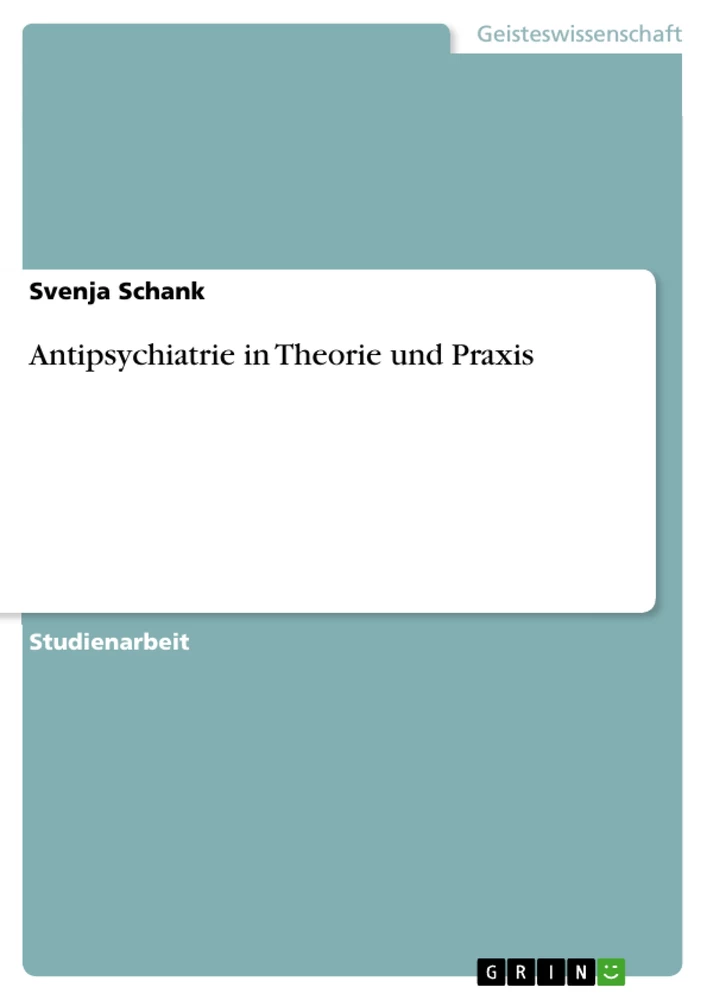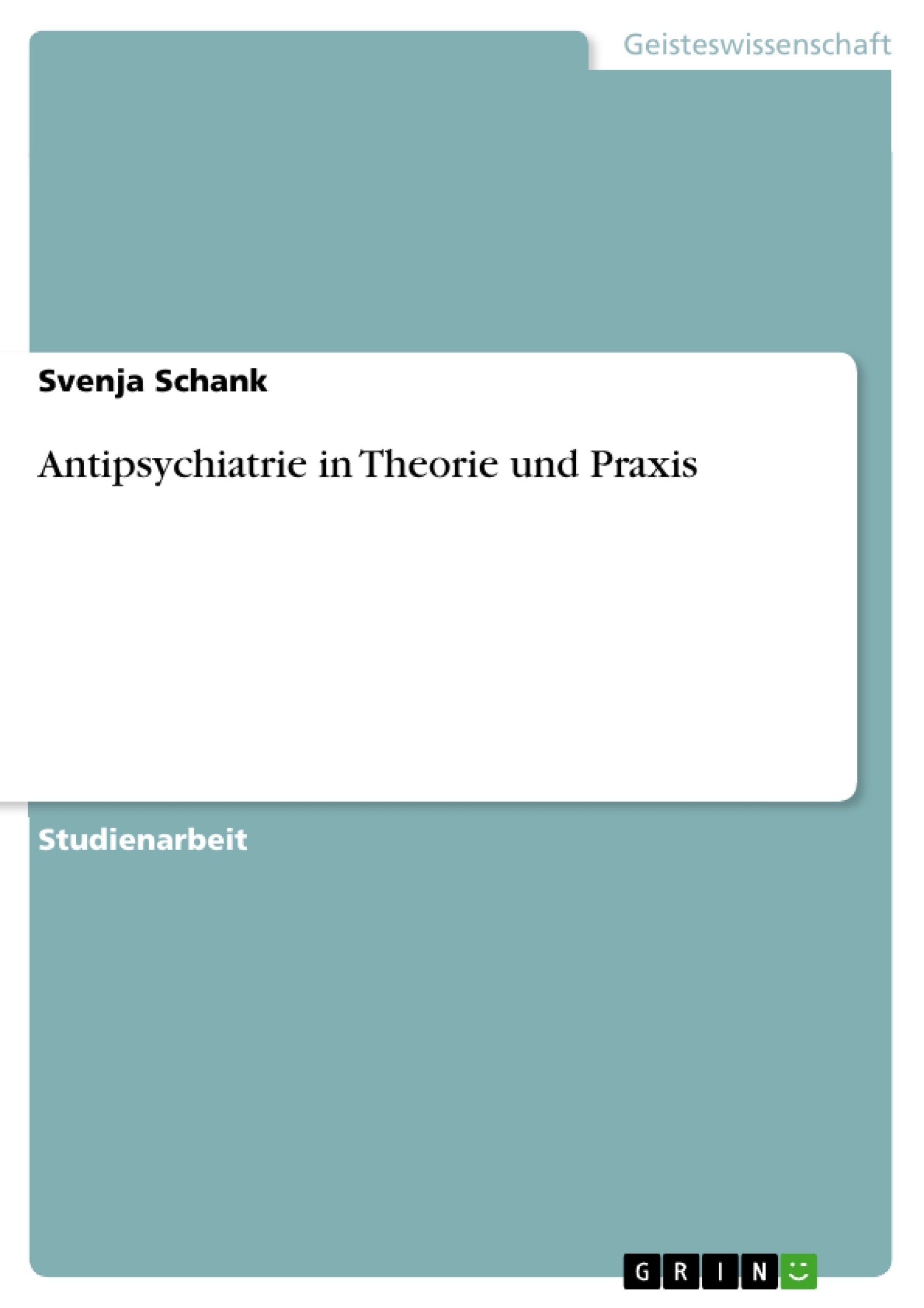Die Psychiatrie ist ein Fachgebiet der Medizin. Nach Gymnich (2000) beschäftigt
sie sich insbesondere mit den Ursachen, dem Verlauf sowie der körperlichen und
medikamentösen Behandlung psychiatrischer Krankheiten.
Psychische Probleme werden im psychiatrischen System, sprich in Kliniken,
neurologischen und psychiatrischen Arztpraxen und psychiatrisch orientierten
Therapeutischen Wohngemeinschaften, als Krankheiten körperlicher Natur
betrachtet.
Foucault (1968) zeigt auf, dass psychische Erkrankungen nicht aus demselben
Blickwinkel heraus zu betrachten sind, wie organische Krankheiten. (Wobei
Körper und Geist trotzdem eine Einheit bilden.)
Die Feststellung einer psychischen Krankheit orientiert sich an gesellschaftlichen
Normen. Was in einer Epoche in einem bestimmten Kulturkreis als psychisch
Krank gilt, kann in einer anderen Epoche oder in einer anderen Gesellschaft als
persönliche Eigenart oder gar als Anzeichen für übermenschliche Fähigkeiten
gewertet werden.
Foucault nimmt damit an, dass der Wahnsinn, wie wir ihn heute sehen, als
historische Universale nicht existiert. Es gab nicht schon immer Wahnsinnige im
Sinne von psychischer Krankheit, diese Auffassung hat sich erst im Zeitverlauf als
gesellschaftliche Meinung entwickelt, und mit ihr die unterschiedlichen
Wahrnehmungsformen des Wahnsinns - bis hin zum Gegenstand der
medizinischen Beforschung und Behandlung - der Pathologisierung.
Foucault (1993) zeigt, dass mittlerweile die Gesellschaft, Natur- und
Sozialwissenschaftler sowie Ärzte die Definitionsmacht über den Wahnsinn
besitzen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ursprung und Funktion der Psychiatrie
- 1.1. Klinik
- 1.2. Psychiatriebetroffene brauchen Alternativen
- 2. Antipsychiatrie
- 2.1. Das Weglaufhaus „Villa Stöckle“
- 2.1.1. Mitarbeiter
- 2.1.2. Konzeption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursprünge und Funktionen der Psychiatrie, beleuchtet kritische Aspekte der psychiatrischen Praxis und stellt alternative Ansätze vor. Der Fokus liegt auf der Machtstruktur innerhalb des psychiatrischen Systems und den daraus resultierenden Folgen für Betroffene.
- Kritik an der Psychiatrie als sozialpolitische Strategie
- Die Psychiatrische Klinik als „totale Institution“
- Die Notwendigkeit von Alternativen zur traditionellen Psychiatrie
- Der Einfluss gesellschaftlicher Normen auf die Definition von psychischer Krankheit
- Die Rolle von Macht und Kontrolle in der Psychiatrie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ursprung und Funktion der Psychiatrie: Dieses Kapitel analysiert die Entstehungsgeschichte und die Funktionsweise der Psychiatrie. Es wird argumentiert, dass die Psychiatrie nicht nur ein medizinisches Fachgebiet ist, sondern auch eine sozialpolitische Strategie darstellt, die zur Kontrolle von gesellschaftlich abweichenden Individuen dient. Foucault's Theorie wird herangezogen, um zu zeigen, wie die Definition von psychischer Krankheit von gesellschaftlichen Normen geprägt ist und sich im Laufe der Zeit verändert hat. Beispiele für diese Veränderungen werden angeführt, wie die Behandlung von Frauen, die ihre Hausarbeit nicht erledigen wollten, oder die Pathologisierung von Homosexualität. Die Psychiatriereform wird kritisch beleuchtet, wobei argumentiert wird, dass sie die Bedürfnisse der Betroffenen nicht ausreichend berücksichtigt.
1.1. Klinik: Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die psychiatrische Klinik als „Herzstück“ des psychiatrischen Systems. Es beschreibt die verschiedenen Abteilungen (Ambulanz, offene und geschlossene Stationen) und wie diese zur zwangsweisen Behandlung beitragen können. Goffmann's Konzept der „totalen Institution“ wird angewendet, um die kontrollierende und regulierende Umgebung psychiatrischer Kliniken zu verdeutlichen. Die negativen Auswirkungen der Klinik auf die Patienten werden anhand von Forschungsergebnissen und persönlichen Erfahrungsberichten illustriert, die zeigen, wie die Zwangsbehandlung und die Medikamentierung zu einer Verschlechterung des Zustands der Patienten führen können.
1.2. Psychiatriebetroffene brauchen Alternativen: Dieses Unterkapitel hebt die Notwendigkeit von Alternativen zur traditionellen psychiatrischen Behandlung hervor. Es wird betont, dass die gängige Praxis für viele Betroffene keine Hilfe darstellt und möglicherweise sogar schädlich ist. Die Frage nach dem eigentlichen Ziel der Psychiatrie – Hilfe oder Machtausübung – wird gestellt und mit Foucaults Thesen verknüpft. Der Abschnitt legt den Grundstein für die Erörterung alternativer Ansätze, die im weiteren Verlauf des Werkes (welches hier nicht vollständig dargestellt wird) detaillierter behandelt werden.
Schlüsselwörter
Psychiatrie, Antipsychiatrie, gesellschaftliche Normen, Machtstrukturen, totale Institutionen, Psychiatriereform, Zwangsbehandlung, alternative Ansätze, psychische Krankheit, Foucault.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Ursprung und Funktion der Psychiatrie – Eine kritische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht kritisch die Ursprünge und Funktionen der Psychiatrie. Sie beleuchtet die Machtstrukturen innerhalb des psychiatrischen Systems und deren Auswirkungen auf Betroffene. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung und Bewertung von Alternativen zur traditionellen Psychiatrie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Kritik an der Psychiatrie als sozialpolitische Strategie, die psychiatrische Klinik als „totale Institution“, die Notwendigkeit von Alternativen, den Einfluss gesellschaftlicher Normen auf die Definition psychischer Krankheit und die Rolle von Macht und Kontrolle in der Psychiatrie. Konzepte von Foucault und Goffman werden angewendet.
Welche Kapitel sind enthalten?
Die Arbeit umfasst Kapitel über den Ursprung und die Funktion der Psychiatrie, wobei die Klinik als „Herzstück“ des Systems und die Notwendigkeit alternativer Ansätze im Fokus stehen. Die Kapitel analysieren die Entstehungsgeschichte und Funktionsweise der Psychiatrie, beschreiben die psychiatrische Klinik und ihre Auswirkungen auf Patienten und stellen die Notwendigkeit von Alternativen zur traditionellen psychiatrischen Behandlung heraus.
Welche Autoren und Theorien werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien von Michel Foucault (zum Beispiel bezüglich der Machtstrukturen und der gesellschaftlichen Konstruktion von Krankheit) und Erving Goffman (zum Konzept der „totalen Institution“ im Zusammenhang mit psychiatrischen Kliniken).
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Es werden Beispiele für die Pathologisierung von abweichendem Verhalten angeführt, wie die Behandlung von Frauen, die ihre Hausarbeit nicht erledigten, oder die Pathologisierung von Homosexualität. Die Arbeit illustriert die negativen Auswirkungen der Zwangsbehandlung und der Medikamentierung anhand von Forschungsergebnissen und persönlichen Erfahrungsberichten.
Welche Schlussfolgerung wird gezogen?
Die Arbeit argumentiert, dass die Psychiatrie nicht nur ein medizinisches Fachgebiet ist, sondern auch eine sozialpolitische Strategie darstellt. Sie hinterfragt das Ziel der Psychiatrie – Hilfe oder Machtausübung – und betont die dringende Notwendigkeit von Alternativen zur traditionellen Psychiatrie, die den Bedürfnissen der Betroffenen besser gerecht werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Psychiatrie, Antipsychiatrie, gesellschaftliche Normen, Machtstrukturen, totale Institutionen, Psychiatriereform, Zwangsbehandlung, alternative Ansätze, psychische Krankheit, Foucault.
Wo wird das Weglaufhaus „Villa Stöckle“ erwähnt?
Das Weglaufhaus „Villa Stöckle“ wird als Beispiel für einen alternativen Ansatz zur traditionellen Psychiatrie genannt und im Kontext der Antipsychiatrie eingeordnet. Die Arbeit beleuchtet möglicherweise die Mitarbeiter und die Konzeption dieses Hauses.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich akademisch mit der Psychiatrie, ihren kritischen Aspekten und alternativen Ansätzen auseinandersetzen möchten. Sie eignet sich für Studierende der Sozialwissenschaften, Psychologie, Soziologie und verwandter Disziplinen.
- Citar trabajo
- Svenja Schank (Autor), 2006, Antipsychiatrie in Theorie und Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55222