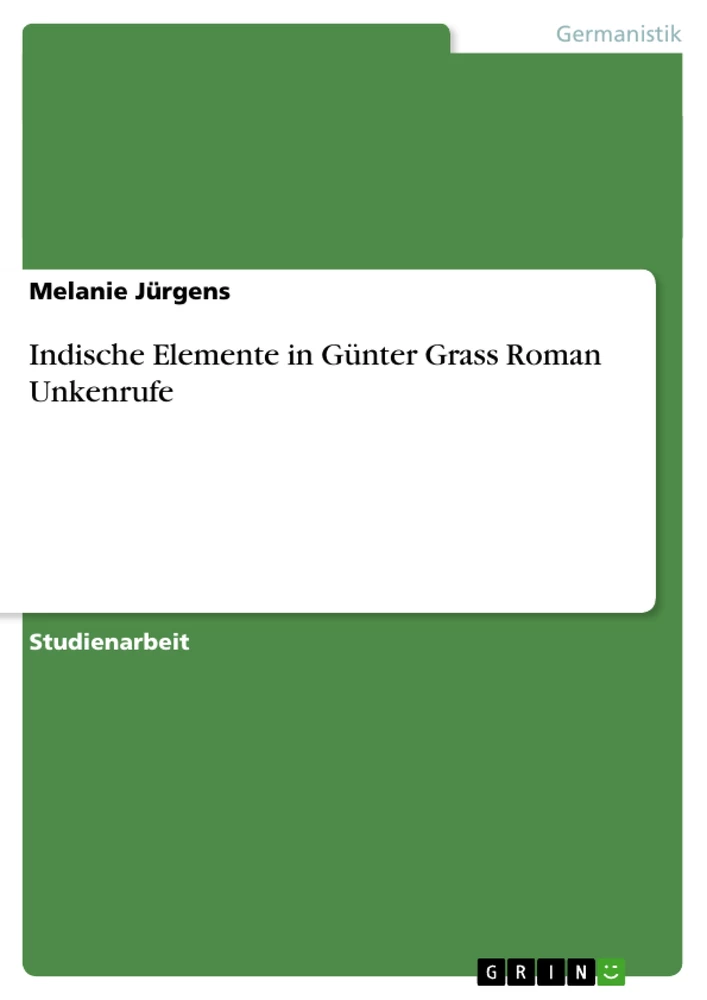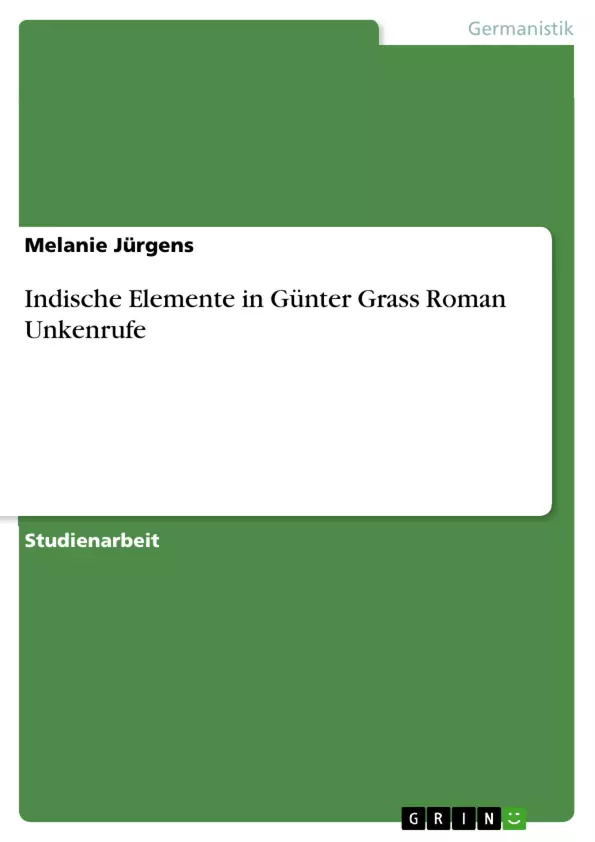Indische Elemente tauchen in Günter Grass′ Erzählung Unkenrufe (1992) nicht zum ersten Mal im Grass′schen Kanon auf. Bereits in der Erzählung Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus (1980) und in dem Reisetagebuch Zunge zeigen (1988) unter anderem setzt sich Grass nach längeren Asien- und vor allem Indien-Aufenthalten mit der Thematik ‚Dritte Welt′ auseinander. Während die beiden genannten Werke direkt auf Grass′ Indien-Aufenthalte folgen und somit deren literarische Verarbeitung beinhalten, stellen sie in der Erzählung Unkenrufe lediglich eine Nebenhandlung um den bengalischen Unternehmer Subhas Chandra Chatterjee dar.
Die Haupthandlung konzentriert sich auf Alexander Reschke, Professor der Kunstgeschichte aus Bochum, geboren in Danzig, und Alexandra Piatkowska, Restauratorin, einst als Polin von Wilna nach Danzig umgesiedelt, beide verwitwet, die sich an Allerseelen 1989 in Danzig zufällig kennenlernen. Kurz darauf werden sie durch ihre Liebe füreinander und durch ein gemeinsames Vorhaben verbunden: durch die Errichtung eines Versöhnungsfriedhofes in Danzig, später der Deutsch-Polnischen Friedhofsgesellschaft (DPFG), die es Vertriebenen ermöglichen soll, in ihrer Heimat beerdigt zu werden. Erzählt wird die Geschichte rückblickend aus der Sicht eines früheren Schulkameraden Reschkes, dem Reschke Tagebücher, Dokumente, Rechnungen, Fotos, Zeitungsausschnitte, Tonbandkassetten aus der Zeit zwischen dem 2.11.89 und Sommer 1991 zukommen läßt, damit dieser die Geschichte von Alexandra und Alexander als eine Art Chronik aufzeichnen kann, weil er früher schon immer so gut Aufsätze schreiben konnte. Der das Material begleitende Brief ist datiert vom Jahre 1999, acht Jahre nach Reschkes Tod. Die Erzählung ist gespickt mit Zeitsprüngen und Vorausdatierungen und bewegt sich oft über den erzählten Zeitraum zwischen 1989 und 1991 hinaus. Grass läßt den Erzähler somit in der dem Autor eigenen vierten Zeit, der "Vergegenkunft" schreiben, in der die Vergangenheit und die Zukunft am Schreibtisch vergegenwärtigt werden.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Persönliche Indien-Erfahrungen von Günter Grass und deren literarische Verarbeitung
- Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus
- Zunge zeigen
- Chatterjees Fahrradrikschaunternehmen in Danzig, seine utopischen Dimensionen sowie seine Verwirklichung
- Subha Chandra Chatterjee- eine Kreation aus Salman Rushdie und Subha Chandra Bose?
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Figur des Subhas Chandra Chatterjee in Günter Grass' Roman "Unkenrufe". Der Fokus liegt auf der Analyse der Figur und der Einbettung in den Kontext von Grass' Indien-Erfahrungen und deren literarischer Verarbeitung. Zudem werden die utopischen Dimensionen von Chatterjees Vorhaben und deren Verwirklichung untersucht. Die Arbeit beleuchtet auch die mögliche Verbindung zwischen Chatterjee und dem Schriftsteller Salman Rushdie.
- Die Figur des Subhas Chandra Chatterjee in "Unkenrufe"
- Günter Grass' Indien-Erfahrungen und deren literarische Verarbeitung
- Die utopischen Dimensionen von Chatterjees Vorhaben und deren Verwirklichung
- Die mögliche Verbindung zwischen Chatterjee und Salman Rushdie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Analyse von Subhas Chandra Chatterjee in Günter Grass' "Unkenrufe" dar. Dabei werden die bisherigen Indien-Aufenthalte von Günter Grass und deren literarische Verarbeitung in "Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus" und "Zunge zeigen" beleuchtet.
Im weiteren Verlauf wird die Figur des Subhas Chandra Chatterjee und sein Fahrradrikschaunternehmen in Danzig genauer betrachtet. Es werden die utopischen Dimensionen des Vorhabens und die Frage der Verwirklichung behandelt.
Schlüsselwörter
Günter Grass, "Unkenrufe", Subhas Chandra Chatterjee, Indien, Fahrradrikscha, Utopie, Salman Rushdie
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse zu Günter Grass' 'Unkenrufe'?
Die Arbeit untersucht die indischen Elemente im Roman, insbesondere die Figur des bengalischen Unternehmers Subhas Chandra Chatterjee.
Welche Rolle spielt Indien im Werk von Günter Grass?
Grass verarbeitete seine Indien-Aufenthalte bereits in Werken wie 'Kopfgeburten' und 'Zunge zeigen', wobei Indien oft als Spiegel für die 'Dritte Welt' dient.
Wer ist Subhas Chandra Chatterjee?
Chatterjee ist ein bengalischer Unternehmer in Danzig, der dort ein Fahrradrikschaunternehmen gründet, was utopische Dimensionen annimmt.
Gibt es eine Verbindung zu Salman Rushdie?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob die Figur Chatterjee eine literarische Kreation ist, die Bezüge zu Salman Rushdie und Subhas Chandra Bose aufweist.
Was bedeutet der Begriff "Vergegenkunft" bei Grass?
Es ist eine Erzählweise, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft am Schreibtisch gleichzeitig vergegenwärtigt werden.
Was ist die Haupthandlung von 'Unkenrufe'?
Die Handlung dreht sich um Alexander Reschke und Alexandra Piatkowska, die in Danzig eine Deutsch-Polnische Friedhofsgesellschaft gründen.
- Citation du texte
- Melanie Jürgens (Auteur), 2001, Indische Elemente in Günter Grass Roman Unkenrufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5523