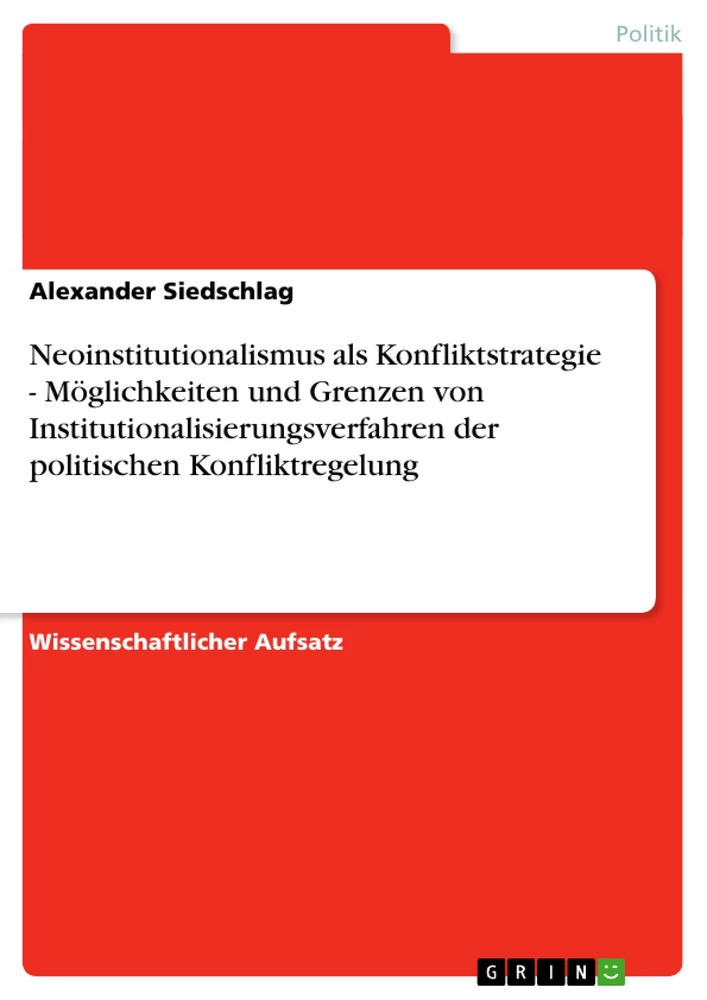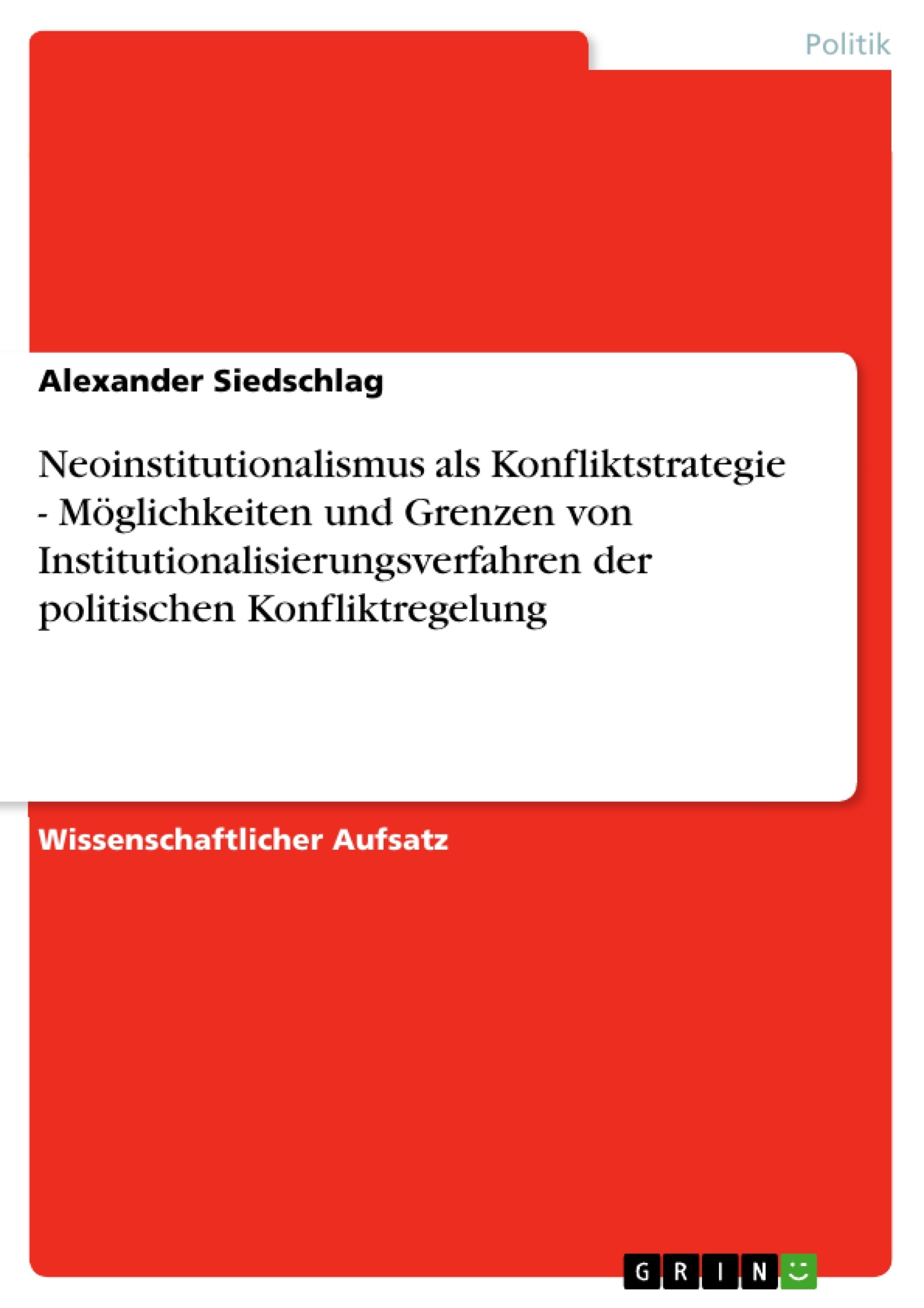Eine neoinstitutionalistische Perspektive kann zuallererst helfen, Konflikt wirklich als Aspekt von Politik zu begreifen und folglich mit seiner Regelung tatsächlich im politischen Prozeß anzusetzen (und Konfliktregelung nicht nur als ein Verhandlungsspiel, als Frage von Positionsveränderungen oder stabileren Interaktionsstrukturen bzw. der strukturellen Absicherung der Iteration von Einzelhandlungen zu ökonomisch effektiven, alle Seiten bevorteilenden Handlungsketten zu betreiben). Der hauptsächliche Wirkmechanismus von Konfliktregelung durch Institutionalisierung ist Konflikttransformation: die Veränderung der pejorativen Konfliktprozesse in weniger desintegrative Formen der Beziehungsregelung. Grundlegend für ihren Erfolg ist es, die besondere Qualität politischer Institutionalisierung zu berücksichtigen: Politische Institutionalisierung bedeutet die Umsetzung einer jeweils bestimmten Regelungsordnung mit bestimmten Leitideen und Prinzipien. Sie ist im Grundsatz gerade interaktionszentrierter Institutionalisierungsmodus, keine "Evolution der Kooperation" (Robert Axelrod). Leitideen, Prinzipen und politische Normen als solche kann man nicht intentional institutionalisieren; sie bilden vielmehr die Voraussetzung für Institutionalisierung.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Institutionalisierung als Konflikttransformation
- Allgemeine Dimensionen und Bedingungsfaktoren meliorativer Konflikttransformation
- Vier Theoriemodelle und ihre Praxisverfahren
- Institutionalisierung und Konfliktverlauf in politischen Praxisfällen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle von Neoinstitutionalismus als Konfliktstrategie in politischen Prozessen. Sie untersucht, wie Institutionalisierungsverfahren zur Regelung von Konflikten beitragen können und welche Grenzen diese Verfahren aufweisen.
- Bedeutung des Neoinstitutionalismus für die Konfliktregelung
- Analyse der Dimensionen und Bedingungen erfolgreicher Konflikttransformation
- Bewertung verschiedener Theoriemodelle und Praxisverfahren der Institutionalisierung
- Untersuchung des Einflusses von Institutionalisierung auf den Konfliktverlauf in politischen Praxisfällen
- Identifizierung der Grenzen von Institutionalisierungsverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Institutionalisierung als Konflikttransformation: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Neoinstitutionalismus für die Konfliktregelung und diskutiert, wie Institutionalisierungsprozesse zu einer Transformation von destruktiven Konflikten in konstruktive Formen der Interaktion führen können.
- Kapitel 2: Allgemeine Dimensionen und Bedingungsfaktoren meliorativer Konflikttransformation: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Dimensionen und Bedingungsfaktoren, die für eine erfolgreiche Transformation von Konflikten durch Institutionalisierungsprozesse relevant sind.
- Kapitel 3: Vier Theoriemodelle und ihre Praxisverfahren: Dieses Kapitel stellt verschiedene Theoriemodelle und Praxisverfahren vor, die im Kontext der Institutionalisierung von Konfliktregelung verwendet werden können.
- Kapitel 4: Institutionalisierung und Konfliktverlauf in politischen Praxisfällen: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Institutionalisierung auf den Verlauf von Konflikten in konkreten politischen Praxisfällen.
Schlüsselwörter
Neoinstitutionalismus, Konfliktstrategie, Konflikttransformation, Institutionalisierung, Politische Konfliktregelung, Praxisverfahren, Theoriemodelle, Konfliktverlauf, Politische Praxisfälle.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Konflikttransformation durch Institutionalisierung?
Es ist die Umwandlung destruktiver (pejorativer) Konfliktprozesse in weniger desintegrative Beziehungsformen durch feste Regeln und Prinzipien.
Wie grenzt sich der Neoinstitutionalismus von Robert Axelrod ab?
Im Gegensatz zur „Evolution der Kooperation“ setzt der Neoinstitutionalismus auf eine interaktionszentrierte Ordnung mit Leitideen und Prinzipien statt nur auf die Wiederholung von Einzelhandlungen.
Können politische Normen absichtlich institutionalisiert werden?
Leitideen und Normen können laut Theorie nicht einfach „verordnet“ werden; sie bilden vielmehr die notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Institutionalisierung.
Was sind die Grenzen von Institutionalisierungsverfahren?
Grenzen liegen dort, wo die zugrunde liegenden Leitideen von den Akteuren nicht geteilt werden oder wo Institutionen rein strategisch als Verhandlungsspielraum missbraucht werden.
Welche Rolle spielen Theoriemodelle in der politischen Praxis?
Sie bieten verschiedene Verfahrensweisen an, um Konfliktverläufe in Praxisfällen zu analysieren und strukturelle Absicherungen für politische Interaktionen zu schaffen.
Was ist das Ziel einer meliorativen Konflikttransformation?
Das Ziel ist eine Verbesserung der Konfliktsituation durch die Etablierung einer Regelungsordnung, die alle beteiligten Seiten in einen stabilen Rahmen einbindet.
- Arbeit zitieren
- Alexander Siedschlag (Autor:in), 2002, Neoinstitutionalismus als Konfliktstrategie - Möglichkeiten und Grenzen von Institutionalisierungsverfahren der politischen Konfliktregelung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5527