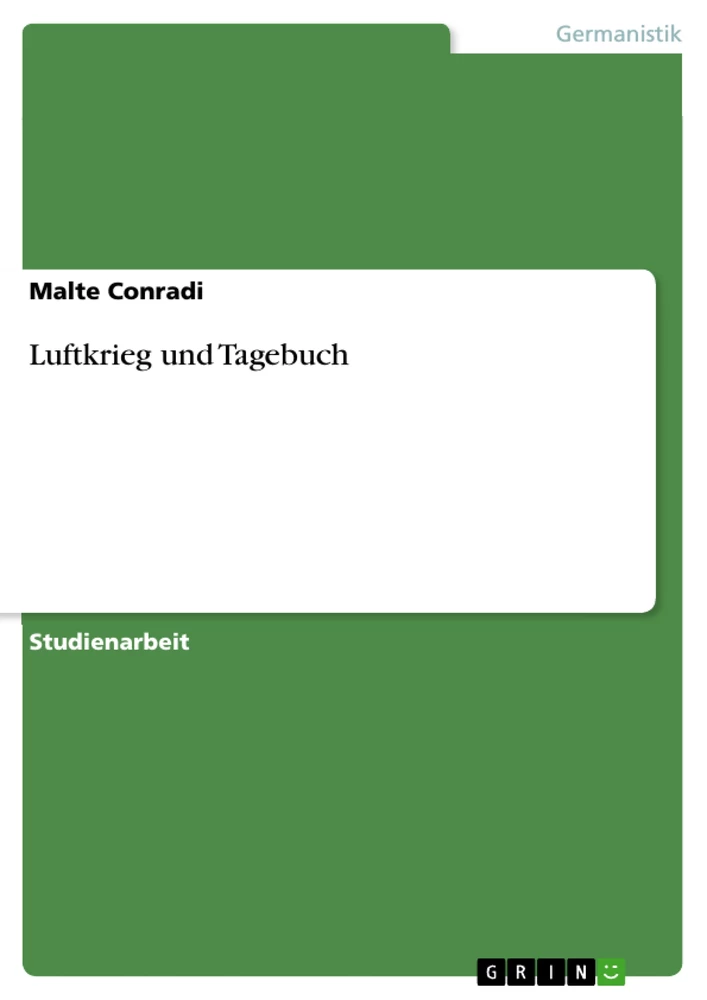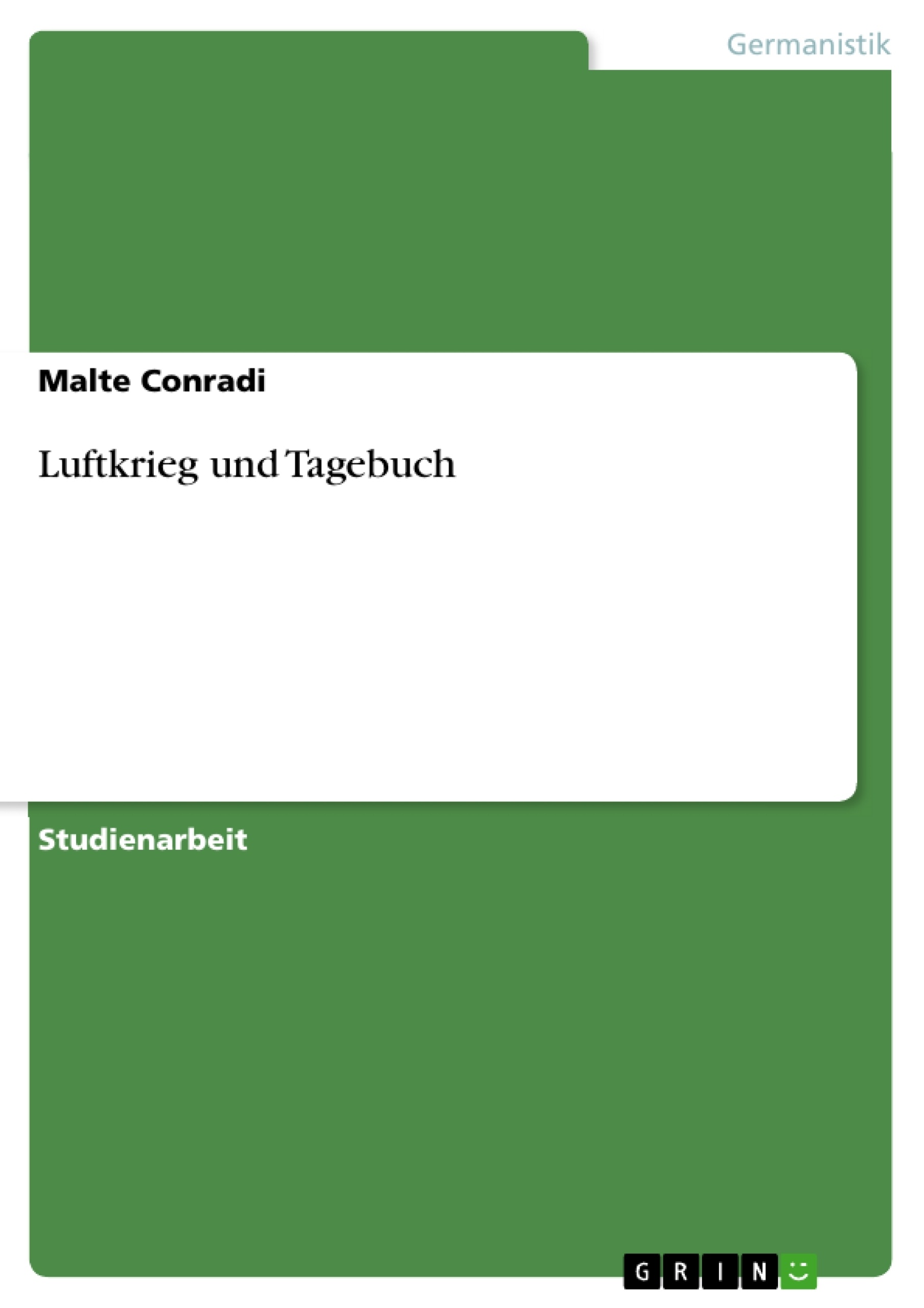Noch nicht lange hat das Thema Bombenkrieg gegen deutsche Städte in den Medien Konjunktur. 1995, als sich das Kriegsende zum 50. Mal jährte, wurden (wie Klaus Neumann dargestellt hat) die Erlebnisse der deutschen Stadtbevölkerung noch eher zaghaft und unsicher diskutiert. Noch 50 Jahre nach den Ereignissen gab es keinen Konsens des Gedenkens, kein gefestigtes Geschichtsbild. Es wurde schnell deutlich, dass die Zeit, in der der Krieg aus den fernen Ländern in die Heimat kam, keinen festen Platz im kulturellen Gedächtnis der Deutschen hatte. Und so war diese erstmalige Diskussion des Luftkriegs gegen deutsche Zivilisten ein Wagnis. Denn die Bahnen, in denen sie verlaufen würde und die Erinnerungen, die zutage treten würden, waren weitgehend unbekannt. Vielleicht aus der Erkenntnis, nicht mehr lange diese Möglichkeit zu haben, wurden in diesen Wochen viele Zeitzeugen angehört und lebendige Erinnerungen festgehalten. Für viele der Betroffenen war dies eine ungeahnte Aufwertung und erstmalige gesellschaftliche Anerkennung ihrer Erinnerungen, denn zum ersten mal seit Bestehen der Bundesrepublik (in der DDR war an eine ehrliche Debatte über dieses Thema gar nicht zu denken) wurde plötzlich über den Luftkrieg – und auch über mögliche Gründe für das lange Schweigen darüber - gesprochen.
Die Präsenz des Themas in den Medien mag ein Anlass für den Schriftsteller und Literaturwissenschaftler W.G. Sebald gewesen sein, eine von ihm schon 1982 zum ersten mal geäußerte und damals kaum wahrgenommene These wieder aufzugreifen und 1997 in einer dreiteiligen Zürcher Universitätsvorlesung weiterzuentwickeln: Die These vom Versagen der gesamten deutschen Literatur vor dem Luftkrieg gegen deutsche Städte. Die Bombennächte und –tage seien, geradezu von einem Tabu belegt, in der deutschsprachigen Literatur nie angemessen zur Sprache gekommen, so Sebald.
Nun – in den Jahren nach 1997 - schien die Zeit für eine breite Diskussion dieser These endlich gekommen. Zunächst fand sie im deutschsprachigen Feuilleton und nach Veröffentlichung der Vorlesung als Essay im Jahre 19994 auch in einigen wissenschaftlichen Untersuchungen statt.
Weitgehend missachtet oder gar ignoriert wurde in der Diskussion um die Fragen, welche literarischen Zeugnisse des Luftkriegs es gibt und wie Literatur überhaupt reagieren kann auf solch ein kollektives Trauma, das eigentlich Naheliegendste: die dokumentarische und insbesondere die Tagebuchliteratur derer, die dabei waren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Darstellbar oder nicht?
- III. Warum Tagebücher?
- IV.a. Die Tagebücher Missie Vassiltchikovs und Ursula von Kardorffs
- IV.b. Tagebücher als Selbsttherapie
- IV.C. Schuld und Verantwortung
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Tagebücher von Missie Vassiltchikov und Ursula von Kardorff im Kontext des Luftkriegs gegen deutsche Städte während des Zweiten Weltkriegs. Sie beleuchtet die Darstellung der Kriegserfahrungen in den Tagebüchern und untersucht, wie die Autorinnen die Erlebnisse der Luftangriffe verarbeitet und reflektiert haben. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Tagebücher als Mittel der Selbsttherapie und der Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung dienen können.
- Darstellung von Kriegserfahrungen in Tagebüchern
- Tagebücher als Mittel der Selbsttherapie
- Die Rolle von Schuld und Verantwortung im Kontext des Luftkriegs
- Die Bedeutung von literarischen Zeugnissen des Luftkriegs
- Die Debatte um die Darstellung des Luftkriegs in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Luftkrieg gegen deutsche Städte und die Bedeutung von Zeitzeugenberichten ein. Sie erläutert den damaligen Stand der Debatte über den Luftkrieg und die Rezeption des Themas in der Literatur.
II. Darstellbar oder nicht?
Dieses Kapitel diskutiert die These von W.G. Sebald, der die deutsche Literatur für ihr Versagen beim Umgang mit dem Thema Luftkrieg kritisiert. Es beleuchtet die Kritik an Sebalds These, insbesondere die Bedeutung von dokumentarischen und tagebuchliterarischen Zeugnissen.
III. Warum Tagebücher?
Das Kapitel argumentiert für die Relevanz von Tagebüchern als Quelle für die Erforschung des Luftkriegs. Es untersucht die Rolle von Tagebüchern als Mittel der Selbsttherapie und ihre Bedeutung für die Verarbeitung von Kriegserfahrungen.
IV.a. Die Tagebücher Missie Vassiltchikovs und Ursula von Kardorffs
In diesem Kapitel werden die Tagebücher von Missie Vassiltchikov und Ursula von Kardorff vorgestellt und ihre Besonderheiten in Bezug auf den Luftkrieg herausgestellt.
IV.b. Tagebücher als Selbsttherapie
Dieser Abschnitt analysiert, wie die Autorinnen die Tagebücher als Mittel der Selbsttherapie nutzen, um ihre Kriegserlebnisse zu verarbeiten und zu reflektieren.
IV.C. Schuld und Verantwortung
Das Kapitel untersucht, wie die Tagebücher von Vassiltchikov und Kardorff mit den Themen Schuld und Verantwortung im Kontext des Luftkriegs umgehen.
Schlüsselwörter
Luftkrieg, Tagebuchliteratur, Selbsttherapie, Schuld, Verantwortung, Kriegstrauma, Literaturkritik, Zeitzeugenberichte, Sebald, Ledig, Vassiltchikov, Kardorff.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Tagebücher wichtige Quellen für die Erforschung des Luftkriegs?
Tagebücher bieten unmittelbare, dokumentarische Zeugnisse von Zeitzeugen, die den Bombenkrieg miterlebt haben, und ergänzen so das kulturelle Gedächtnis um persönliche Perspektiven.
Welche Kritik äußerte W.G. Sebald an der deutschen Literatur?
Sebald vertrat die These, dass die gesamte deutsche Nachkriegsliteratur vor der Aufgabe versagt habe, das kollektive Trauma des Luftkriegs gegen deutsche Städte angemessen darzustellen.
Welche Rolle spielen Tagebücher als Selbsttherapie?
Das Schreiben half den Betroffenen, die traumatischen Erlebnisse der Bombennächte zu verarbeiten, zu reflektieren und psychisch zu bewältigen.
Wessen Tagebücher werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Tagebücher von Missie Vassiltchikov und Ursula von Kardorff.
Wie gehen die Autorinnen mit Schuld und Verantwortung um?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Tagebuchschreiberinnen die Zerstörung der Städte im Kontext der nationalsozialistischen Verbrechen und der eigenen Verantwortung reflektieren.
- Citar trabajo
- Malte Conradi (Autor), 2006, Luftkrieg und Tagebuch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55299