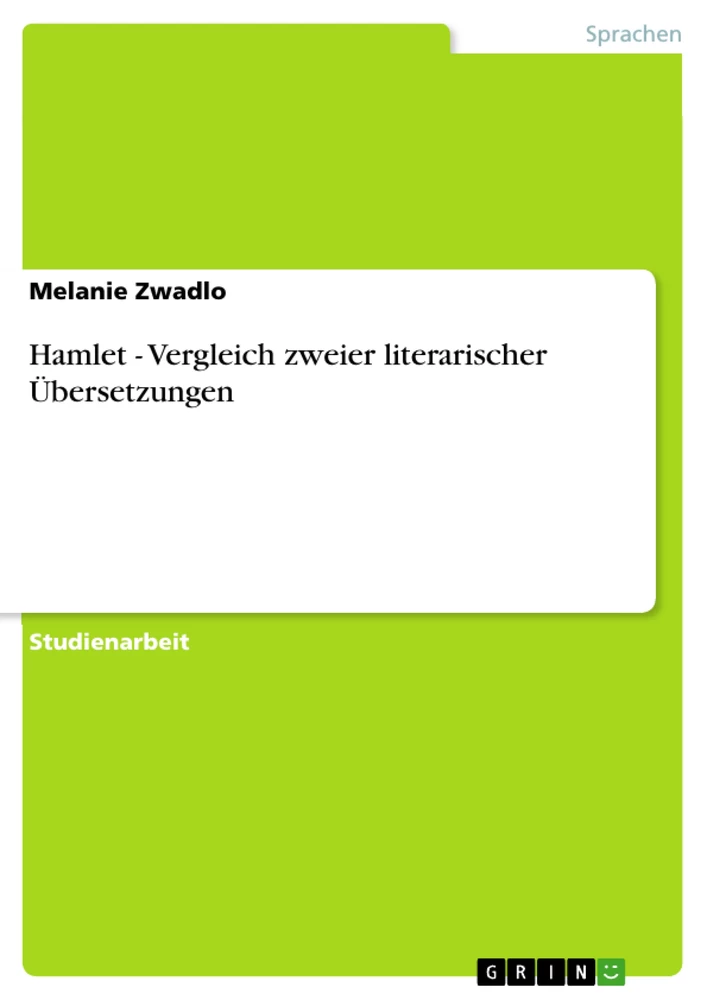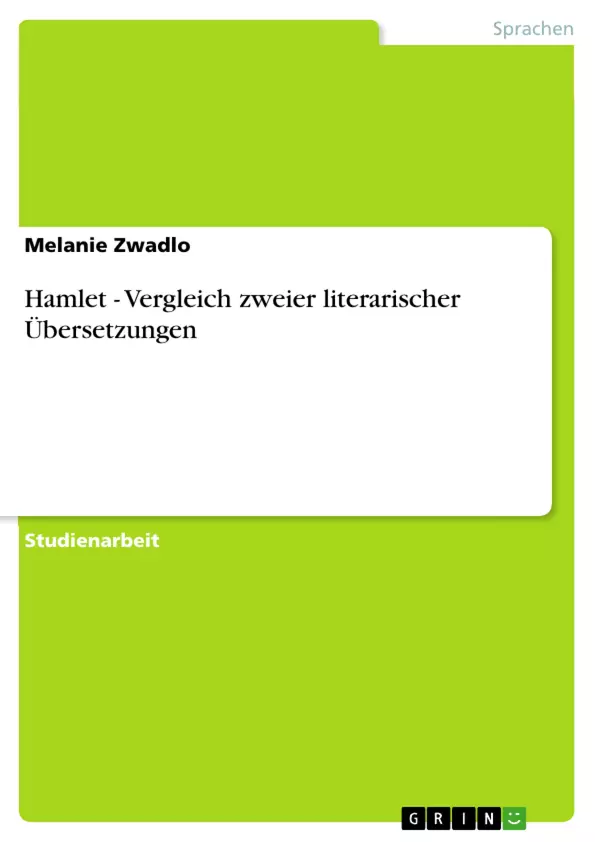Bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein hat Hamlet hauptsächlich fasziniert. „Mit rund 4000 Zeilen, von denen 40 Prozent auf die Titelgestalt entfallen, ist Hamlet Shakespeares längstes Drama. Zugleich ist es das problematischste. Es hat zahllose Deutungen erfahren und fordert noch immer zu neuen Interpretationsversuchen heraus.“ (Kindlers 1995, S. 298) Für dieses Drama trifft in erhöhtem Maße zu, dass jeder einzelne und jede Epoche in der Interpretation Shakespeares zugleich das eigene Portrait mitentwirft. „Der Zuschauer ist darüber hinaus vom Dramatiker zum `Mehrwissenden` gemacht, er kann Gesichtspunkte wahrnehmen“ und sieht das Stück in Dimensionen (Klose 1969, 1990, S. 132).
Dies gilt verstärkt für den Leser, denn der Zuschnitt des Dramas macht es recht schwer, alle Gesichtspunkte und Dimensionen unter dem Eindruck einer Aufführung zu bewahren oder gar durchzusetzen.
Wie andere populäre Dramatiker der Zeit schrieb Shakespeare direkt für die Bühne, nicht für ein Lesepublikum. Der Theaterbetrieb war hektisch, es musste rasch gearbeitet werden, größere oder kleinere Widersprüche und Unklarheiten wurden nicht so ernst genommen und vom Publikum (im Gegensatz zum gründlichen Leser späterer Jahrhunderte) wohl nicht einmal bemerkt. Shakespeare ist, was man im Roman einen `verlässlichen` Erzähler nennen würde. Er hat (ebenso wie alle anderen Eigenschaften des Textes) diese Grundanlage des Stücks bestimmt, kaum in der Erwartung, dass sie unterlaufen oder umgangen werde, sondern, dass sie als Leitlinie diene. Hamlet ist „ein extremer Fall einer generellen Tendenz traditioneller Tragödienkritik, die Gestalt des tragischen Helden überzubetonen und zu isoliert zu betrachten“ Hamlet ist ein Schlüsseltext der modernen abendländischen Kultur. Das Besondere an Hamlet ist, dass er Generationen von Theaterzuschauern, vor allem aber von Lesern, den Eindruck einer beispiellosen Nähe, Gleichgestimmtheit und Seelenverwandtschaft vermittelte; dass er mehr als irgendeine andere literarische Figur zum Spiegel seiner Betrachter wurde. „Hamlet, dieses Sprachkonstrukt und Gebilde aus `words, words, words`, lockt mit einem schier unwiderstehlichen Identifikationsversprechen: Erkenne dich in mir und erkenne damit, was Menschsein heißt.“
Inhaltsverzeichnis
- Bibliographische Beschreibung und Referat
- EINLEITUNG
- ZIEL- UND AUFGABENSTELLUNG
- MATERIALGRUNDLAGE
- METHODOLOGISCHES VORGEHEN
- THEORETISCHE AUSGANGSPOSITION
- Das Übersetzen
- Die Problematik des Übersetzens englischsprachiger Literatur
- Die Problematik des Übersetzens szenischer Texte
- Die Problematik des deutschen Shakespeare-Texts
- Sprache in der Literatur
- Die Sprache Shakespeares
- Redeformen
- Sprachstil
- Sinnfiguren
- Klangfiguren
- Grundsätzliches zu Übersetzungsvergleichen
- BESCHREIBUNG DES KLASSIFIZIERTEN MATERIALS
- Bibliographische Daten William Shakespeares
- Entstehungsgeschichte
- Inhaltsangabe
- Die Spezifika der Stoffgattung des Werks
- Das Drama
- Die Tragödie
- Die Übersetzer und ihre Übersetzungsstrategien
- Der Übersetzungsprozess
- Kulturspezifische Übersetzungsprobleme
- Anredeformen
- Namen
- Anspielungen
- Fremdwörter
- Sprachenpaarspezifische Übersetzungsprobleme
- Metapher
- Neologismus
- Poetische Diktion
- Reim und Metrum
- Syntax
- Typographie (Gestaltung des Schriftsatzes)
- Strategiebedingte Modifikationen
- Auslassungen
- Hinzufügungen
- Wortspiele zur Erzielung der künstlerischen Wirkung
- Fehlübersetzungen
- ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER ARBEIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Vergleich zweier deutscher Übersetzungen von William Shakespeares Hamlet. Sie untersucht die verschiedenen Übersetzungsstrategien und -lösungen im ersten Akt der beiden Ausgaben von August Wilhelm von Schlegel und Frank Günther, um die Auswirkungen von verschiedenen Einflussgrößen im Übersetzungsprozess zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Ermittlung von Modifikationen im Zieltext im Vergleich zum Ausgangstext und der Ableitung der damit verbundenen Einflussfaktoren.
- Vergleich der Übersetzungsstrategien von A.W. Schlegel und Frank Günther im 1. Akt von Hamlet
- Analyse von Modifikationen in den Zieltexten im Verhältnis zum Originaltext
- Identifizierung von Einflussgrößen im Übersetzungsprozess
- Bewertung der Auswirkungen von Modifikationen auf den Informationsgehalt der Übersetzungen
- Untersuchung der Wirkung von Modifikationen auf den zielsprachigen Rezipienten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung von Hamlet als Schlüsseltext der modernen abendländischen Kultur und die Faszination, die das Werk über Jahrhunderte hinweg auf Leser und Zuschauer ausübt, hervorhebt. Anschließend wird die Ziel- und Aufgabenstellung der Arbeit präzisiert, die darin besteht, die verschiedenen Übersetzungsstrategien der beiden Übersetzungen im 1. Akt von Hamlet zu vergleichen und zu analysieren. Der dritte Abschnitt behandelt die theoretische Ausgangsposition und beschäftigt sich mit den Herausforderungen beim Übersetzen von englischsprachiger Literatur im Allgemeinen und von szenischen Texten im Speziellen. Dieser Teil beleuchtet auch die Besonderheiten des deutschen Shakespeare-Texts und die Bedeutung der Sprache in der Literatur.
Im Kapitel „Beschreibung des klassifizierten Materials“ werden die bibliographischen Daten von William Shakespeares Hamlet, die Entstehungsgeschichte des Werks und die Spezifika der Stoffgattung „Drama“ und „Tragödie“ erläutert. Der Fokus liegt hier auf den Übersetzern und ihren individuellen Übersetzungsstrategien sowie auf dem Übersetzungsprozess selbst. Es werden kulturspezifische und sprachenpaarspezifische Übersetzungsprobleme, wie z.B. Anredeformen, Namen, Anspielungen, Fremdwörter und die Übersetzung von Metaphern, Neologismen, poetischer Diktion, Reim und Metrum, Syntax, Typographie und Wortspielen, untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der literarischen Übersetzung, insbesondere dem Vergleich zweier deutscher Übersetzungen von William Shakespeares Hamlet. Die Schlüsselwörter umfassen Übersetzungsstrategien, Übersetzungslösungen, Einflussgrößen, Modifikationen, Zieltext, Ausgangstext, Kulturspezifische Probleme, Sprachenpaarspezifische Probleme, Rezeption, Informationsgehalt, Rezipient.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit einem detaillierten Vergleich zweier bedeutender deutscher Übersetzungen von William Shakespeares "Hamlet", namentlich der Versionen von August Wilhelm von Schlegel und Frank Günther.
Warum gilt Hamlet als eines der problematischsten Dramen Shakespeares?
Mit rund 4000 Zeilen ist es Shakespeares längstes Drama. Es bietet zahllose Deutungsmöglichkeiten und fordert jede Epoche dazu heraus, ein eigenes Portrait in der Interpretation zu entwerfen.
Welche spezifischen Übersetzungsprobleme werden in der Arbeit untersucht?
Die Untersuchung fokussiert auf kulturspezifische Probleme wie Anredeformen und Namen sowie sprachenpaarspezifische Aspekte wie Metaphern, Wortspiele, Reim und Metrum.
Welcher Teil des Dramas dient als Materialgrundlage für den Vergleich?
Der Fokus der Analyse liegt auf den verschiedenen Übersetzungsstrategien und -lösungen innerhalb des ersten Aktes von Hamlet.
Was ist das Besondere an der Figur des Hamlet für den Leser?
Hamlet vermittelt eine beispiellose Nähe und Seelenverwandtschaft; er fungiert als Spiegel des Betrachters und lädt zur Identifikation mit der Frage nach dem Menschsein ein.
- Arbeit zitieren
- Melanie Zwadlo (Autor:in), 2005, Hamlet - Vergleich zweier literarischer Übersetzungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55435