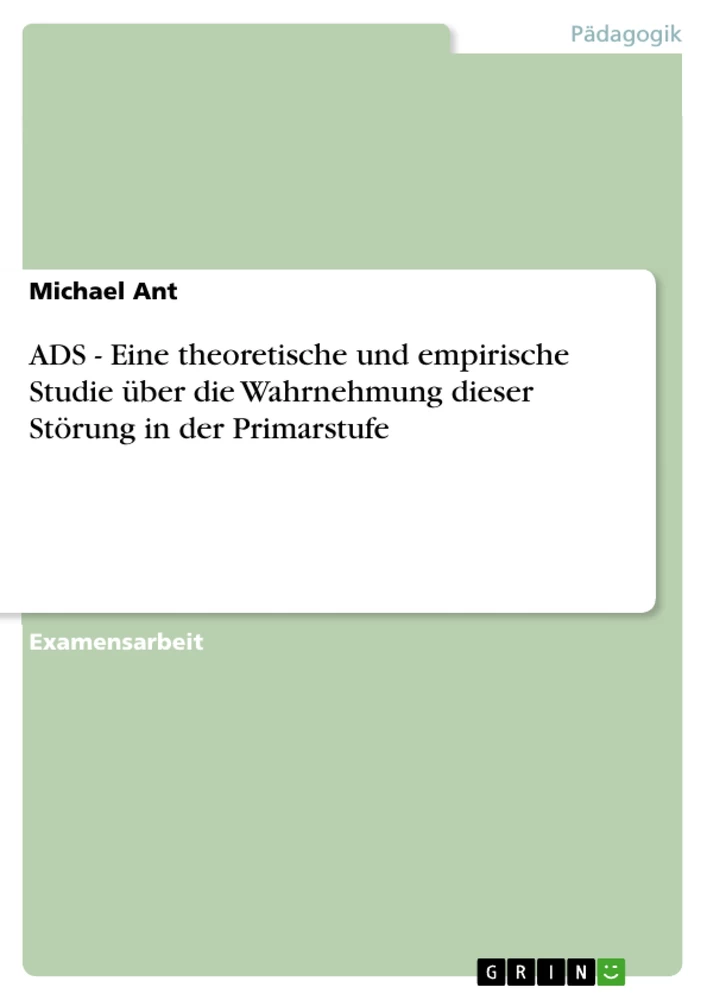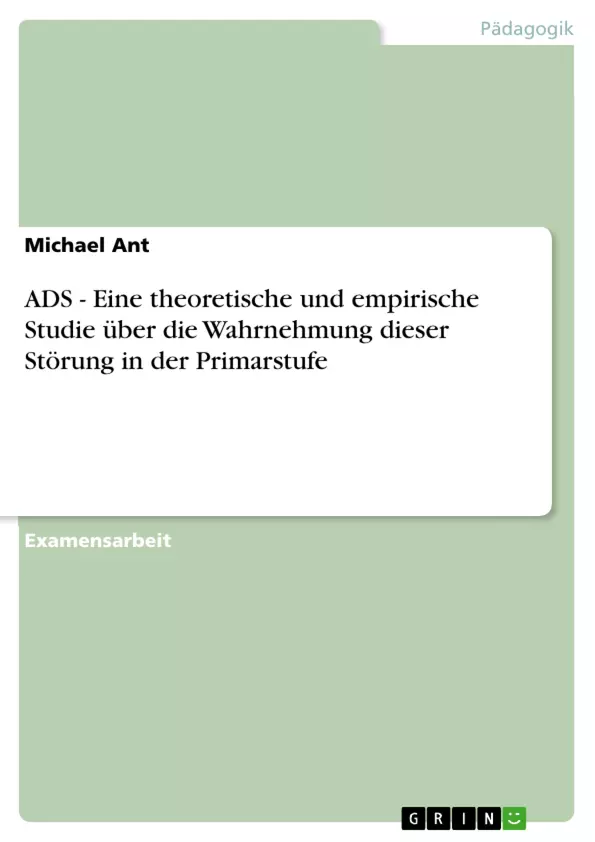Die vorliegende Abschlussarbeit des Lehramtsstudiengangs für die Primarstufe soll Aufschluss darüber geben, welche wissenschaftlich-theoretischen Erkenntnisse über das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) bestehen und wie unmittelbar Betroffene dieses Phänomen im Alltag wahrnehmen.
Die Aufmerksamkeitsstörung bei Kindern ist keineswegs ein Problem der heutigen Zeit, sondern sie wurde schon im 19. Jahrhundert von dem Kinderpsychiater Dr. Heinrich Hoffmann in der Geschichte vom „Struwwelpeter“ thematisiert. Seine Schilderungen von einem sehr temperamentvollen, und vor Energie strotzenden Kind spiegeln die Merkmale einer ADS wider. Galt das Verhalten damals noch als ungewöhnlich, aber nicht als „krankhaft“, ist es mittlerweile als wesentliche Störung anerkannt, die in der Öffentlichkeit heftig, kontrovers und überaus emotional diskutiert wird. Es hat den Anschein, dass sich inzwischen bei manchen Menschen ein vermeintlich nur „außergewöhnlicher Wesenszug“ etabliert hat, der in Wirklichkeit aber ihre Fähigkeiten beeinträchtigt, und dass vor allem die Anzahl der ADS-Kinder stetig anwächst.
Mir bot sich im Rahmen meines Studiums die Möglichkeit, an einer Selbsthilfegruppe für Eltern von ADS- Kindern teilzunehmen. Dabei hatte ich das erste Mal die Gelegenheit, im direkten Kontakt mit betroffenen Eltern mehr über ihre Sorgen und Probleme zu erfahren. Der Fragebogen für Lehrer und Eltern, den ich für diese Studie entwickelt habe, wird daher die Probleme dieser beteiligten Personen intensiv berücksichtigen.
Um eine empirische Untersuchung durchzuführen, der eine Befragung vorausgeht, stellen die theoretischen Grundlagen eine Basis dar. Aus diesem Grunde werde ich nach Klärung von Begrifflichkeiten eine Übersicht über die theoretischen Grundlagen geben. Hier wird genau beschrieben, wie sich die Störung bei den Kindern zeigt, wie sie festzustellen ist und wie sie zustande kommen kann. Im Anschluss werde ich auf ausgewählte Therapiemöglichkeiten und konkrete Interventionen in der Primarstufe eingehen; die Präsentation der Interventionsformen soll möglichst kritisch erfolgen und Möglichkeiten sowie Grenzen aufzeigen.
Abgerundet wird die Arbeit durch eine empirische Untersuchung zur Wahrnehmung einer ADS in der Grundschule, dabei werden, unter Wahrung der Anonymität und des Datenschutzes, die Erfahrungen/Meinungen der Lehrer und Eltern, die sie durch Beantwortung eines Fragebogens mitteilen, ausgewertet und kritisch interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1. ADS- Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom/ Störung
- 1.1 Definitionen
- 1.1.1 Der Begriff der Aufmerksamkeit
- 1.1.2 Der Begriff der Wahrnehmung
- 1.1.3 Die Begriffe der Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsstörung
- 1.1.4 Die Begriffe des Symptoms und des Syndroms
- 1.2 Der Stellenwert von Aufmerksamkeit und Wachheit im kindlichen Lernprozess
- 1.3 Terminologie und Prävalenz einer ADS
- 1.4 Entwicklungspsychologische Aspekte einer ADS
- 1.1 Definitionen
- 2. Theoretische Grundlagen des ADS
- 2.1 Das Erscheinungsbild
- 2.1.1 Primärsymptome des ADS
- 2.1.2 Komorbiditäten
- 2.1.3 Fallbeispiel aus der Grundschule
- 2.2 Die Diagnose
- 2.2.1 Diagnostische Kriterien der DSM IV und ICD 10
- 2.2.2 Differentialdiagnostik
- 2.2.3 Problemanalyse aus Eltern- und Lehrersicht
- 2.3 Hypothesen bezüglich der Ursachen einer ADS
- 2.3.1 Biologisch-somatische Faktoren
- 2.3.2 Psychosoziale Faktoren
- 2.3.3 Biopsychosoziales Modell von Döpfner
- 2.3.4 Jäger- Sammler- Modell von Hartmann
- 2.1 Das Erscheinungsbild
- 3. Ausgewählte Therapiemöglichkeiten für ADS-Kinder
- 3.1 Zielführende Behandlung des ADS durch fünf Säulen nach Barkley
- 3.2 Pharmakotherapie
- 3.2.1 Verordnungs- und Produktionszahlen
- 3.2.2 Die Wirkung von Stimulanzien auf das Kind
- 3.2.3 Nebenwirkungen
- 3.3 Psychotherapie
- 3.4 Psychotherapie in Korrelation mit Pharmakotherapie
- 3.5 Psychomotorik
- 3.6 Elterntraining/Elternarbeit
- 4. Ausgewählte Interventionsmöglichkeiten zur Erhöhung schulischer Aufmerksamkeit
- 4.1 Token-System
- 4.2 Reiz- Reduktionskonzept nach Cruickshank
- 4.3 Regeln für den Unterricht nach Krowatschek
- 4.4 Selbstinstruktionstherapie nach Meichenbaum
- 4.5 Aufmerksamkeitstraining nach Lauth und Schlottke
- 5. Eine empirische Studie zur Wahrnehmung einer ADS in der Primarstufe
- 5.1 Die Problematik und die Rahmenbedingungen
- 5.2 Die Methode
- 5.2.1 Der Fragebogen als Messinstrument einer empirischen Studie
- 5.2.2 Die Struktur des Fragebogens
- 5.2.3 Geäußerte Meinungen und tatsächliches Verhalten
- 5.3 Annahmen und Erwartungen
- 5.4 Analyse und Interpretation der Antworten von Eltern
- 5.4.1 Persönliche Merkmale der Probanden
- 5.4.2 Symptome
- 5.4.3 Therapien
- 5.4.4 Familiäre „Leidensgeschichten“
- 5.4.5 Eigenverarbeitungsstrategien der Eltern
- 5.4.6 Eltern und Lehrer
- 5.5 Analyse und Interpretation der Antworten von Lehrern
- 5.5.1 Persönliche Merkmale der Probanden
- 5.5.2 Symptome
- 5.5.3 Therapien
- 5.5.4 Schulische ADS- Strategien
- 5.5.5 Lehrer und Eltern
- 5.6 Ergebnisse und Folgen
- 6. Theorie und Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) und vergleicht diese mit den Alltagserfahrungen Betroffener (Eltern und Lehrer). Ziel ist es, die Wahrnehmung von ADS in der Primarstufe zu beleuchten und die Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung von ADS
- Theorien zu den Ursachen von ADS (biologisch-somatische und psychosoziale Faktoren)
- Therapiemöglichkeiten und Interventionen im schulischen Kontext
- Ergebnisse einer empirischen Studie zur Wahrnehmung von ADS bei Eltern und Lehrern
- Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis im Umgang mit ADS
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) und dessen Wahrnehmung im Alltag konzentriert. Sie betont die kontroverse öffentliche Diskussion um ADS und die daraus resultierenden Schwierigkeiten für Betroffene bei der Auswahl geeigneter Interventionen. Die Teilnahme des Autors an einer Selbsthilfegruppe für Eltern von ADS-Kindern wird als Motivation für die vorliegende empirische Studie genannt.
1. ADS- Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom/ Störung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Aufmerksamkeit und Wahrnehmung sowie deren Störungen. Es differenziert zwischen Symptomen und Syndromen und beleuchtet den Stellenwert von Aufmerksamkeit im kindlichen Lernprozess. Weiterhin werden die Terminologie, Prävalenz und entwicklungspsychologische Aspekte von ADS behandelt.
2. Theoretische Grundlagen des ADS: Dieses Kapitel beschreibt das Erscheinungsbild von ADS, inklusive Primärsymptomen und Komorbiditäten, anhand eines Fallbeispiels. Es erläutert die diagnostischen Kriterien nach DSM-IV und ICD-10 sowie die Differentialdiagnostik. Schließlich werden verschiedene Hypothesen zu den Ursachen von ADS, sowohl biologisch-somatische als auch psychosoziale Faktoren, diskutiert, inklusive der Modelle von Döpfner und Hartmann.
3. Ausgewählte Therapiemöglichkeiten für ADS-Kinder: Dieses Kapitel stellt verschiedene Therapiemöglichkeiten für Kinder mit ADS vor. Es beschreibt das Fünf-Säulen-Modell nach Barkley, die Pharmakotherapie (einschließlich Wirkung, Nebenwirkungen und Verordnungszahlen), die Psychotherapie, den Einsatz von Psychomotorik und das Elterntraining. Die Korrelation zwischen Psychotherapie und Pharmakotherapie wird ebenfalls behandelt.
4. Ausgewählte Interventionsmöglichkeiten zur Erhöhung schulischer Aufmerksamkeit: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Interventionsmöglichkeiten zur Verbesserung der schulischen Aufmerksamkeit von Kindern mit ADS. Es werden das Token-System, das Reiz-Reduktionskonzept nach Cruickshank, die Regeln für den Unterricht nach Krowatschek, die Selbstinstruktionstherapie nach Meichenbaum und das Aufmerksamkeitstraining nach Lauth und Schlottke beschrieben und in ihren Anwendungsmöglichkeiten erläutert.
5. Eine empirische Studie zur Wahrnehmung einer ADS in der Primarstufe: Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Studie, die die Wahrnehmung von ADS bei Eltern und Lehrern in der Primarstufe untersucht. Es erläutert die Methodik (Fragebogenentwicklung und -auswertung), die Analyse der Antworten von Eltern und Lehrern (bezüglich persönlicher Merkmale, Symptomen, Therapien, familiären Erfahrungen und Strategien) und diskutiert die Ergebnisse und deren Folgen.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS), Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Primärstufe, Diagnose, DSM-IV, ICD-10, Therapiemöglichkeiten, Pharmakotherapie, Psychotherapie, Interventionen, empirische Studie, Eltern, Lehrer, Schulische Aufmerksamkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) in der Primarstufe
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) in der Primarstufe, indem sie wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Alltagserfahrungen von Eltern und Lehrern vergleicht. Sie beleuchtet die Wahrnehmung von ADS und die Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis. Die Arbeit umfasst Definitionen, theoretische Grundlagen, Therapiemöglichkeiten, Interventionsstrategien und die Ergebnisse einer empirischen Studie mit Eltern und Lehrern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und den Aspekten von ADS, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen (inkl. Diagnostik und Ursachen), ein Kapitel zu Therapiemöglichkeiten, ein Kapitel zu Interventionsmöglichkeiten im schulischen Kontext und schließlich ein Kapitel, das eine empirische Studie zur Wahrnehmung von ADS bei Eltern und Lehrern in der Primarstufe präsentiert. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert.
Welche Definitionen von Aufmerksamkeit und Wahrnehmung werden behandelt?
Kapitel 1 befasst sich ausführlich mit den Begriffen Aufmerksamkeit und Wahrnehmung und ihren Störungen im Kontext von ADS. Es werden die Unterschiede zwischen Symptomen und Syndromen erklärt und der Stellenwert von Aufmerksamkeit im Lernprozess von Kindern betont.
Welche theoretischen Grundlagen zu ADS werden diskutiert?
Kapitel 2 behandelt das Erscheinungsbild von ADS (Primärsymptome, Komorbiditäten), die diagnostischen Kriterien (DSM-IV und ICD-10) und die Differentialdiagnostik. Es werden verschiedene Hypothesen zu den Ursachen von ADS diskutiert, unter Berücksichtigung biologisch-somatischer und psychosozialer Faktoren, sowie die Modelle von Döpfner und Hartmann. Ein Fallbeispiel aus der Grundschule illustriert die Thematik.
Welche Therapiemöglichkeiten und Interventionen werden vorgestellt?
Kapitel 3 und 4 präsentieren verschiedene Therapiemöglichkeiten (Barkleys Fünf-Säulen-Modell, Pharmakotherapie, Psychotherapie, Psychomotorik, Elterntraining) und Interventionsmöglichkeiten im schulischen Kontext (Token-System, Reiz-Reduktionskonzept nach Cruickshank, Regeln nach Krowatschek, Selbstinstruktionstherapie nach Meichenbaum, Aufmerksamkeitstraining nach Lauth und Schlottke). Die Korrelation zwischen Psychotherapie und Pharmakotherapie wird ebenfalls betrachtet.
Welche Methode wurde in der empirischen Studie angewendet?
Kapitel 5 beschreibt eine empirische Studie, die mittels Fragebögen die Wahrnehmung von ADS bei Eltern und Lehrern der Primarstufe untersucht. Die Analyse umfasst die persönlichen Merkmale der Befragten, ihre Wahrnehmung der Symptome, Erfahrungen mit Therapien, familiäre Aspekte und Strategien im Umgang mit ADS. Die Ergebnisse werden separat für Eltern und Lehrer ausgewertet.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Studie?
Die empirische Studie in Kapitel 5 untersucht die Diskrepanzen zwischen der Wahrnehmung von ADS durch Eltern und Lehrer und analysiert die Strategien, die im Umgang mit ADS angewendet werden. Die Ergebnisse zeigen die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen von Eltern und Lehrern und liefern wichtige Erkenntnisse für die Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS), Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Primarstufe, Diagnose, DSM-IV, ICD-10, Therapiemöglichkeiten, Pharmakotherapie, Psychotherapie, Interventionen, empirische Studie, Eltern, Lehrer, Schulische Aufmerksamkeit.
Wo finde ich die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte?
Die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit werden im entsprechenden Abschnitt des Inhaltsverzeichnisses detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ADS mit den Alltagserfahrungen Betroffener (Eltern und Lehrer) in der Primarstufe.
- Quote paper
- Michael Ant (Author), 2005, ADS - Eine theoretische und empirische Studie über die Wahrnehmung dieser Störung in der Primarstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55440