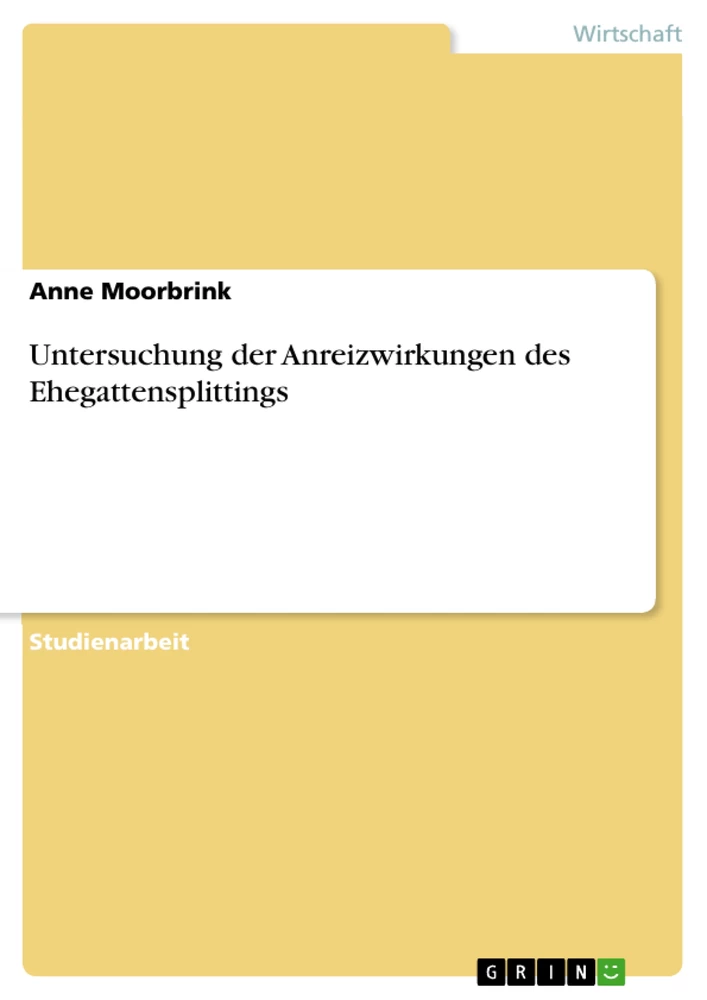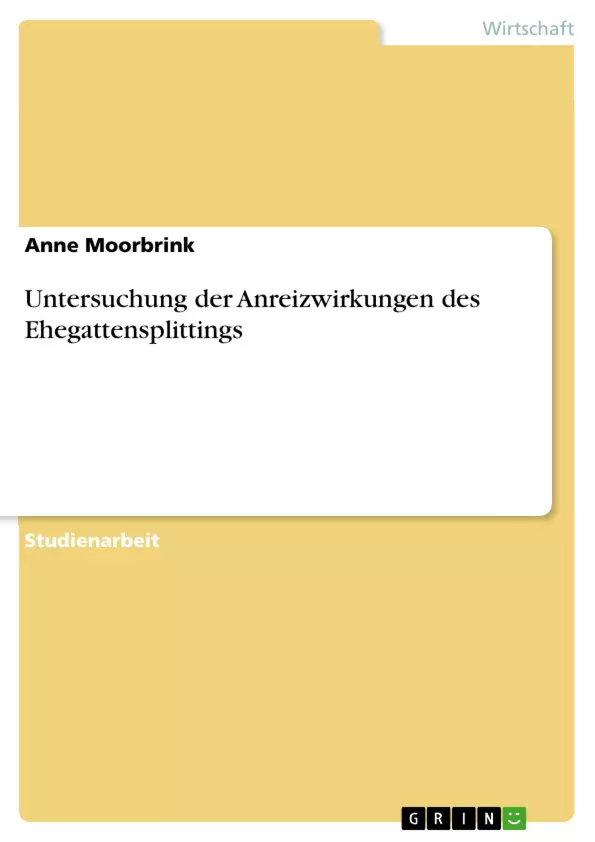Bei der Frage nach einer sachgerechten und realitätsnahen Besteuerung der Familie gerät das Ehegattensplitting immer wieder in den Fokus der politischen Parteien und in das Schussfeld der Kritik.1 Reformvorschläge werden diskutiert und eine Umgestaltung anvisiert.2
Das geltende deutsche Einkommensteuerrecht sieht nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes im Jahre 1957 die Zusammenveranlagung in Form des Ehegatten-Splittings vor. Kritiker bezweifeln, dass die Zusammenveranlagung dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit folgt. Sie sehen in diesem Verfahren vielmehr eine unbegründete Steuervergünstigung oder ungerechtfertigte Subvention der Ehe ggü. eheähnlichen Lebensgemeinschaften oder auch getrennt veranlagten Ehegatten.3 Dabei ist immer im Einzelfall zu prüfen, ob es überhaupt zu einer Besserstellung unter Anwendung des Splittingtarifes kommt oder ob die Nicht-Heirat oder getrennte Veranlagung von Ehegatten zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt.
Im folgenden zweiten Kapitel geht es zunächst darum, die verschiedenen Wahlalternativen zur Einkommensteuer gesondert herauszustellen und einen Überblick über die aktuellen einkommensteuerlichen Veranlagungsarten zu geben. Kapitel 3 umfasst den Splittingtarif im Einzelnen, die Entwicklungsgrundzüge, die Rechtfertigung durch das BVerfG sowie die gegenwärtige Kritik. Der Hauptteil dieser Seminararbeit befasst sich anschließend in Kapitel 4 mit den Anreizwirkungen, die Zusammenveranlagung zu wählen und deren Vorteile ggü. der getrennten Veranlagung. In Kapitel 5 werden Alternativen und Vorschläge zur Neuorientierung in der Familienbesteuerung analysiert. Abschließend erfolgt in der Schlussbetrachtung des sechsten Kapitels eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Veranlagungsarten im Überblick
- 2.1 Einzelveranlagung
- 2.2 Zusammenveranlagung
- 2.2.1 Getrennte Veranlagung
- 2.2.2 Zusammenveranlagung
- 2.2.3 Besondere Veranlagung
- 3 Der Splittingtarif im Einzelnen
- 3.1 Entwicklung des Ehegattensplittings
- 3.2 Begründung durch das BVerfG
- 3.3 Kritik an der Besteuerungsform
- 4 Wirkungen der Zusammenveranlagung
- 4.1 Der Splittingeffekt
- 4.2 Verdoppelung der Höchstbeträge
- 4.2.1 Vorsorgeaufwendungen
- 4.2.2 Freibeträge
- 4.3 Außergewöhnliche Belastungen
- 4.4 Interpersonelle Verrechnung
- 5 Alternativen und Vorschläge zur Neuorientierung
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Anreizwirkungen des Ehegattensplittings im deutschen Steuersystem. Ziel ist es, die verschiedenen Veranlagungsarten zu beleuchten und die Auswirkungen des Splittingtarifs auf die Steuerlast von Ehepaaren zu analysieren. Dabei werden sowohl positive als auch kritische Aspekte berücksichtigt.
- Vergleich verschiedener Veranlagungsarten (Einzelveranlagung, Zusammenveranlagung)
- Analyse des Splittingtarifs und seiner historischen Entwicklung
- Bewertung der Auswirkungen des Splittingtarifs auf die Steuerbelastung
- Diskussion der Anreizwirkungen des Splittingtarifs
- Vorstellung möglicher Alternativen und Vorschläge zur Reform
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und beschreibt die Zielsetzung sowie die Struktur der Arbeit. Sie skizziert die Bedeutung des Ehegattensplittings im deutschen Steuersystem und hebt die Relevanz der Untersuchung der Anreizwirkungen hervor.
2 Veranlagungsarten im Überblick: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen Veranlagungsarten im deutschen Einkommensteuersystem. Es werden die Einzelveranlagung und die Zusammenveranlagung mit ihren verschiedenen Ausprägungen (getrennte, gemeinsame und besondere Veranlagung) detailliert erläutert und verglichen. Der Fokus liegt auf den jeweiligen steuerlichen Konsequenzen und den damit verbundenen Unterschieden.
3 Der Splittingtarif im Einzelnen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Splittingtarif. Es beschreibt die historische Entwicklung, die rechtliche Begründung durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und die in der Literatur vorherrschende Kritik an dieser Besteuerungsform. Die Darstellung umfasst sowohl die rechtlichen als auch die ökonomischen Aspekte des Splittingtarifs.
4 Wirkungen der Zusammenveranlagung: Hier werden die konkreten Auswirkungen der Zusammenveranlagung unter Berücksichtigung des Splittingtarifs analysiert. Es werden der Splittingeffekt, die Verdoppelung von Höchstbeträgen (Vorsorgeaufwendungen und Freibeträge), die Behandlung außergewöhnlicher Belastungen und die interpersonelle Verrechnung detailliert untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der quantitativen und qualitativen Beschreibung der Effekte.
5 Alternativen und Vorschläge zur Neuorientierung: In diesem Kapitel werden verschiedene Alternativen zum bestehenden Ehegattensplitting vorgestellt und diskutiert. Es werden Reformvorschläge präsentiert und deren Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit und die Anreizwirkungen kritisch bewertet. Die Ausführungen beruhen auf ökonomischen und sozialpolitischen Überlegungen.
Schlüsselwörter
Ehegattensplitting, Einkommensteuer, Zusammenveranlagung, Einzelveranlagung, Splittingtarif, Steuerbelastung, Anreizwirkungen, Steuergerechtigkeit, Reformvorschläge, Bundesverfassungsgericht.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Ehegattensplitting im deutschen Steuersystem
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Anreizwirkungen des Ehegattensplittings im deutschen Steuersystem. Sie beleuchtet verschiedene Veranlagungsarten und analysiert die Auswirkungen des Splittingtarifs auf die Steuerlast von Ehepaaren, wobei sowohl positive als auch kritische Aspekte berücksichtigt werden.
Welche Veranlagungsarten werden behandelt?
Die Arbeit vergleicht die Einzelveranlagung und die Zusammenveranlagung mit ihren verschiedenen Ausprägungen: getrennte Veranlagung, gemeinsame Veranlagung und besondere Veranlagung. Der Fokus liegt auf den steuerlichen Konsequenzen und Unterschieden.
Wie wird der Splittingtarif behandelt?
Das Kapitel über den Splittingtarif beschreibt dessen historische Entwicklung, die rechtliche Begründung durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und die Kritik an dieser Besteuerungsform. Es werden sowohl rechtliche als auch ökonomische Aspekte beleuchtet.
Welche Auswirkungen der Zusammenveranlagung werden analysiert?
Die Analyse umfasst den Splittingeffekt, die Verdoppelung von Höchstbeträgen (Vorsorgeaufwendungen und Freibeträge), die Behandlung außergewöhnlicher Belastungen und die interpersonelle Verrechnung. Die Effekte werden quantitativ und qualitativ beschrieben.
Welche Alternativen und Reformvorschläge werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Alternativen zum Ehegattensplitting und diskutiert Reformvorschläge. Die Vor- und Nachteile im Hinblick auf Steuergerechtigkeit und Anreizwirkungen werden kritisch bewertet, basierend auf ökonomischen und sozialpolitischen Überlegungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ehegattensplitting, Einkommensteuer, Zusammenveranlagung, Einzelveranlagung, Splittingtarif, Steuerbelastung, Anreizwirkungen, Steuergerechtigkeit, Reformvorschläge, Bundesverfassungsgericht.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Veranlagungsarten, ein Kapitel zum Splittingtarif, ein Kapitel zu den Auswirkungen der Zusammenveranlagung, ein Kapitel zu Alternativen und Reformvorschlägen sowie eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Zielsetzung ist es, die verschiedenen Veranlagungsarten zu beleuchten und die Auswirkungen des Splittingtarifs auf die Steuerlast von Ehepaaren zu analysieren. Dabei werden sowohl positive als auch kritische Aspekte berücksichtigt.
- Citation du texte
- Anne Moorbrink (Auteur), 2005, Untersuchung der Anreizwirkungen des Ehegattensplittings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55524