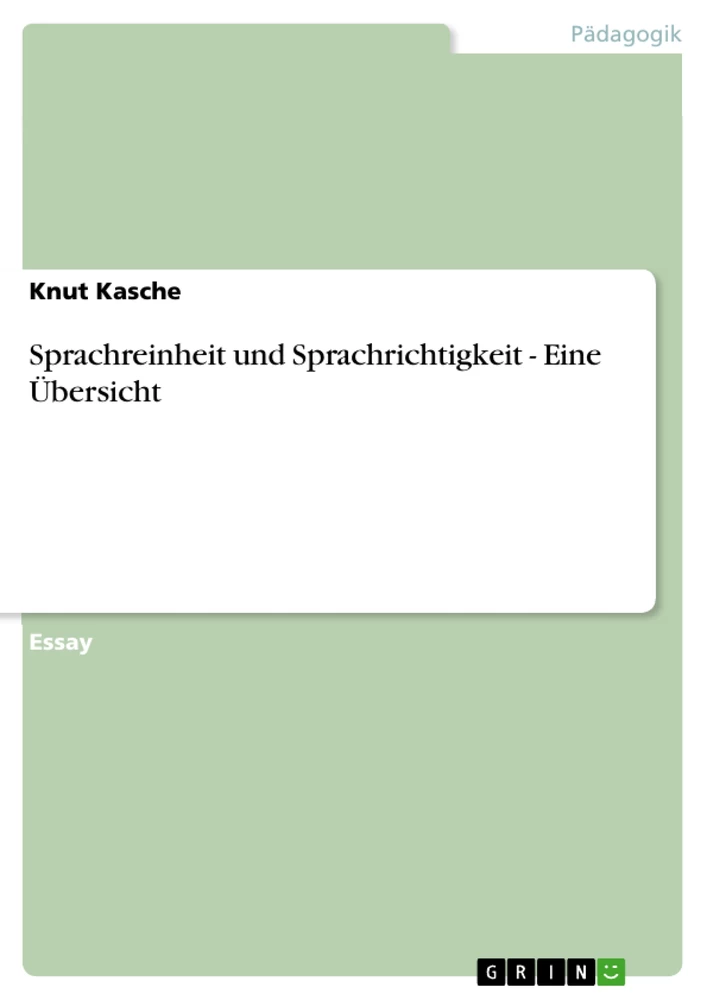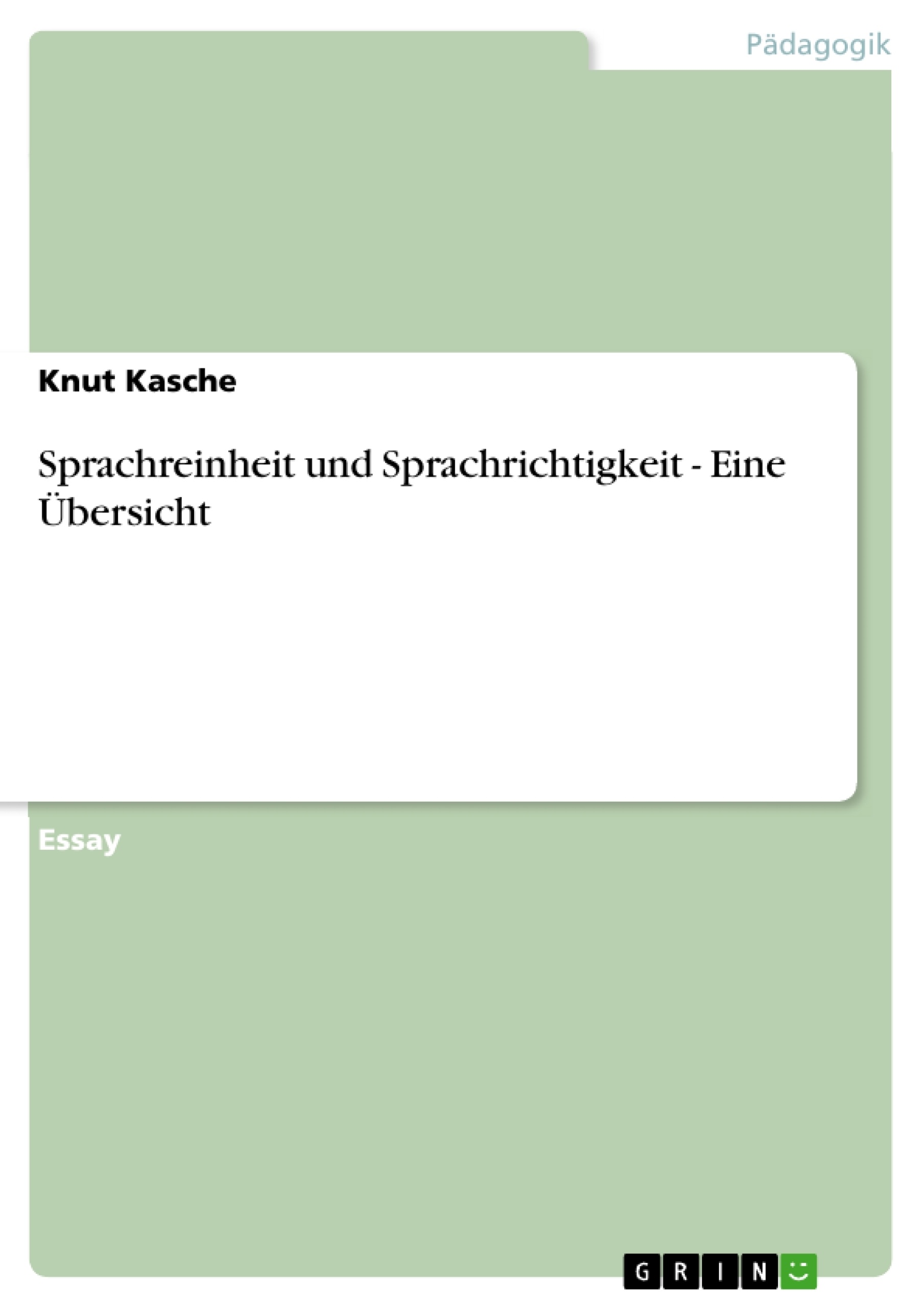1. Einleitung
Seit dem 17. Jahrhundert war im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation eine aristokratisch-bildungsbürgerliche Bewegung zu beobachten, die sich eine bewusste und gezielte Kultivierung der deutschen Sprache zur Aufgabe gemacht hatte. Grund für diese Bewegung war die immer stärkere Zunahme der Mehrsprachigkeit und der Sprachmischung. Da der Begriff der Kultivierung ein sehr umfassender Begriff ist, wurden durch die Jahrhunderte exaktere Begriffe gebraucht. Wurde im 17. Jahrhundert Kultivierung mit Spracharbeit betitelt, so prägte im Joachim Heinrich Campe den Begriff der Sprachreinigung im 18. Jahrhundert und seit den Anfängen des 19. Jahrhundert bis in unsere heutige Zeit wird Sprachkultivierung mit Sprachpflege gleichgesetzt. Vordergründig ging es bei diesen Bemühungen zu Beginn um die Konsolidierung und Entwicklung des Deutschen als Literatur- und Nationalsprache. Die „Rettung“ der deutschen Sprache ist bis heute wohl eine Aufgabe der Sprachpflege. Es waren und sind Einzelpersönlichkeiten, Freundeskreise und Institutionen die Sprachpflege betrieben und bis heute betreiben.
Durch die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts wurden sehr pauschale und irreführende Schlagwörter für die Sprachpflege geprägt, die sehr schnell auf das 17./18. Jahrhundert übertragen wurden. Begriffe wie Sprachpurismus, Fremdwortkampf oder Sprachnormung berücksichtigen zu wenig, dass die Tätigkeiten der Sprachgelehrten und Sprachfreunde in einer geistesgeschichtlichen europäischen Tradition vom Späthumanismus zur Aufklärung zu sehen sind.1
Um eine genauere Betrachtung vornehmen zu können, sollten die Schlagwörter sauber getrennt werden. Nach Alan Kirkness2 trifft der Begriff des Sprachpurismus eher für das 17./18. Jahrhundert zu. Von Fremdwortpurismus ist epochentypisch erst im 19./20. Jahrhundert zu sprechen. Der Unterschied besteht darin, dass sich Sprachpurismus nicht auf interlinguale Erscheinungen beschränkt, sondern auch versucht Fremdwörter genauso wie veraltete oder regionale Wörtern, Aussprachen und grammatischen Formen zu vermeiden. Somit stand Sprachpurismus immer im Zusammenhang damit, die deutsche Sprache zu einer National- und Literatursprache zu machen, verbunden mit einer einheitlichen Orthografie und Lexikografie. Von Fremdwortpurismus sollte man dagegen nur sprechen, wenn das Fremdwörter-Thema im Vordergrund steht und es zu einer pauschalen Ablehnung alles Fremden kommt, wie es im 19./20. Jahrhundert der Fall war.
Inhaltsverzeichnis
- I. Verdeutschungsarbeit: Sprachreinheit
- 1. Einleitung
- 2. Motive
- 3. Sprachgesellschaften
- 3.1. Geschichte
- 3.1.1. Die Fruchtbringende Gesellschaft
- 3.1.2. Deutschgesinnte Genossenschaft
- 3.1.3. Pegnesischer Blumenorden
- 3.1.4. Elbschwanorden
- 3.1.5. Aufrichtige Tannengesellschaft
- 3.2. Soziale Zusammensetzung
- 3.3. Vorbilder
- 3.1. Geschichte
- 4. Vom Kulturpatriotismus zur Volksaufklärung
- 4.1. Philipp Zesen
- 4.2. Gottfried Wilhelm Leibniz
- 4.3. Joachim Heinrich Campe
- II. Sprachrichtigkeit: Vorbilder und Prinzipien
- 1. Vorbilder und Prinzipien
- 2. Sprachregionen
- 3. Autoren und Schriften
- 4. Institutionen
- 5. Sprachkulturprinzipien
- 5.1. Wolfgang Ratke
- 5.2. Christian Gueintz
- 5.3. Justus Georg Schottel
- 5.4. Johann Bödiker
- 5.5 Hieronymus Freyer
- 5.6. Balthasar von Antesperg
- 5.7. Johann Christoph Gottsched
- 5.8. Carl Friedrich Eichinger
- 5.9. Johann Siegmund Valentin Popowitsch
- 5.10. Heinrich Braun
- 5.11. Johann Christoph Adelung
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sprachkultivierung im 17. und 18. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Sie untersucht die Entwicklung von Sprachreinheit und Sprachrichtigkeit als zentrale Konzepte der Sprachpflege und analysiert die Motive, die hinter diesen Bemühungen standen.
- Die Entwicklung des Deutschen als Literatur- und Nationalsprache
- Die Rolle von Sprachgesellschaften und einzelnen Persönlichkeiten in der Sprachpflege
- Die Bedeutung des Kulturpatriotismus und der Volksaufklärung für die Sprachentwicklung
- Die verschiedenen Argumente für die Kultivierung der deutschen Sprache
- Die Abgrenzung von Sprachpurismus und Fremdwortkampf im historischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Verdeutschungsarbeit und der Sprachreinheit. Es behandelt die Einleitung, die Motive, die Sprachgesellschaften und die Entwicklung vom Kulturpatriotismus zur Volksaufklärung.
Das zweite Kapitel untersucht die Sprachrichtigkeit, die Vorbilder und Prinzipien. Es beleuchtet die Sprachregionen, die Autoren und Schriften, die Institutionen und die verschiedenen Sprachkulturprinzipien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Sprachreinheit, Sprachrichtigkeit, Sprachpflege, Kulturpatriotismus, Volksaufklärung, Sprachgesellschaften, Sprachpurismus, Fremdwortkampf und Nationalsprache. Sie analysiert die Entwicklung der deutschen Sprache im Kontext der europäischen Geistesgeschichte und untersucht die vielfältigen Motive und Ansätze der Sprachkultivierung im 17. und 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Sprachreinheit“ im 17. und 18. Jahrhundert?
Es bezeichnete das Bestreben, die deutsche Sprache von übermäßigen Fremdwörtern und Sprachmischungen zu befreien, um sie als Nationalsprache zu konsolidieren.
Was war die „Fruchtbringende Gesellschaft“?
Die 1617 gegründete Fruchtbringende Gesellschaft war die bedeutendste deutsche Sprachgesellschaft, die sich der Pflege und Veredelung der deutschen Sprache widmete.
Wie unterscheidet sich Sprachpurismus vom Fremdwortkampf?
Sprachpurismus (17./18. Jh.) betraf auch Grammatik und Dialekte, während der Fremdwortkampf (19./20. Jh.) oft eine pauschale Ablehnung alles Fremden aus nationalistischen Motiven war.
Wer war Joachim Heinrich Campe?
Campe war ein Sprachgelehrter des 18. Jahrhunderts, der den Begriff der „Sprachreinigung“ prägte und zahlreiche deutsche Ersatzwörter für Fremdwörter erfand.
Welche Rolle spielte Justus Georg Schottel für die Sprachpflege?
Schottel gilt als der bedeutendste Theoretiker der Sprachpflege im Barock; er legte mit seinen Schriften wichtige Grundlagen für die deutsche Grammatik und Sprachkultur.
- Citar trabajo
- Knut Kasche (Autor), 2006, Sprachreinheit und Sprachrichtigkeit - Eine Übersicht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55527