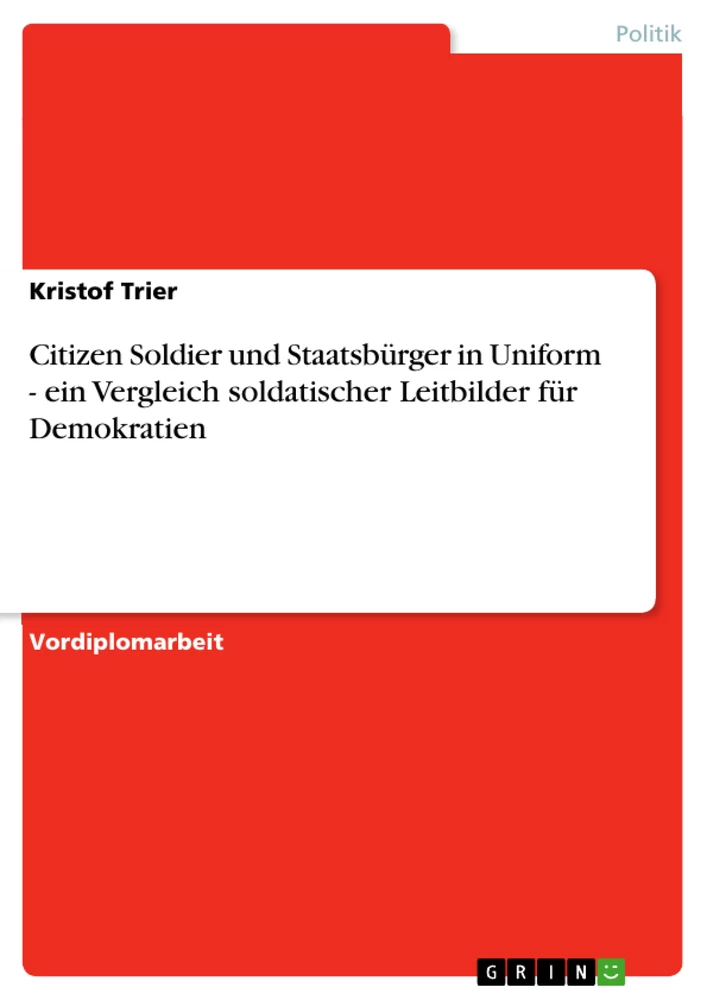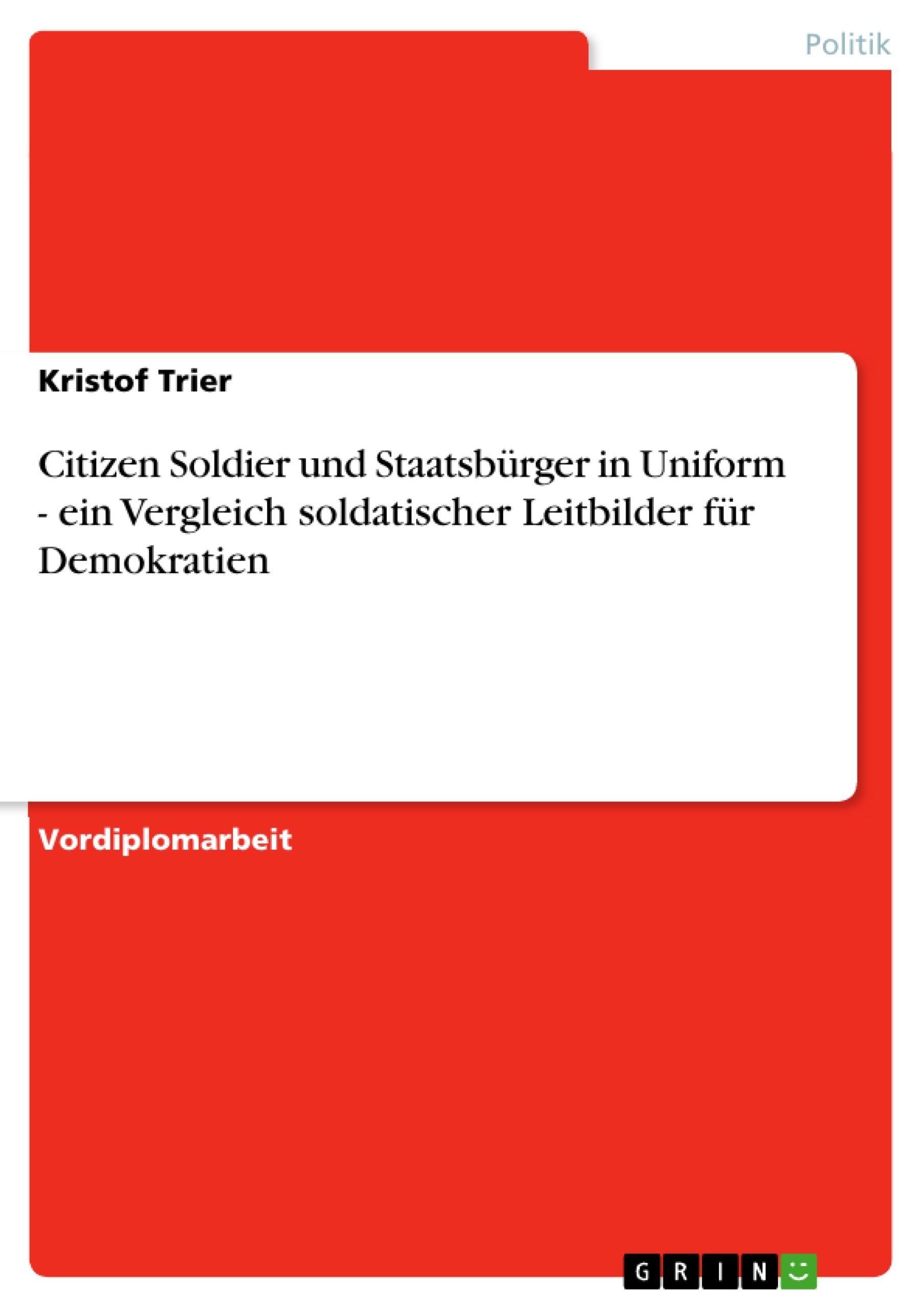Als sich der Warschauer Pakt am 01. Juli 1991 auflöste, markierte dies nicht nur das Ende eines Systems, sondern auch einer militärischen Macht, die ihren Einflussbereich 46 Jahre durch den Vormarsch der Sowjetarmeen im 2. Weltkrieg über Mittel- und Osteuropa östlich der Elbe ausgedehnt hatte. Die Auflösung, die sich bereits in den Jahren 1989/90 abgezeichnet hatte, bedeutete das Ende des Kalten Krieges. Sie bedeutete auch das Ende eines jahrzehntelangen Wettrüstens sowohl der konventionellen, als auch der nuklearen Arsenale des Ost- als auch des Westblocks. Abrüstung und Rüstungskontrollen sowie Vertrauensbildung auf den Grundlagen von Ausgewogenheit und gegenseitiger Nachprüfbarkeit ermöglichten einerseits einen politischen und militärischen Transformationsprozess, der das Ende sich gegenüberstehender Bündnissarmeen bedeutete, andererseits entstanden durch den Wegfall des Antagonismus und die damit verbundenen Umwälzungen auch neue Konflikte und außenpolitische Risiken für die westlichen Industriestaaten. Bürgerkriegsszenarien (vgl. ehemaliges Jugoslawien seit 1991), humanitäre Katastrophen (vgl. Somalia 1993) und das Erstarken der Bedrohung durch international agierende nichtstaatliche Akteure, stellen neue Anforderungen an moderne Streitkräfte. Entsprechende Reaktionen erfordern nun auch von europäischen Staaten wie Deutschland die Teilnahme an Einsätzen und Interventionen außerhalb des Landes- oder Bündnisterritoriums, so genannte „Out of Area“ -Einsätze. Für das Militär der Vereinigten Staaten von Amerika ist der Kampf nicht mehr um das eigene Territorium, sondern auf Grund des politischen Willens des Staates, seit dem Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg im April 1917 nicht mehr fremd. Im Laufe der Zeit, nach dem 2. Weltkrieg und unter dem Eindruck des gescheiterten Vietnam- Engagement zeichnete sich eine gegenseitige Abgrenzung zwischen der amerikanischen Gesellschaft und ihrer Streitkräfte ab. Diese waren seit der amerikanischen Revolution durch das Bild des „citizen soldiers“, des Bürgersoldaten, stets eng verbunden gewesen. Scharfe politische Gegensätze großer Teile der Gesellschaft einerseits und der politischen und militärischen Führung andererseits während des Vietnamkrieges fügten der Figur des citizen soldiers großen Schaden zu. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Citizen Soldier und Staatsbürger in Uniform – ein Vergleich soldatischer Leitbilder für Demokratien
- Der Staatsbürger in Uniform
- Der citizen soldier
- Vergleich
- Citizen soldier und Staatsbürger in Uniform – Ausblicke in die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Leitbilder des „Staatsbürgers in Uniform“ und des „Citizen Soldier“, um deren militärische Angemessenheit, historische Rolle und zukünftige Bedeutung im Kontext veränderter sicherheitspolitischer Lage zu analysieren. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Konzepte und ihrer Eignung für die Gestaltung zivil-militärischer Beziehungen.
- Vergleich des deutschen Leitbilds „Staatsbürger in Uniform“ mit dem amerikanischen „Citizen Soldier“
- Analyse der historischen Entstehung und Entwicklung beider Konzepte
- Bewertung der militärischen Angemessenheit beider Leitbilder
- Untersuchung des Einflusses beider Konzepte auf zivil-militärische Beziehungen
- Prognose der zukünftigen Rolle beider Leitbilder im Hinblick auf neue Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Citizen Soldier und Staatsbürger in Uniform – ein Vergleich soldatischer Leitbilder für Demokratien: Die Einleitung beschreibt den Wandel der sicherheitspolitischen Lage nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes. Sie führt die neuen Herausforderungen für moderne Streitkräfte wie Bürgerkriegszenarien und humanitäre Katastrophen an und betont die damit verbundene Notwendigkeit von „Out of Area“-Einsätzen. Dieser Abschnitt stellt den konzeptionellen Rahmen für den anschließenden Vergleich der Leitbilder „Citizen Soldier“ und „Staatsbürger in Uniform“ dar, wobei die veränderte sicherheitspolitische Lage als zentrale Einflussgröße hervorgehoben wird.
Der Staatsbürger in Uniform: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Leitbilds „Staatsbürger in Uniform“ in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beschreibt den Kontext des beginnenden Kalten Krieges, den Widerstand gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands und die Herausforderungen der Integration des Militärs in die Gesellschaft unter Berücksichtigung der freiheitlichen Grundrechte. Der Fokus liegt auf der Vermeidung einer moralischen Sonderstellung des Militärs und der Verankerung des Soldaten im gesellschaftlichen Gefüge.
Der citizen soldier: Der Abschnitt widmet sich dem amerikanischen Leitbild des „Citizen Soldier“, das auf die Tradition des Bürgersoldaten zurückgeht und besonders durch die Erfahrungen des Vietnamkriegs geprägt wurde. Die Entwicklung einer gegenseitigen Abgrenzung zwischen der amerikanischen Gesellschaft und ihren Streitkräften wird untersucht, und die Bedeutung des „Citizen Soldier“ im Kontext der amerikanischen Geschichte wird herausgearbeitet. Der Abschnitt betont den Schaden, den die politische Polarisierung während des Vietnamkriegs dem Image des „Citizen Soldier“ zufügte.
Schlüsselwörter
Citizen Soldier, Staatsbürger in Uniform, Zivil-Militärische Beziehungen, Kalter Krieg, Wiederbewaffnung, Bundeswehr, amerikanische Streitkräfte, Sicherheitspolitik, Transformationsprozess, Out of Area-Einsätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Citizen Soldier und Staatsbürger in Uniform – ein Vergleich soldatischer Leitbilder für Demokratien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die militärischen Leitbilder „Staatsbürger in Uniform“ (Deutschland) und „Citizen Soldier“ (USA). Sie analysiert deren Angemessenheit, historische Rolle und zukünftige Bedeutung im Kontext veränderter sicherheitspolitischer Lagen und deren Einfluss auf zivil-militärische Beziehungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Vergleich der beiden Leitbilder, ihre historische Entstehung und Entwicklung, die militärische Angemessenheit, den Einfluss auf zivil-militärische Beziehungen und prognostiziert deren zukünftige Rolle angesichts neuer Herausforderungen.
Wie wird der „Staatsbürger in Uniform“ definiert?
Das Kapitel „Der Staatsbürger in Uniform“ beleuchtet die Entstehung dieses Leitbildes in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beschreibt den Kontext des Kalten Krieges, den Widerstand gegen die Wiederbewaffnung und die Integration des Militärs in die Gesellschaft unter Wahrung der Grundrechte. Der Fokus liegt auf der Vermeidung einer moralischen Sonderstellung des Militärs.
Wie wird der „Citizen Soldier“ definiert?
Der „Citizen Soldier“ wird im Kontext der amerikanischen Tradition des Bürgersoldaten und insbesondere im Hinblick auf die Erfahrungen des Vietnamkriegs untersucht. Die Arbeit analysiert die Entwicklung einer möglichen Abgrenzung zwischen amerikanischer Gesellschaft und Streitkräften und die Bedeutung des „Citizen Soldier“ in der amerikanischen Geschichte, inklusive der negativen Auswirkungen der politischen Polarisierung während des Vietnamkriegs.
Welche Herausforderungen der Sicherheitspolitik werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Wandel der sicherheitspolitischen Lage nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes. Neue Herausforderungen wie Bürgerkriegszenarien, humanitäre Katastrophen und „Out of Area“-Einsätze werden als zentrale Einflussgrößen für die Entwicklung und den Vergleich der beiden Leitbilder hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Citizen Soldier, Staatsbürger in Uniform, Zivil-Militärische Beziehungen, Kalter Krieg, Wiederbewaffnung, Bundeswehr, amerikanische Streitkräfte, Sicherheitspolitik, Transformationsprozess, Out of Area-Einsätze.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu einem Vergleich der Leitbilder, einer detaillierten Betrachtung des „Staatsbürgers in Uniform“, einer detaillierten Betrachtung des „Citizen Soldier“ und einem Ausblick in die Zukunft beider Konzepte.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel ist im Dokument enthalten und beschreibt die zentralen Inhalte und Argumentationslinien jedes Abschnitts.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für alle relevant, die sich mit Sicherheitspolitik, Militärsoziologie, zivil-militärischen Beziehungen und der Geschichte und Entwicklung militärischer Leitbilder in Demokratien auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Kristof Trier (Autor), 2004, Citizen Soldier und Staatsbürger in Uniform - ein Vergleich soldatischer Leitbilder für Demokratien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55562