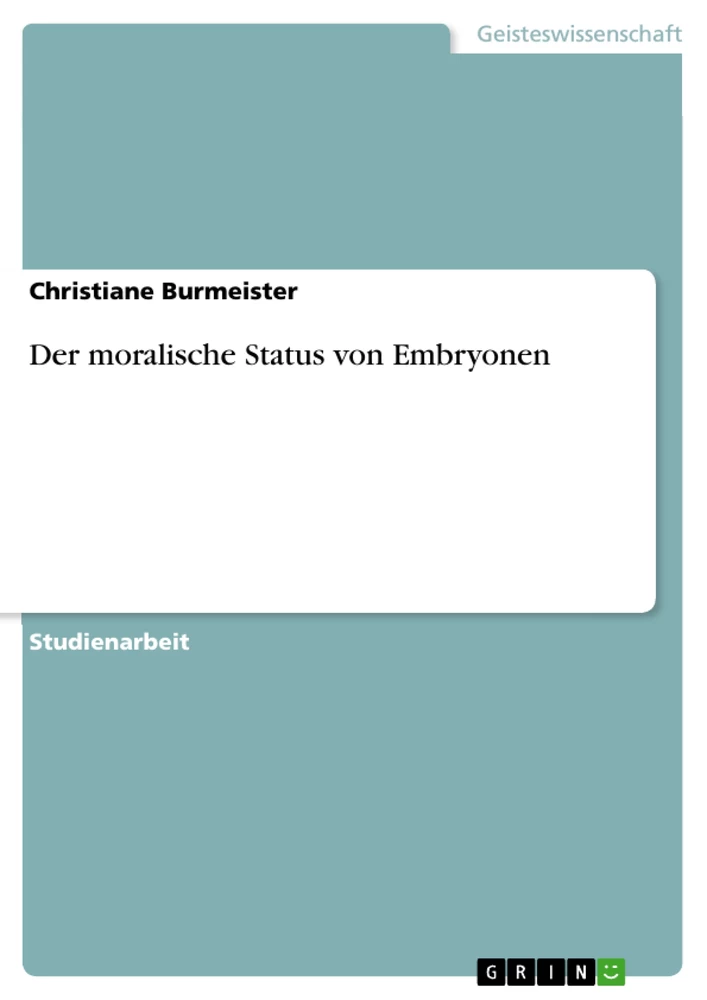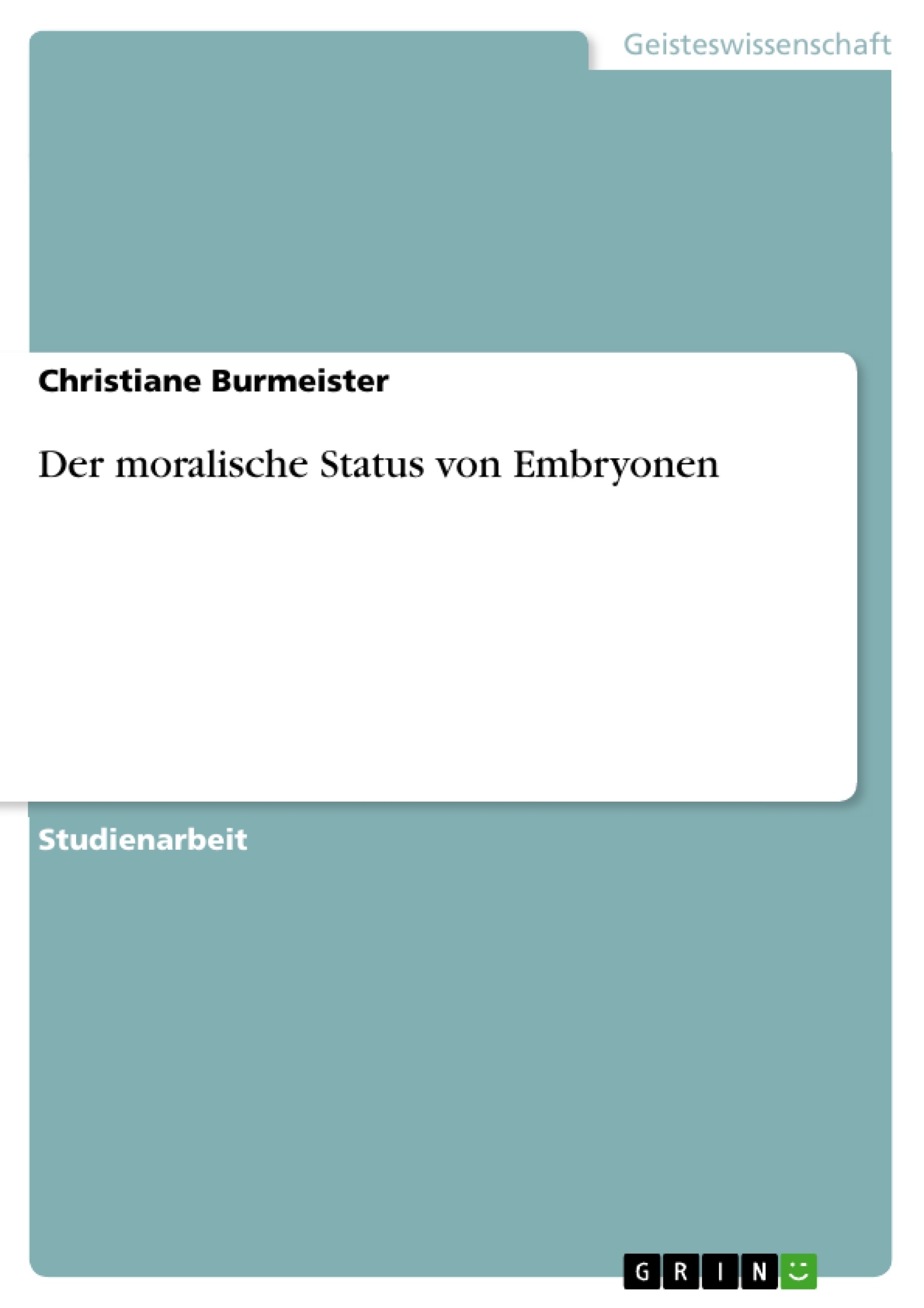Seit dem Ende 2000 erfolgten Beschluss des britischen Parlaments, das therapeutische Klonen menschlicher Embryonen bis zum 14. Tag freizugeben, ist die Debatte um den moralischen Status von Embryonen auch in Deutschland erneut entbrannt. Die Hoffnungen auf einmalige Fortschritte in der Medizin stehen moralischen Bedenken über die gesellschaftlichen Risiken und dem Vorwurf der Menschenrechtsverletzung an Embryonen gegenüber. Es soll im Folgenden versucht werden, diesen Vorwurf vor dem Hintergrund einer Untersuchung des moralischen Status von Embryonen zu prüfen.
Die jüngste Diskussion unter renommierten deutschen Philosophen wurde durch einen im Januar 2001 veröffentlichten Zeitungsartikel von Julian Nida-Rümelin ausgelöst. Seine vorsichtige aber im Grunde positive Stellungnahme zur Freigabe des therapeutischen Klonens entfachte eine Welle von kritischen aber auch beipflichtenden Stimmen, die sich nicht nur auf die Feuilletons beschränkte sondern durch alle Medien zog. Die Kontroverse demonstriert in erster Linie exemplarisch das Meinungsspektrum der Beteiligten zwischen den Fronten der Apokalyptiker und Euphoriker. Ihr Verlauf soll zunächst chronologisch und unter Beleuchtung ihrer wesentlichen Argumente und Begründungsmuster aufgezeichnet werden. Dabei ist vor allem die Terminologie ein Brandherd der Missverständnisse, weshalb diese im Vorfeld zu definieren ist. Die semantische Problematik einer Begriffserklärung von „Menschenwürde“ soll hier nicht im Vordergrund stehen, wird aber an mancher Stelle zum eigentlichen Problem. Die unbedingte, unverwirkbare und kategorische Geltung der Menschenwürde wird beim Menschen vorausgesetzt. Ihre Extensionsfähigkeit auf den Embryo ist das zu Erforschende. Aus Gründen der Orientierung an den textlichen Vorlagen der Artikel wird der Begriff „Embryo“ im Folgenden ohne nähere Definition verwendet. Dort, wo jedoch eine Differenzierung notwendig ist, unterscheide ich zwischen 1. präembryonalen Keimen im Stadium bis zur Einnistung in die Gebärmutter (14. Tag), 2. Embryonen, bis zum Abschluss der Organentwicklung (etwa 12. Schwangerschaftswoche) und 3. Föten, bis zur Geburt. Des Weiteren wird versucht, die Wiedergabe der Debatte auf die für das Thema relevanten Informationen zu beschränken. Denn zu leicht vermischen sich die Argumente, welche tatsächlich den moralischen Status von Embryonen diskutieren, mit jenen, die allein die politische Frage nach biotechnischem Fortschritt, seinen Möglichkeiten und Risiken im Blick haben
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Dokumentation einer Debatte:
- Julian Nida-Rümelin: „Wo die Menschenwürde beginnt“
- Wilhelm Vossenkuhl: „Der Mensch ist des Menschen Zelle“
- Robert Spaemann: „Gezeugt, nicht gemacht“
- Volker Gerhard: „Vom Zellhaufen zur Selbstachtung“
- Reinhard Merkel: „Rechte für Embryonen“
- Georg H. Fey/ Carl Friedrich Gethmann: „Wir dürfen unsere Evolution nicht dem Zufall überlassen“
- Otfried Höffe: „Wessen Menschenwürde“
- Julian Nida-Rümelin: „Humanismus ist nicht teilbar“
- Das Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potenzialitätsargument
- Das Speziesargument
- Das Kontinuumsargument
- Das Identitätsargument
- Das Potentialitätsargument
- Wie die Schutzwürdigkeit von Embryonen überdies zu begründen ist
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der aktuellen Debatte um den moralischen Status von Embryonen, die durch die Freigabe des therapeutischen Klonens in Großbritannien ausgelöst wurde. Sie analysiert die Argumente prominenter deutscher Philosophen, die in der „Feuilleton-Debatte“ 2001 zum Ausdruck kamen, und untersucht die verschiedenen Perspektiven auf die ethischen Herausforderungen des biotechnologischen Fortschritts.
- Der moralische Status von Embryonen
- Das Kriterium der Menschenwürde in Bezug auf Embryonen
- Die ethischen Herausforderungen des therapeutischen Klonens
- Die Bedeutung von Schutzwürdigkeit für Embryonen
- Die gesellschaftlichen Folgen biotechnologischer Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Stand der Debatte um den moralischen Status von Embryonen und die Bedeutung des therapeutischen Klonens. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und führt die wichtigsten Begriffe ein.
Der zweite Abschnitt dokumentiert die „Feuilleton-Debatte“ 2001 anhand von acht Beiträgen verschiedener Philosophen. Die Argumente und Begründungsmuster werden chronologisch dargestellt, wobei der Fokus auf die Debatte um den moralischen Status von Embryonen liegt.
Der dritte Abschnitt analysiert die klassischen Argumente der Debatte um den Status von Embryonen: das Speziesargument, das Kontinuumsargument, das Identitätsargument und das Potentialitätsargument. Diese Argumente werden kritisch geprüft und ihre Stärken und Schwächen beleuchtet.
Der vierte Abschnitt stellt alternative Begründungen für die Schutzwürdigkeit von Embryonen vor, die ohne Rückgriff auf das Argument der Menschenwürde auskommen.
Der fünfte Abschnitt bietet ein Fazit der Arbeit und eine persönliche Stellungnahme des Autors.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Medizinethik und Bioethik, insbesondere mit dem moralischen Status von Embryonen, dem Konzept der Menschenwürde, dem therapeutischen Klonen, der Schutzwürdigkeit von Embryonen und den ethischen Herausforderungen des biotechnologischen Fortschritts.
- Arbeit zitieren
- Christiane Burmeister (Autor:in), 2005, Der moralische Status von Embryonen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55579