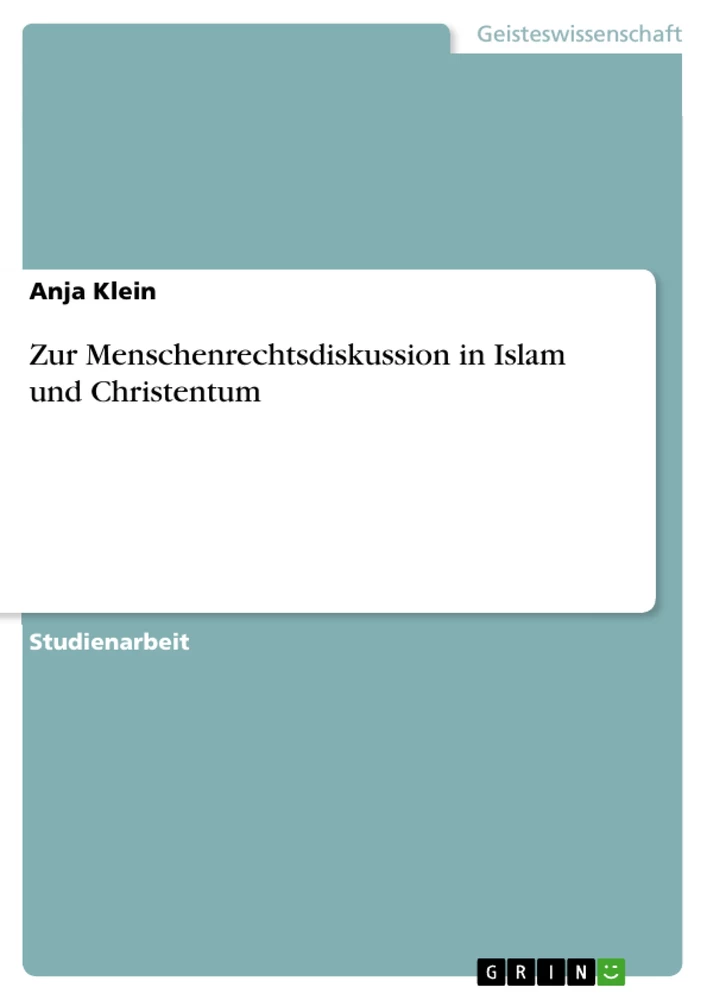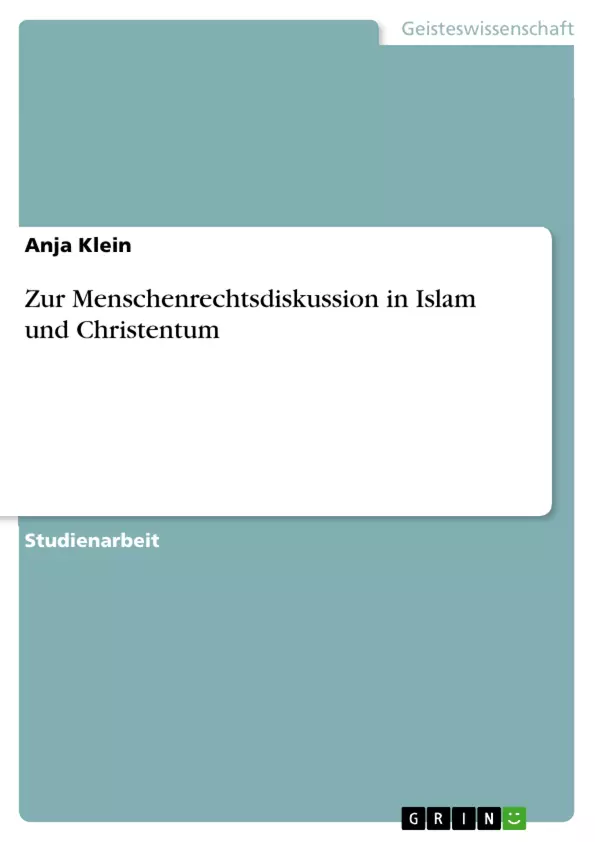Menschenrechte bezeichnen universelle und unteilbare Rechte, die allen Menschen von ihrer Geburt an zustehen; unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Überzeugung und nationaler und sozialer Herkunft. Der Anspruch der Unteilbarkeit der Menschenrechte besagt, dass sie stets in ihrer Gesamtheit verwirklicht werden müssen. Menschenrechte können dem Einzelnen nicht durch öffentliche Gewalt entzogen werden, da sie mit dem Einzelnen untrennbar verbunden sind, sie sind somit vor- bzw. überstaatlicher Natur. Im Unterschied zu Bürgerrechten gelten Menschrechte für alle Menschen die sich in einem Land aufhalten, unabhängig davon, ob sie dessen Staatsbürger sind oder nicht. Durch die Formulierung von Grundrechten in Verfassungen und internationalen Abkommen wird versucht, die Menschenrechte als einklagbare Rechte zu gestalten.
Wichtige Quellen für den Inhalt und die Umsetzung der Menschenrechte sind „the International Bill of Human Rights der Vereinten Nationen“, sowie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948. Weitere zentrale Menschenrechtsinstrumente sind der Internationale Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte, sowie der Internationale Pakt über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte, die 1966 von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurden und zehn Jahre später in Kraft traten. Ebenso gibt es bestimmte Konventionen, die den Schutz einzelner Menschenrechte zum Inhalt haben (Die Genfer Flüchtlingskonvention, die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, die UN-Anti-Folter-Konvention, die UN-Kinderrechtskonvention, die Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, die Internationale Konvention zur Beseitigung aller Formen von Rassendiskriminierung, die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, etc.).
In England im 17. Jahrhundert kam es in politischen Kämpfen zur Entwicklung grundlegender vorstaatlicher Rechte, die der Einzelne gegenüber der politischen Gemeinschaft geltend machen können sollte. Hierbei wurden vor allem die mit dem Ständerecht verbundenen Freiheiten als Freiheiten für alle zurück gefordert. Diese Freiheiten der Stände beruhten auf der Magna Charta („der großen Urkunde der Freiheiten“) von 1215, des ersten „Grundgesetzes“ in Europa, das in erster Linie eine Satzung des Lehnrechtes war.
Inhaltsverzeichnis
- Definition und Entstehung der Menschenrechte- ein kurzer historischer Überblick
- Menschenrechte aus Sicht der Bibel
- Evangelische Interpretation der Menschenrechte
- Freiheit des Glaubens aus Sicht der Rechtfertigungslehre Luthers
- Islamische Ethik
- Ethik des Korans und die vorislamische Zeit
- Rechtsquellen
- Die Schließung des Tores der persönlichen Rechtsfindung
- Christentum und Menschenrechte
- Stellung der Kirche zu den Menschenrechten- früher und heute
- Zur politischen Konstellation der westlichen Gesellschaft
- Der Staat und die Religionen
- Die Theokratie
- Exkurs zur Renaissance des Islams
- Fazit zum Staat und den Religionen
- Islamisches Recht in Bezug auf die Menschenrechte
- Die Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam
- Christlich- Islamischer Dialog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Konzeption von Menschenrechten aus verschiedenen religiösen Perspektiven zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen den Menschenrechten und dem christlichen sowie dem islamischen Glauben.
- Die philosophischen und historischen Grundlagen der Menschenrechte
- Die Interpretation der Menschenrechte aus der Sicht des christlichen Glaubens
- Die Bedeutung der Rechtfertigungslehre Luthers für die Konzeption von Menschenrechten
- Die islamische Ethik und die Menschenrechte
- Der christlich-islamische Dialog im Kontext der Menschenrechte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Definition und Entstehung der Menschenrechte- ein kurzer historischer Überblick
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Menschenrechtsgedankens. Es werden die wichtigsten Quellen und Dokumente des internationalen Menschenrechtsschutzes vorgestellt. Das Kapitel geht auf die Bedeutung der englischen Revolution und der Magna Charta für die Entwicklung des Konzepts von grundlegenden Rechten ein.
2. Menschenrechte aus Sicht der Bibel
Dieses Kapitel untersucht die biblische Grundlage für den Menschenrechtsgedanken. Es wird auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen und die besondere Würde des Menschen innerhalb der Schöpfung eingegangen. Die Bedeutung des Lebens und des Wirkens Jesu für die Menschenrechtskonzeption wird beleuchtet.
3. Evangelische Interpretation der Menschenrechte
Dieses Kapitel beleuchtet die evangelische Interpretation der Menschenrechte. Es wird die besondere Bedeutung der relationalen Auffassung der Gottebenbildlichkeit im evangelischen Verständnis hervorgehoben. Aus der Beziehung des Menschen zu Gott wird die Universalität und Unverfügbarkeit der Würde des Menschen abgeleitet.
4. Freiheit des Glaubens aus Sicht der Rechtfertigungslehre Luthers
Dieses Kapitel untersucht die Relevanz der Rechtfertigungslehre Luthers für die Konzeption von Menschenrechten. Es wird dargelegt, dass die Gottesrelation den Menschen zu dem macht, was er ist und ihn somit aus der Verfügbarkeit durch den Menschen entzieht.
5. Islamische Ethik
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die islamische Ethik und ihre Bedeutung für das Menschenrechtverständnis. Es werden die Rechtsquellen des Islams und die Frage nach der Schließung des Tores der persönlichen Rechtsfindung behandelt.
6. Christentum und Menschenrechte
Dieses Kapitel beleuchtet die Stellung der Kirche zu den Menschenrechten in Vergangenheit und Gegenwart. Es geht auf die politische Konstellation der westlichen Gesellschaft und die Relevanz der Menschenrechte für die Kirche ein.
7. Der Staat und die Religionen
Dieses Kapitel behandelt die Beziehung zwischen Staat und Religionen im Kontext des Menschenrechtsgedankens. Es werden verschiedene Formen der Beziehung, wie zum Beispiel die Theokratie, analysiert und die Renaissance des Islams im Zusammenhang mit dem Menschenrechtsschutz diskutiert.
8. Islamisches Recht in Bezug auf die Menschenrechte
Dieses Kapitel behandelt die Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb des islamischen Rechts im Hinblick auf die Menschenrechte.
9. Christlich- Islamischer Dialog
Dieses Kapitel befasst sich mit dem christlichen-islamischen Dialog im Kontext der Menschenrechte. Es geht auf die Herausforderungen und Chancen des Dialogs ein und beleuchtet die Bedeutung der gegenseitigen Verständigung für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte.
Schlüsselwörter
Menschenrechte, Gottebenbildlichkeit, Würde des Menschen, Evangelische Theologie, Rechtfertigungslehre Luthers, Islamische Ethik, Christlich-Islamischer Dialog, Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam
Häufig gestellte Fragen
Was sind Menschenrechte?
Menschenrechte sind universelle, unteilbare und unveräußerliche Rechte, die jedem Menschen von Geburt an zustehen, unabhängig von Herkunft, Religion oder Geschlecht.
Wie begründet das Christentum die Menschenrechte?
Die christliche Begründung stützt sich primär auf die "Gottebenbildlichkeit" des Menschen, aus der eine unantastbare Würde abgeleitet wird.
Was ist die Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam?
Es ist eine Erklärung von 1990, die Menschenrechte aus islamischer Sicht definiert und diese oft unter den Vorbehalt der Scharia stellt.
Welchen Einfluss hatte Luther auf die Glaubensfreiheit?
Luthers Rechtfertigungslehre betont die unmittelbare Beziehung des Einzelnen zu Gott, was den Menschen dem Zugriff weltlicher Gewalt in Glaubensfragen entzieht.
Was war die Magna Charta von 1215?
Sie gilt als eines der ersten Dokumente, das grundlegende Freiheiten gegenüber der staatlichen (königlichen) Macht festschrieb.
- Quote paper
- Anja Klein (Author), 2006, Zur Menschenrechtsdiskussion in Islam und Christentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55646